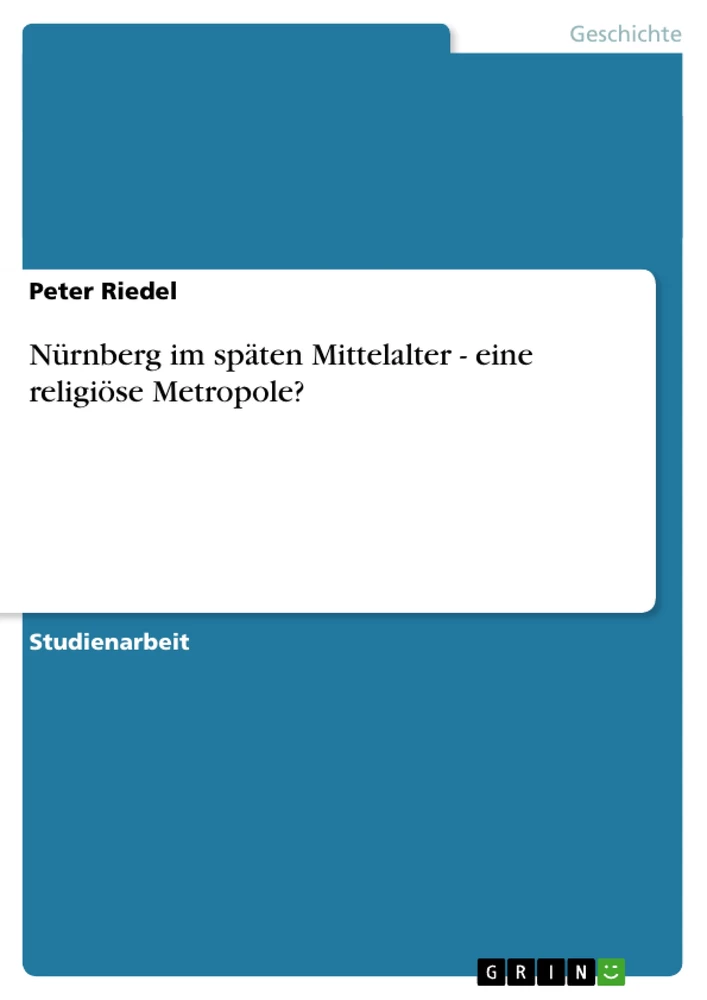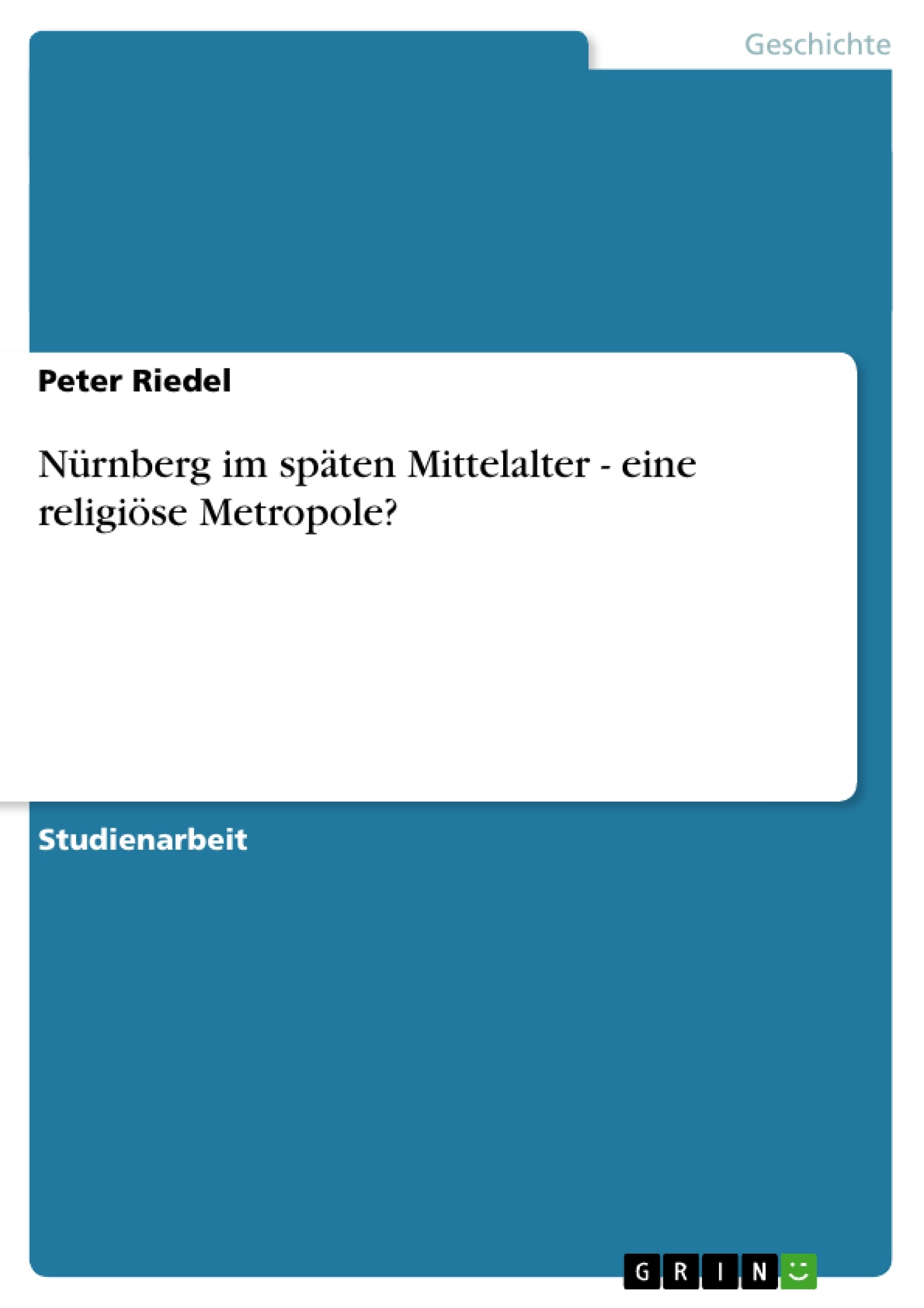Bereits ein Blick auf die jüngsten publizistischen Auseinandersetzungen um die (Selbst-)Definition der Bundeshauptstadt Berlin als "Metropole" zeigt, dass dieser Begriff offenbar nur schwer mit konkreten Inhalten zu füllen ist. Um sich daher der Nürnberger Kirchengeschichte im späten Mittelalter unter dem Gesichtspunkt zuwenden zu können, ob die Stadt eine "religiöse Metropole" jener Zeit war, ist es notwendig, den Begriff zunächst näher einzugrenzen, wie dies Evamaria Engel und Karen Lambrecht in einem begriffsgeschichtlich orientierten Aufsatz versucht haben: "Metropolis" meinte in seiner ersten, ursprünglich antiken Bedeutung "eine ′Mutter-Stadt′ in Hinblick auf die von ihr ausgehenden Neugründungen, aber auch ′Zentrum′ und ′Hauptstadt′ einer Provinz" . Daran anknüpfend habe sich zweitens der kirchenrechtliche Begriff des Metropoliten entwickelt, der als Erzbischof einer Kirchenprovinz vorsteht; eine Metropole wäre damit die Residenzstadt eines Erzbischofs. Schließlich bezeichne der Begriff drittens - losgelöst von seiner Ursprungsbedeutung - Städte, in denen "zentrale Faktoren überregionale Bedeutung qualitativer Art bekommen [...] oder zu einer Region in Beziehung gesetzt werden [...]" .
Sofern man einen solchen Metropolenbegriff also auf das mittelalterliche Nürnberg anwenden möchte, ist man zu einer Auseinandersetzung mit diesen drei Definitionsansätzen gezwungen.
Der erste Ansatz scheint auf das Mittelalter nur sehr bedingt übertragbar zu sein. Er basiert zu sehr auf einem zentralistischen Herrschaftsbild und dem Modell einer von einer Hauptstadt aus regierten, festgefügten Region ("Provinz"), als dass er der Vielfältigkeit mittelalterlicher Herrschaftsverhältnisse gerecht werden könnte. Wenngleich die Stadt Nürnberg "[ä]hnlich wie die italienischen Stadtrepubliken [ein Territorium besaß], das zudem das größte aller deutschen Reichsstädte war" , so war die Stadt doch selbst innerhalb ihrer eigenen Mauern nicht vollkommen rechtlich autonom, sondern unter anderem abhängig vom König, vom Burggrafen und nicht zuletzt vom Bamberger Bischof.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stellung der Nürnberger Pfarreien im spätmittelalterlichen Kirchensystem
- Das pfarrliche Leben
- Das monastische Leben
- „Metropolis“? - die Spezifik der Religiösität in Nürnberg
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die religiöse Bedeutung der Stadt Nürnberg im späten Mittelalter. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob Nürnberg trotz des Fehlens eines Bischofssitzes als "religiöse Metropole" bezeichnet werden kann. Im Zentrum der Betrachtung stehen die Nürnberger Pfarreien, das pfarrliche und monastische Leben sowie die spezifische Religiösität der Stadt.
- Die Stellung der Nürnberger Pfarreien im spätmittelalterlichen Kirchensystem
- Das pfarrliche Leben in Nürnberg
- Die Rolle des monastischen Lebens in Nürnberg
- Die spezifische Religiösität der Stadt Nürnberg im späten Mittelalter
- Die Frage nach dem "Metropolencharakter" Nürnbergs im Hinblick auf die religiöse Sphäre
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage nach der religiösen Bedeutung Nürnbergs im Spätmittelalter und erläutert die verschiedenen Begriffsdefinitionen von "Metropole" im historischen Kontext. Die Arbeit untersucht, inwieweit der Begriff auf Nürnberg im Hinblick auf die religiöse Sphäre anwendbar ist.
- Die Stellung der Nürnberger Pfarreien im spätmittelalterlichen Kirchensystem: Dieses Kapitel analysiert die Einordnung der Nürnberger Pfarreien in das übergeordnete Kirchensystem des späten Mittelalters und beleuchtet deren organisatorische Strukturen und Funktionen.
- Das pfarrliche Leben: Hier wird das tägliche Leben in den Nürnberger Pfarreien beschrieben, einschließlich der religiösen Praktiken, der Rolle des Pfarrers und der Bedeutung der Kirche für die Bevölkerung.
- Das monastische Leben: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle der Klöster in Nürnberg und untersucht ihre Bedeutung für das religiöse Leben der Stadt, sowie ihre Einflussnahme auf die Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Stadt Nürnberg im späten Mittelalter, mit Schwerpunkt auf der religiösen Sphäre. Dabei stehen die Nürnberger Pfarreien, das pfarrliche und monastische Leben, die spezifische Religiösität der Stadt sowie die Frage nach dem "Metropolencharakter" Nürnbergs im Zentrum der Betrachtung. Weitere wichtige Themen sind die Einordnung Nürnbergs in das übergeordnete Kirchensystem des späten Mittelalters, die Rolle der Kirche im öffentlichen Leben und die Bedeutung der religiösen Institutionen für die Bevölkerung.
- Arbeit zitieren
- Peter Riedel (Autor:in), 2000, Nürnberg im späten Mittelalter - eine religiöse Metropole?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8862