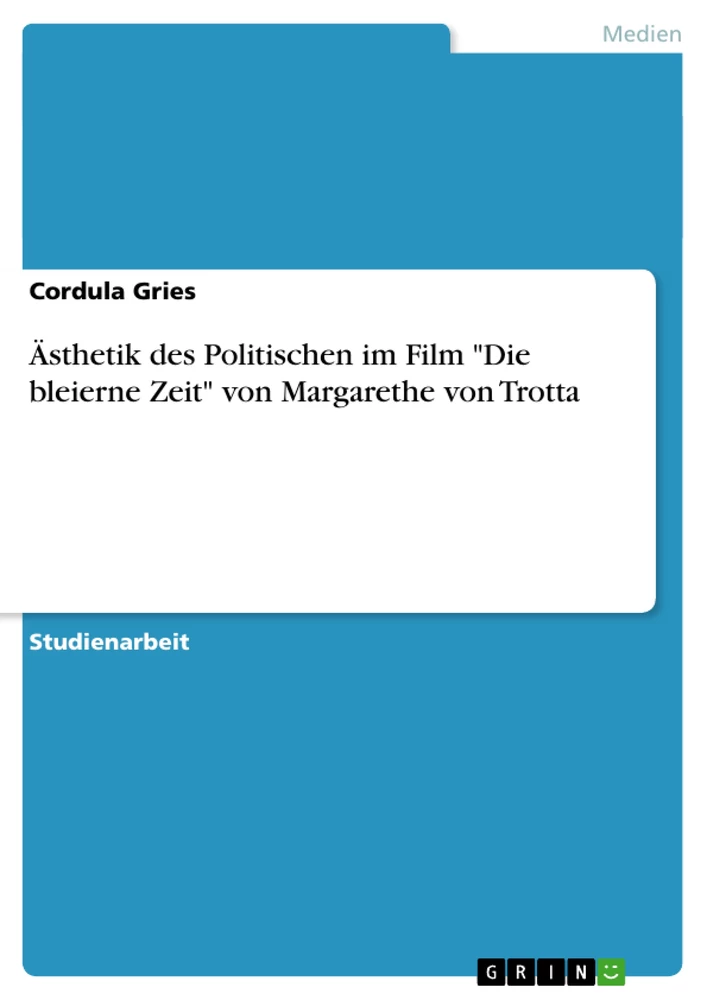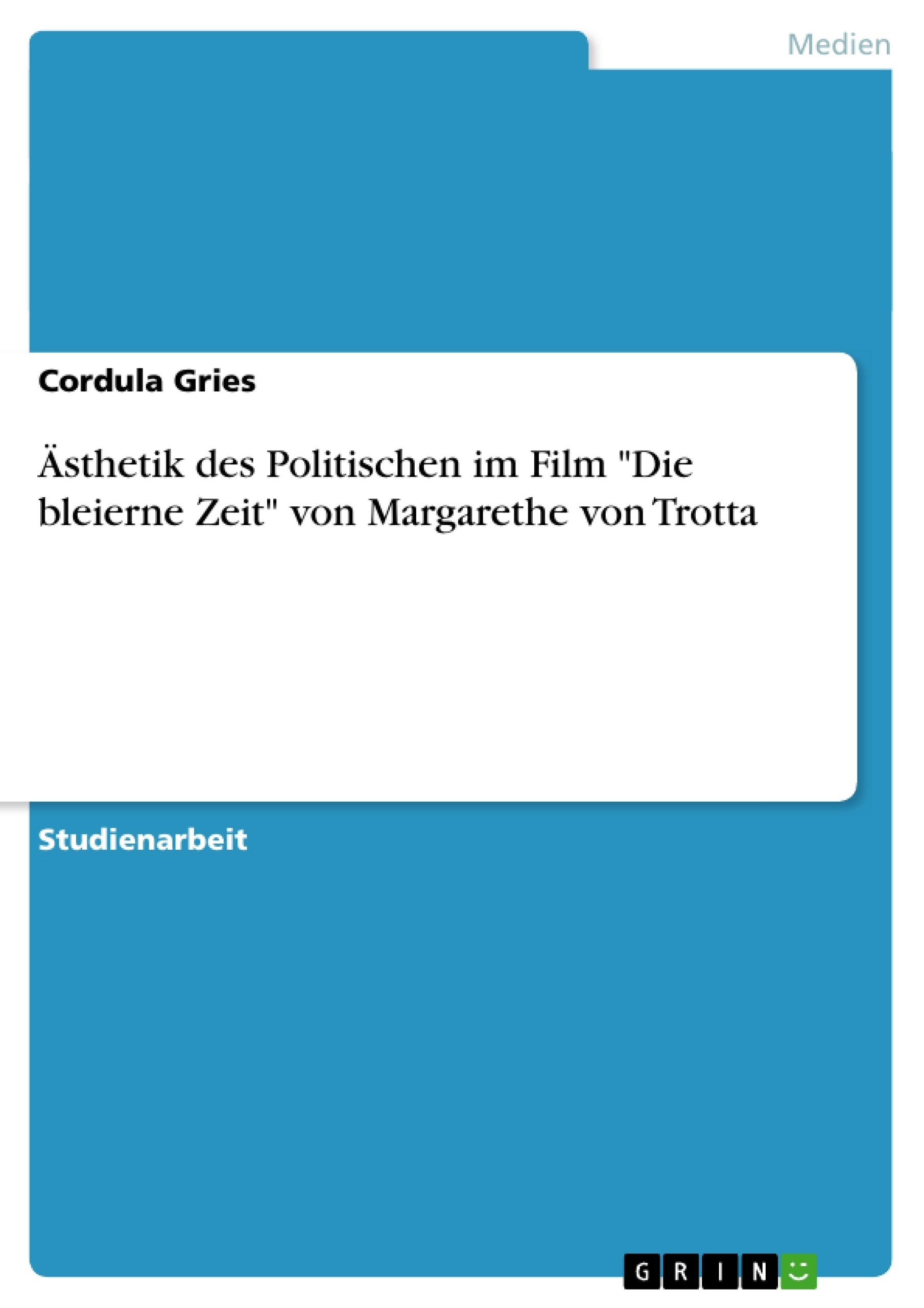Im klassischen Hollywood-Kino ist das politisch Korrekte und Unkorrekte häufig recht eindeutig auszumachen, denn die vermittelte Moralvorstellung wurde bis in die 60er Jahre durch den „Hays Code“ geregelt und vorgegeben. Aber auch danach hat sich an der Grundstruktur von Gut und Böse nicht viel verändert. Politische und gesellschaftliche Werte sind an Figuren geknüpft, die für den Zuschauer recht leicht zu charakterisieren sind. Der Held ist eigentlich ein Antiheld, in dessen Leben zwar nicht alles ohne Fehl und Tadel ist, aber der, wenn es darauf ankommt, über sich hinauswächst und für das Gute und Richtige kämpft. Während ein Großteil der Filmbösen erkennbar „unamerikanisch“ ist. Verzerrte Gesichter, häufig ein dunkler Teint oder ein deutlicher Akzent der Sprache kennzeichnen die Bösewichte. Hollywood spricht eine klare, unmissverständliche Sprache.
Auf das deutsche Kino der 60er, 70er und 80er Jahre lässt sich diese Schablone nicht legen. Gut und Böse sind hier nicht eindeutig definiert. Während Filmproduktionen in Hollywood in einem wirtschaftlichen Gefüge entstanden und entstehen, auf das die Politik bzw. die politische Eliten der USA immer Einfluss ausübten, entstanden die Produktionen des Neuen Deutschen Films in Ablehnung der Filmindustrie, mit individueller Verve und kritischem Engagement. Die Autoren verstanden sich als kritische Avantgarde und wollten sich in die politischen und gesellschaftlichen Debatten einmischen. In ihren Filmen beleuchten sie unterschiedlichste Lebensentwürfe, Ideologien, politisches Geschehen und gesellschaftliche Problematiken. Doch die Struktur ist durch das Doppelbödige dahinter geprägt. Sie liefern keine vorgefertigten Antworten wie Hollywoodproduktionen, sondern der Zuschauer muss die Bilder zu Ende sehen, denken, fühlen. Erst dann finden die Filme ihren Abschluss, wie der Filmemacher Roland Klick es beschreibt.
Auch der Film Die bleierne Zeit von Margarethe von Trotta, der 1981 entstanden ist, gehört noch in den Kontext des Neuen Deutschen Films, der erst in den frühen 80ern mit dem Tod Rainer Werner Fassbinders seinen Abschluss fand. Mit ihm arbeitete die Trotta noch als Schauspielerin zusammen. Ebenso mit Volker Schlöndorff, bei dessen Film Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1975) sie erstmals Co-Regie führte. Hier beginnt wohl auch ihre filmische Auseinandersetzung mit dem linken Terrorismus in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Plot
- Historischer Hintergrund
- Ästhetik des Politischen im Film
- Die Problematik des realen Vorbildes
- Filmästhetische Mittel zur Vermittlung politischer Botschaften und gesellschaftlicher Stimmungen
- Was der Film nicht zeigt
- Was sichtbar wird
- Staatliche Institutionen
- Dokumentarfilmmaterial
- Die Einseitigkeit der Sicht
- Religiöse Überhöhung
- Geschlechterrollen
- Männerrollen
- Ist Die bleierne Zeit ein „Frauenfilm“?
- Die RAF im deutschen Kinofilm
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Film „Die bleierne Zeit“ von Margarethe von Trotta und analysiert, wie das Politische im Film sichtbar wird. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung von Personen, die im Kontext des linken Terrorismus in Deutschland in den 1970er Jahren agierten. Die Arbeit untersucht die filmischen Mittel, die Trotta einsetzt, um die politischen Botschaften und gesellschaftlichen Stimmungen des Films zu vermitteln.
- Die Beziehung zwischen persönlicher Erfahrung und politischer Geschichte
- Die Darstellung des linken Terrorismus und die Frage der Schuld
- Die Ästhetik des Politischen im Film
- Die Rolle der Geschlechter und die Frauenbilder in der RAF-Szene
- Die Kritik am deutschen Staat und seiner Reaktion auf die RAF
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Neuen Deutschen Films und seine Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Themen dar. Es wird auf die Doppelbödigkeit der Filme hingewiesen, die den Zuschauer zum Nachdenken anregen soll.
- Plot: Die Zusammenfassung des Films beschreibt die Geschichte der beiden Schwestern Juliane und Marianne und ihren unterschiedlichen Wegen im Umgang mit politischer Rebellion. Der Film verdeutlicht den Konflikt zwischen friedlichem Protest und Terrorismus.
- Historischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Films und die Entstehungsbedingungen der Roten Armee Fraktion (RAF). Es erläutert die ideologische Grundlage der RAF und ihre Ziele.
- Ästhetik des Politischen im Film: Die Analyse der filmischen Mittel zeigt, wie Trotta die politischen Botschaften des Films transportiert. Der Film präsentiert verschiedene Perspektiven auf den linken Terrorismus und die Rolle des Staates.
Schlüsselwörter
Die bleierne Zeit, Margarethe von Trotta, Neuer Deutscher Film, linker Terrorismus, RAF, Politik, Ästhetik, Geschlechterrollen, Frauenbilder, Staat, Gesellschaft, deutsche Geschichte.
- Quote paper
- M.A. Cordula Gries (Author), 2006, Ästhetik des Politischen im Film "Die bleierne Zeit" von Margarethe von Trotta, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88622