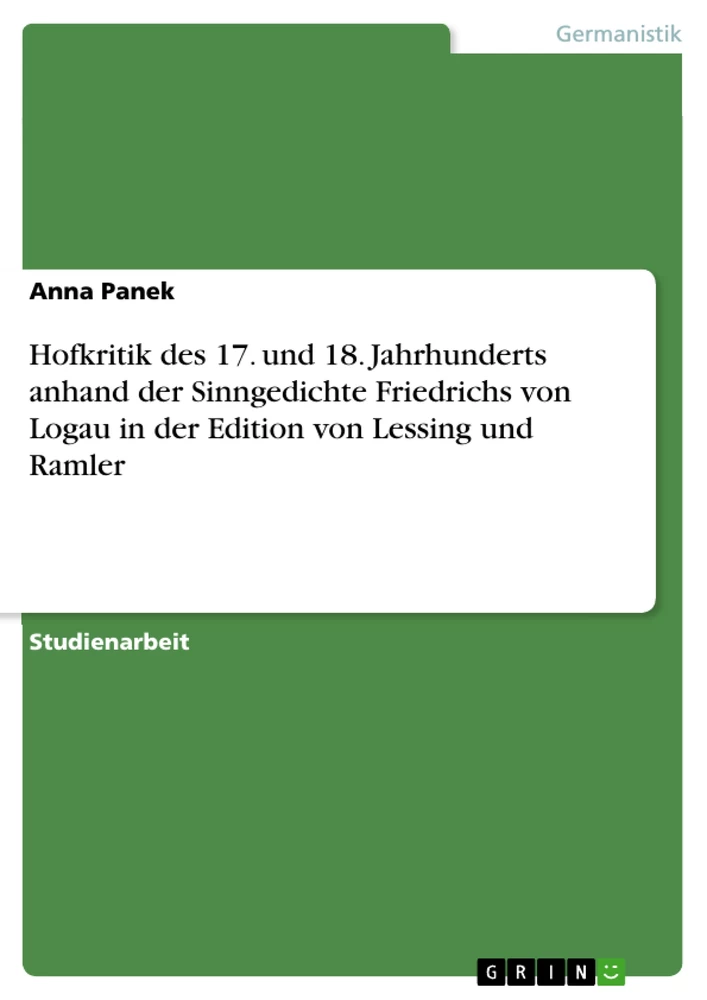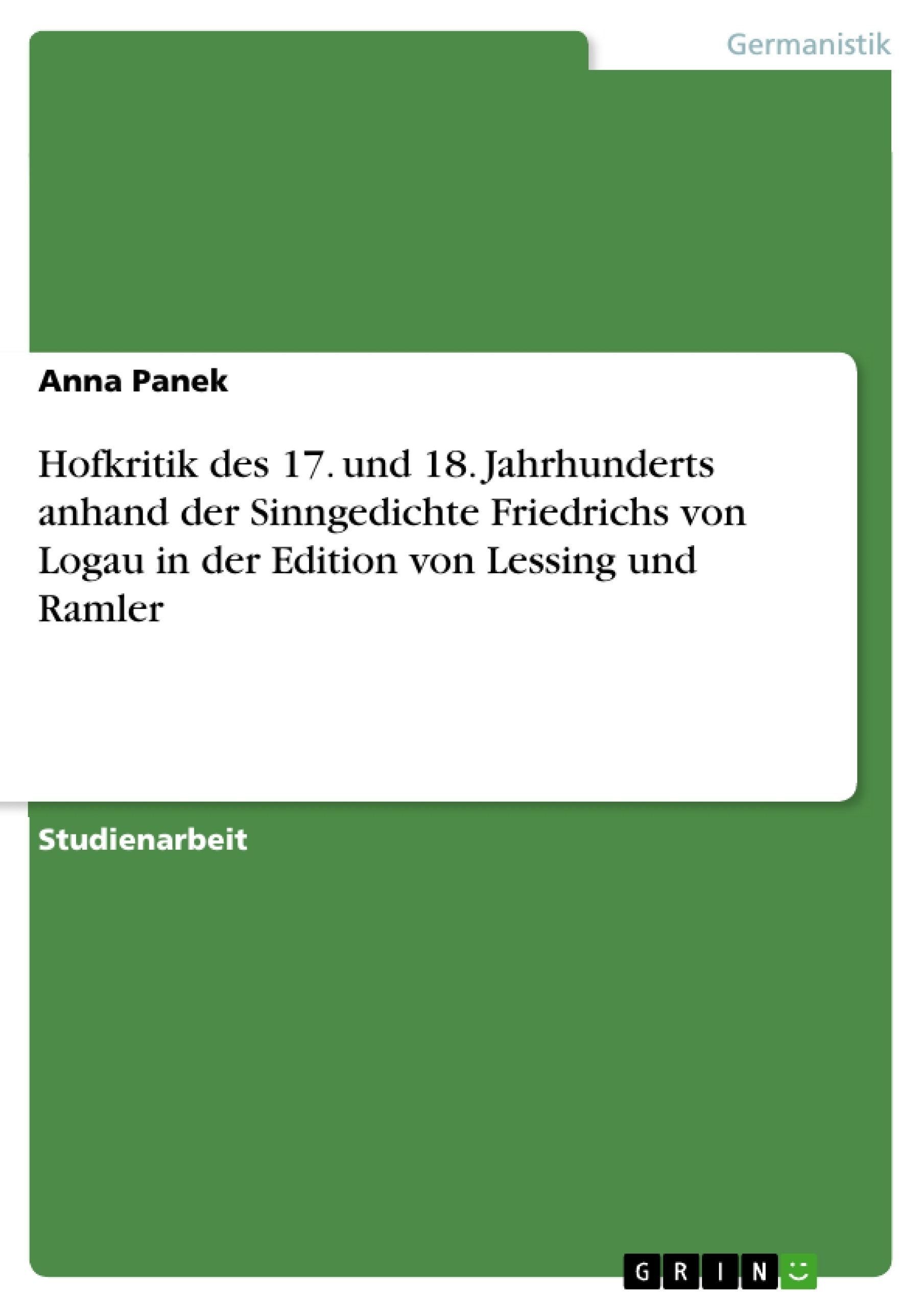Literaturgeschichtlich lassen sich die Anfänge einer moralphilosophisch argumentierenden Kritik am höfischen Gesellschaftleben zeitgleich zur Entstehung eben jener Literatur verorten, die im Sinne eines auf Repräsentation und Untermauerung des eigenen Machtanspruchs ausgelegten, parallel zu religiösem Weltbild - und dem diesen stützenden christlichen Diskurs in lateinischer Sprache - verlaufenden Nebendiskurses mit eigenen ethischen Maßstäben, Tugendhierarchien sowie eigenen Leitbildern bzw. Idealfiguren entstand: auf antike Vorlagen und biblische Quellen zurückgreifend, entstehen im mittelalterlichen Fürstenspiegel antihöfische Argumentationstraditionen, deren kanonische Grundmuster bereits aus einem gewachsenen Bestand an Gemeinplätzen gegen die höfische Lebensform schöpfen können. Ziel der Kritik sind im 12. und 13. Jh. die Höflinge, denen Untugenden wie Ehrgeiz, Schmeichelei und Heuchelei angekreidet werden - eine Traditionslinie, deren Verlauf sich durch die Kanonisierung bis in die absolutistische Zeit nachzeichnen läßt.
In dieser Arbeit werden, exemplarisch anhand der hofkritischen Epigramme Logaus, die von Lessing und Ramler in eine von ihnen editierte, 1759 erschienene Ausgabe der Sinngedichte aufgenommenen wurden, Spuren moralphilosophischer Traditionslinien in der Argumentation nachgezeichnet sowie überprüft, ob das Gewicht ökonomisch begründeter Kritik im in der ersten Hälfte des 17. Jh - somit vor der von Kiesel benannten Paradigmenverschiebung - entstandenen Werk Logaus sich gegenüber ethisch-moralischer Distanzierung als innerhalb der 1759 vorgenommenen Auswahl unterrepräsentiert bezeichnen läßt, wobei die derzeit vorherrschende Einschätzung des überwiegend sprachlich-literarischen, nicht topisch-thematisch orientierten Interesses an Logau bei der Auswahl der Gedichte hinterfragt werden soll. Da dies den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, unternimmt sie nicht den Versuch eines detaillierten Vergleichs zwischen Logaus im 17. Jahrhundert erschienenen hofkritischen Epigrammen als Gesamtausgabe mit der 1759 vorgenommenen Auswahl oder der Untersuchung einer damit einhergehenden möglichen Fokusverschiebung, sondern setzt rezipientenorientiert mit der Betrachtung der Lessingedition als dem der lesenden Öffentlichkeit gebotenem Bild direkt am Akt der Hinüberrettung der deutschsprachigen Hofkritik vom 17. in das 18. Jh. an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Logau als Hofkritiker?
- Die Edition von Lessing und Ramler: Lessings Beitrag
- Logaus hofkritische Epigramme in der Edition von Lessing/Ramler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die hofkritischen Epigramme Friedrich von Logaus, die von Lessing und Ramler in ihre 1759 erschienene Ausgabe der Sinngedichte aufgenommen wurden. Sie untersucht, ob sich in der Argumentation moralphilosophische Traditionslinien nachzeichnen lassen und ob ökonomisch begründete Kritik in Logaus Werk, das in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand, gegenüber ethisch-moralischer Distanzierung unterrepräsentiert ist. Darüber hinaus wird die vorherrschende Einschätzung des überwiegend sprachlich-literarischen Interesses an Logau bei der Auswahl der Gedichte hinterfragt.
- Die Rolle der moralphilosophischen Traditionslinien in der Hofkritik des 17. Jahrhunderts
- Die Gewichtung von ökonomischen Aspekten in der Kritik am Hofleben
- Lessings und Ramlers Einfluss auf die Auswahl und Präsentation der hofkritischen Epigramme
- Die Bedeutung der Lessing/Ramlerschen Edition für die Weitertradierung der deutschsprachigen Hofkritik
- Die Unterscheidung zwischen Höflingssatire und expliziter Hofkritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Hofkritik von ihren Anfängen im Mittelalter bis zur verstärkten Betonung ökonomischer Grundsätze im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert. Sie stellt die Bedeutung des Begriffs 'Hofkritik' als literaturwissenschaftliches Paradigma dar und führt den Leser in die Thematik und Zielsetzung der Arbeit ein.
Kapitel 1 untersucht Logaus Position als Hofkritiker. Es analysiert die Topoi seiner Sinngedichte, die sowohl Kritik am Hof als auch an der bürgerlichen Gesellschaft sowie Panegyrik beinhalten. Die Frage, ob Logau als dezidiert hofkritischer Epigrammatiker bezeichnet werden kann, wird anhand seiner Publikationsentscheidungen und der unterschiedlichen Interpretationen seiner Werke von verschiedenen Forschern beleuchtet.
Kapitel 2 konzentriert sich auf die Edition von Lessing und Ramler und Lessings Beitrag zur Auswahl der Gedichte. Es wird Lessings persönliche Haltung gegenüber dem Hof und seinem Zwängen aufgezeigt, sowie die von ihm im Vorwort zur Edition vorgebrachten Begründungen für die Aufnahme der Sinngedichte Logaus untersucht. Die Frage, ob Lessings Interesse an Logau tatsächlich nur literarisch-philologischer Natur war, wird anhand seiner Briefe und seiner Rezensionen anderer Autoren beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert Logaus hofkritische Epigramme in der Edition von Lessing/Ramler. Es werden verschiedene Topoi, wie z.B. der kritisierte Höfling und die höfischen Untugenden, anhand von Beispielen aus den Sinngedichten verdeutlicht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Unterscheidung zwischen Höflingssatire und expliziter Hofkritik gelegt. Des Weiteren wird die Frage nach der Gewichtung von moralischen und ökonomischen Argumentationslinien in der Auswahl der Gedichte untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Hofkritik, Sinngedichte, Friedrich von Logau, Gotthold Ephraim Lessing, Carl Wilhelm Ramler, moralistische und ökonomische Argumentation, Topoi, Epigrammatik, Herrscherlob, Höflingssatire, Edition und Rezeption.
- Quote paper
- Anna Panek (Author), 2008, Hofkritik des 17. und 18. Jahrhunderts anhand der Sinngedichte Friedrichs von Logau in der Edition von Lessing und Ramler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88617