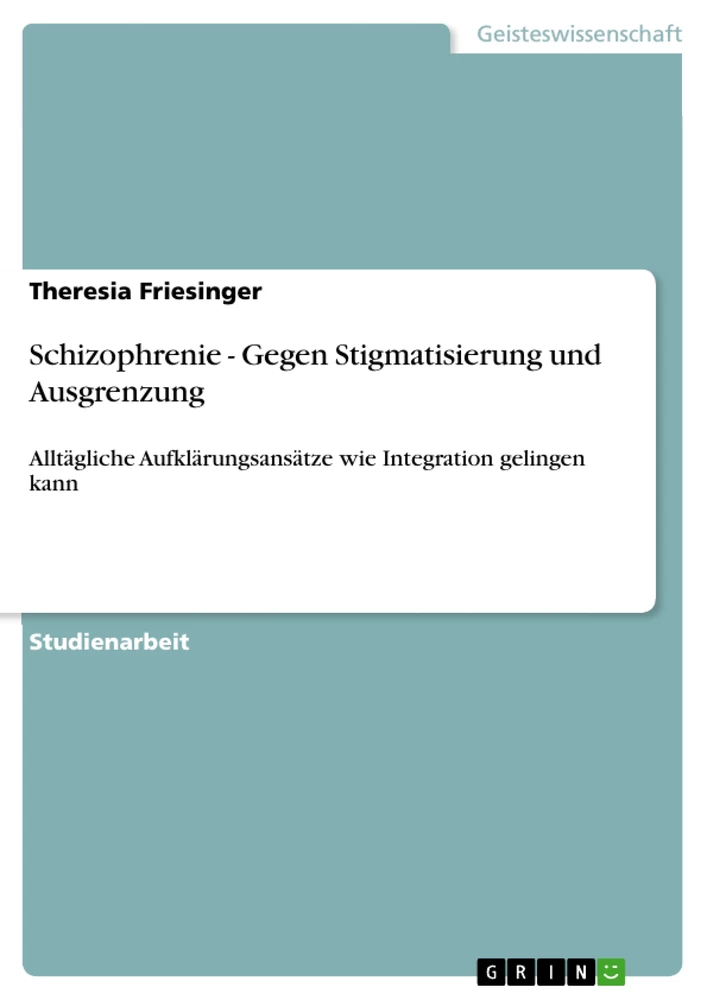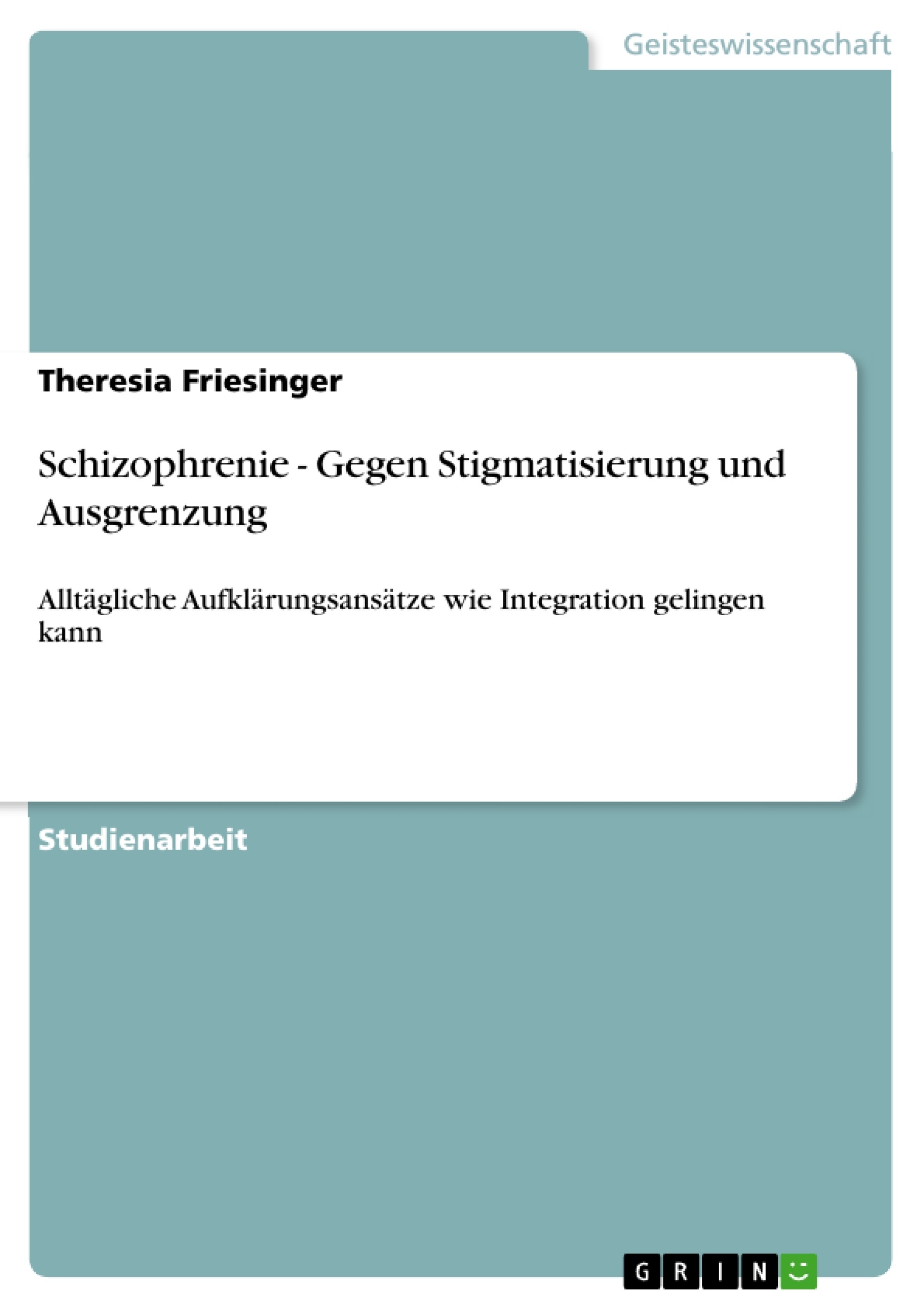Trotz vielfacher Anti-Stigmatisierungs-Kampagnen in Form von Internetauftritten der Betroffenen- und Angehörigen-Vereine und der Einführung des jährlichen Förderpreises für Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, der von der „Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde“ (DGPPN) in Kooperation mit dem Verein „Open the doors e.V.“ und der „Sanofi-Aventis Deutschland GmbH“ mit
6000,- € dotiert wird, ist die gesellschaftliche Akzeptanz und das Verständnis gegenüber psychisch erkrankten Menschen* immer noch mehr als unzureichend.
Mangelnde Information und verzerrte Berichte in den Medien führen bei den Betroffenen zu einem verstärkten Schamgefühl, zu Resignation und sozialem Rückzug. Nicht zuletzt werden doch psychisch Kranke in der Öffentlichkeit oftmals als verwirrte Kreaturen (Psychopaten) dargestellt, die Böses und Gewalttätiges im Sinn haben.
Nach meiner Themenbegründung werde ich zunächst auf die Frage „Was heißt normal? eingehen und Normalität in Relation zu Andersartigkeit setzen. Wie könnte der Umgang mit Andersartigkeit aussehen? Ist die gesellschaftlich gesetzte Norm Menschen mit psychischen Leiden als abnormal gelten zu lassen die einzig wahre Lösung? Im Folgenden werde ich auf die Klärung und Abgrenzung der Begriffe Psychose und Schizophrenie eingehen, um diesbezüglich Unklarheiten zu beseitigen. [...] Die Hausarbeit werde ich beispielhaft mit der authentischen Krankheitsgeschichte von Dorina B. sporadisch und anschaulich untermauern und anhand ihrer Krankheitsbiografie die Bedeutung der Angehörigenarbeit aufzeigen. Da die humanistische Psychiatrie viel zur Enthospitalisierung und zu mehr Integration beigetragen hat, möchte ich im Anschluss auf einige positive wie auch kritische Aspekte eingehen. Hat die Ambivalenz der Psychiatrie noch ihre Berechtigung? Lässt sie immer noch genügend Raum für Stigma?
Alltägliche Aufklärungsansätze, die so konzipiert sind, dass möglichst viele Menschen erreicht werden können, sind ein weiterer Schwerpunkt meiner Hausarbeit. Die Ansätze sollen auch Nicht-Interessierte ansprechen und betroffen machen. Müssen Konzepte hinterfragt, oder sogar, um Stigma zu verhindern, ganz aufgegeben werden? Was bewirken Antistigma-Kampagnen und wie können sie gelingen? Was unternimmt Soziale Arbeit, um den Stigmatisierungsprozess aufzuhalten und was kann sie optimierend dazu beitragen?
All diese Fragen und darüber hinaus, sind meiner Meinung nach, wichtige stigmareduzierende Themen, die nicht fehlen dürfen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Begründung meines Themas
- Was heißt normal?
- DIE SCHIZOPHRENE PSYCHOSE – EINE ERKRANKUNG MIT VIELEN GESICHTERN
- Abgrenzung zwischen Psychose und Schizophrenie
- Krankheitsbild und Verlauf
- Das Prodromalstadium
- Plus-Symptomatik und Minus-Symptomatik
- Auf der Suche nach den Ursachen
- Die akute Symptomatik, Medikation und ihre Nebenwirkungen
- Weiterer Verlauf der Krankheit und Prognose
- Die Bedeutung der Rezidivprophylaxe
- Die medikamentöse Rückfallschutzbehandlung
- Unterschied zwischen klassischen und atypischer Depotform
- Das „Image-Problem\" der Depotform
- DIE ANGEHÖRIGEN
- Die Leistung der Angehörigen anhand der Geschichte von Dorina B.
- Beginn der Krankheit
- Erster Rückfall
- Zweiter Rückfall
- Auswertung der Krankheitsgeschichte in bezug auf Angehörigenarbeit
- DIE AKZEPTIERENDE PSYCHIATRIE UND IHRE HÜRDEN
- Wo steht der Mensch in der Psychiatrie?
- Die Ambivalenz der Psychiatrie
- DEM STIGMA MIT EINFACHEN ANSÄTZEN BEGEGNEN
- „Schizophren“ und „verrückt“ - die schrecklichen Worte im Alltagsgebrauch
- Integrationsansätze
- Aufklärungen auf einfachster Basis über Medien, Print und Face-to-face
- Aufklärung über die Einbindung von Kultur in der Psychiatrie
- Aufklärung durch frühkindliche Integrationspädagogik
- Aufklärung über den Dialog mit den Betroffenen
- Konzeption von einem simplen, biopsychosozialem Erklärungsmodell
- Der Diagnose einen neuen Namen geben?
- Ablegen von Konzepten, die Stigmatisierung fördern
- Die Verantwortung der Gesellschaft im Umgang mit der Krankheit
- Was bewirken Antistigma-Kampagnen tatsächlich?
- Was unternimmt Soziale Arbeit gegen den Stigmatisierungsprozess?
- Appellierendes Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, das Stigma, das mit der Diagnose Schizophrenie verbunden ist, zu beleuchten und zu analysieren. Dabei werden die Ursachen für die Stigmatisierung sowie die Auswirkungen auf die Betroffenen und deren Angehörigen untersucht. Der Fokus liegt auf der Integration und der Förderung der Akzeptanz von Menschen mit Schizophrenie in der Gesellschaft.
- Stigmatisierung von Menschen mit Schizophrenie
- Integration von Menschen mit Schizophrenie
- Aufklärungsarbeit zur Reduzierung von Stigma
- Die Rolle der Angehörigen
- Die Rolle der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung befasst sich mit der Begründung des Themas und beleuchtet die aktuelle gesellschaftliche Situation im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Außerdem wird die Frage nach der Definition von Normalität und deren Relevanz im Kontext von Stigmatisierung diskutiert.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel stellt die Schizophrenie als Krankheit und deren verschiedene Erscheinungsformen vor. Es beinhaltet eine detaillierte Beschreibung des Krankheitsbildes, des Verlaufs der Erkrankung und der medikamentösen Behandlung. Die Bedeutung der Rezidivprophylaxe wird ebenfalls erörtert.
- Kapitel 3: Im dritten Kapitel wird die Rolle der Angehörigen von Menschen mit Schizophrenie anhand der Geschichte von Dorina B. beleuchtet. Die Bedeutung der Angehörigenarbeit für die Bewältigung der Erkrankung wird hervorgehoben.
- Kapitel 4: Das vierte Kapitel widmet sich dem Thema der humanistischen Psychiatrie und ihrer Rolle bei der Integration von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Ambivalenz der Psychiatrie im Umgang mit Stigma wird beleuchtet.
- Kapitel 5: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf alltäglichen Aufklärungsansätzen zur Reduzierung von Stigmatisierung. Es werden verschiedene Integrationsansätze und Maßnahmen vorgestellt, die dazu beitragen sollen, dass Menschen mit Schizophrenie nicht länger ausgegrenzt werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe, die in der Arbeit behandelt werden, sind Schizophrenie, Stigmatisierung, Integration, soziale Arbeit, Angehörigenarbeit, humanistische Psychiatrie, Aufklärung und Alltagsansätze. Weitere wichtige Themenfelder umfassen die medikamentöse Behandlung, die Rezidivprophylaxe und die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Menschen mit psychischen Erkrankungen.
- Quote paper
- Theresia Friesinger (Author), 2005, Schizophrenie - Gegen Stigmatisierung und Ausgrenzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88473