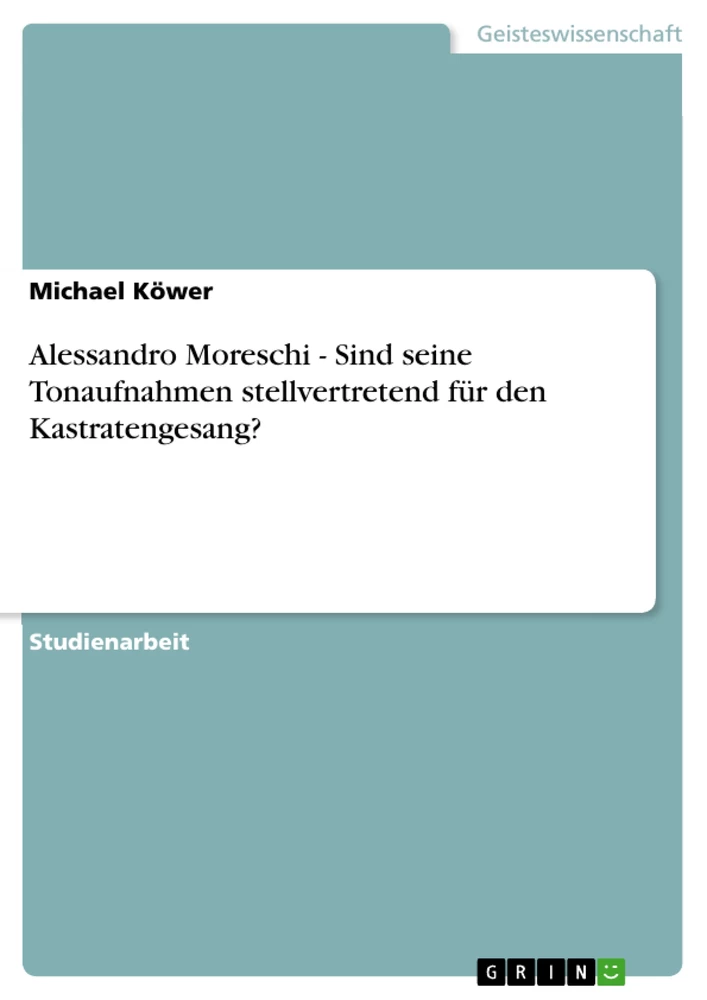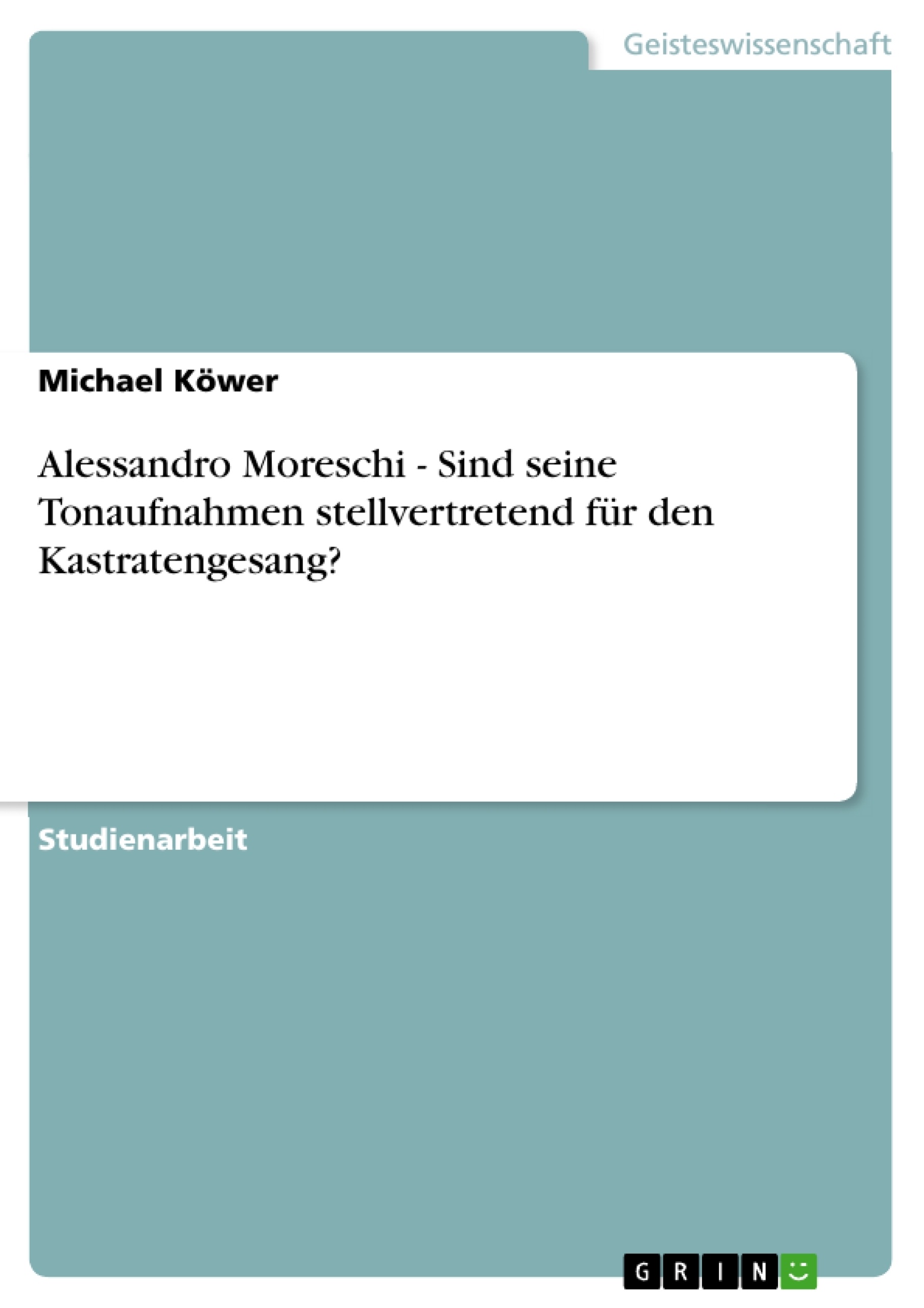„Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es sagt.“
Ein einziger Satz aus Korinther 14,34 war ab dem beginnenden 17. Jahrhundert und bis vor etwas über 100 Jahren verantwortlich für die illegale Verstümmelung von vie-len tausenden (vornehmlich italienischen) Knaben – den Kastraten. Denn in diesem einen Satz des Neuen Testaments, oder besser, in seiner falsch verkürzten Fassung „mulier taceat in ecclesia“ sahen die Päpste die Rechtfertigung, dass keine Frau im Vatikan Chordienst leisten dürfe. Aber nicht nur dort, sondern auch in allen unter päpstlicher Herrschaft stehenden Ländern war es Frauen untersagt, als Chor- und ab 1588 sogar als Opernsängerin zu arbeiten. Doch wie war es möglich, große sakrale Chorwerke aufzuführen, ohne auf Sopran- und Altstimmen zu verzichten? Es gab die so genannten Falsettisten, die, wie der Name schon sagt, im Falsett sangen. Meist kamen sie aus Spanien, und ihre Gesangstechnik galt als ein gut gehütetes Geheim-nis, was im Gegenzug hohe Gagenforderungen bedeutete. Nachteilig erwies sich, dass der nicht besonders große Tonumfang ihrer Gesangsstimme manchmal in der Höhe nur bis zum c’’ oder d’’ reichte. Eine weitere erlaubte Möglichkeit waren die Knabensänger, die aber, sobald sie durch mehrjährige Schulung das ausreichende musikalische Bewusstsein und Können erlangt hatten, in den Stimmbruch kamen und ihre hohen Stimmen für immer verloren. Dem konnte jedoch durch eine simple Operation Abhilfe geschafft werden:
Man durchtrennte vor Einbruch der Pubertät und dem Einsetzen des Stimmbruchs die Samenleiter des Knaben, verhinderte dadurch eine pubertäre hormonelle Verän-derung des Körpers, und somit auch, dass sich die Knabenstimmbänder in die eines Mannes verwandelten. Ein fataler Eingriff für den Großteil der meist aus armen Ver-hältnissen stammenden und oft einfach nur auf Verdacht und ohne vorherige Eig-nungsprüfung aus reiner Geldnot Kastrierten. Für einige wenige Talentierte gab es Hoffnung: das Leben als Opernsänger, das Be-rühmtheit und Reichtum versprach, oder das Singen in einem katholischen Kirchen-chor, das das grundlegende Überleben sicherte. Zu den bedeutendsten Kirchenchö-ren zählte der der Sixtinischen Kapelle – der Privatchor des Papstes. In ihm waren zu den Bestzeiten bis zu 16 Kastraten beschäftigt .
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Aufnahme
- 2.1 Technische Mängel
- 2.2 Aufregung
- 2.3 Stimmalter
- 3. Die Stimme
- 3.1 Klangerzeugung mit der menschlichen Stimme und Spezifika der Kastratenstimme
- 3.2 Formale Aspekte zu Moreschis Stimme
- 3.3 Künstlerische Aspekte
- 4. Fazit
- 5. Quellen
- 5.1 Primärquellen
- 5.2 Sekundärquellen
- 5.2.1 Bücher
- 5.2.2 Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Tonaufnahmen von Alessandro Moreschi, dem letzten bekannten Kastraten, und deren Aussagekraft als repräsentative Beispiele für den Kastratengesang. Die Analyse konzentriert sich auf die technischen, stimmlichen und künstlerischen Aspekte seiner Aufnahmen im Kontext der Geschichte und der spezifischen Gesangstechnik der Kastraten.
- Die Geschichte der Kastration und ihre gesellschaftlichen Hintergründe
- Die technischen Aspekte der Tonaufnahmen Moreschis und ihre Limitationen
- Eine Analyse der stimmlichen Eigenschaften und des Klangcharakters von Moreschis Gesang
- Die künstlerische Einordnung Moreschis im Kontext der Kastraten-Gesangsgeschichte
- Die Bewertung der Aussagekraft von Moreschis Aufnahmen als repräsentative Beispiele für Kastratengesang
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext der Kastration von Knaben für den Gesang, basierend auf dem missinterpretierten Bibelzitat aus Korinther 14,34. Sie beschreibt die Praxis der Kastration, ihre Illegalität und die Beweggründe, sowohl aus religiösen als auch aus musikalischen Gründen. Die Einleitung etabliert die zentrale Frage der Arbeit: Sind Moreschis Aufnahmen repräsentativ für den Kastratengesang? Sie skizziert die Schwierigkeiten bei der Quellenrecherche, hervorgerufen durch die Geheimhaltung und die geringe Anzahl an überlieferten Aufzeichnungen.
2. Die Aufnahme: Dieses Kapitel analysiert die vorhandenen Tonaufnahmen von Alessandro Moreschi. Es untersucht detailliert die technischen Mängel der Aufnahmen, die durch die damalige Technik bedingt waren und die Interpretation erschweren. Des Weiteren wird die Aufregung während der Aufnahmen und ihr möglicher Einfluss auf die vokale Leistung diskutiert. Schließlich wird das Stimmalter Moreschis zum Zeitpunkt der Aufnahmen betrachtet und die damit verbundenen Fragen der stimmlichen Entwicklung und Veränderung im Laufe der Zeit beleuchtet. Diese Analyse bildet die Grundlage für die spätere Beurteilung der Repräsentativität der Aufnahmen.
3. Die Stimme: Dieses Kapitel widmet sich einer eingehenden Analyse von Moreschis Stimme. Es beginnt mit einer Erklärung der Klangerzeugung bei der menschlichen Stimme und den Besonderheiten der Kastratenstimme. Es werden die formalen Aspekte, wie Tonumfang, Klangfarbe und Artikulation, analysiert und im Detail beschrieben. Schließlich werden die künstlerischen Aspekte, wie Stil, Ausdruck und Interpretationsweise, erörtert. Die Kombination aus technischen, formalen und künstlerischen Aspekten soll zu einem umfassenden Bild von Moreschis Gesang führen und seine Einzigartigkeit und den Stellenwert im Kontext der Kastratengesangstradition beleuchten.
Schlüsselwörter
Alessandro Moreschi, Kastratengesang, Tonaufnahmen, Gesangstechnik, Sixtinische Kapelle, Kirchengeschichte, Musikgeschichte, historische Quellen, Stimmuntersuchung, musikalische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Tonaufnahmen von Alessandro Moreschi
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Tonaufnahmen des letzten bekannten Kastraten Alessandro Moreschi. Ziel ist es, die Aussagekraft dieser Aufnahmen als repräsentative Beispiele für den Kastratengesang zu untersuchen.
Welche Aspekte werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse konzentriert sich auf technische, stimmliche und künstlerische Aspekte der Aufnahmen. Berücksichtigt werden die technischen Mängel der Aufnahmen, die Stimmqualität Moreschis (Klangfarbe, Tonumfang, Artikulation), sein Gesangsstil und seine Interpretationsweise im Kontext der Kastratengesangstradition.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse der Aufnahmen (technische Mängel, Aufregung, Stimmalter), ein Kapitel zur Analyse der Stimme Moreschis (Klangerzeugung, formale und künstlerische Aspekte), ein Fazit und ein Kapitel zu den verwendeten Quellen (Primär- und Sekundärquellen).
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Sind Moreschis Aufnahmen repräsentativ für den Kastratengesang? Zusätzliche Fragestellungen betreffen die technischen Limitationen der Aufnahmen, die spezifischen stimmlichen Eigenschaften des Kastratengesangs und die Einordnung Moreschis in die Geschichte des Kastratengesangs.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Primärquellen (die Aufnahmen Moreschis selbst) und Sekundärquellen, darunter Bücher und Internetquellen. Die Suche nach Quellen wurde durch die Geheimhaltung und die geringe Anzahl überlieferter Aufzeichnungen erschwert.
Wie wird die Stimme Moreschis beschrieben?
Die Analyse der Stimme Moreschis umfasst die Klangerzeugung im Kontext der Kastratenstimme, die formalen Aspekte wie Tonumfang und Klangfarbe sowie die künstlerischen Aspekte wie Stil und Ausdruck. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild seines Gesangs zu liefern.
Welche Rolle spielt der historische Kontext?
Der historische Kontext der Kastration von Knaben für den Gesang spielt eine wichtige Rolle. Die Einleitung beleuchtet die Praxis der Kastration, ihre Illegalität und die Beweggründe (religiöse und musikalische Gründe). Dieser Kontext ist essentiell für das Verständnis der Aufnahmen und ihrer Bedeutung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alessandro Moreschi, Kastratengesang, Tonaufnahmen, Gesangstechnik, Sixtinische Kapelle, Kirchengeschichte, Musikgeschichte, historische Quellen, Stimmuntersuchung, musikalische Analyse.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im gegebenen Text zusammengefasst, sondern muss aus den Kapitelzusammenfassungen erschlossen werden. Es wird die Aussagekraft der Aufnahmen als repräsentative Beispiele für Kastratengesang bewerten.)
- Citar trabajo
- Michael Köwer (Autor), 2007, Alessandro Moreschi - Sind seine Tonaufnahmen stellvertretend für den Kastratengesang?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88454