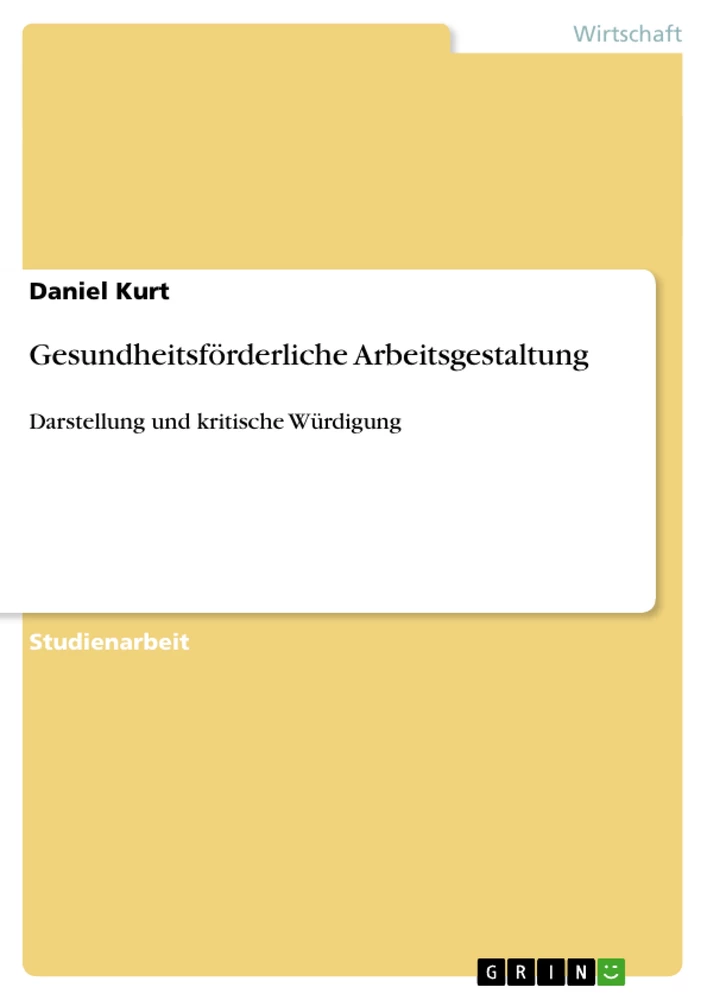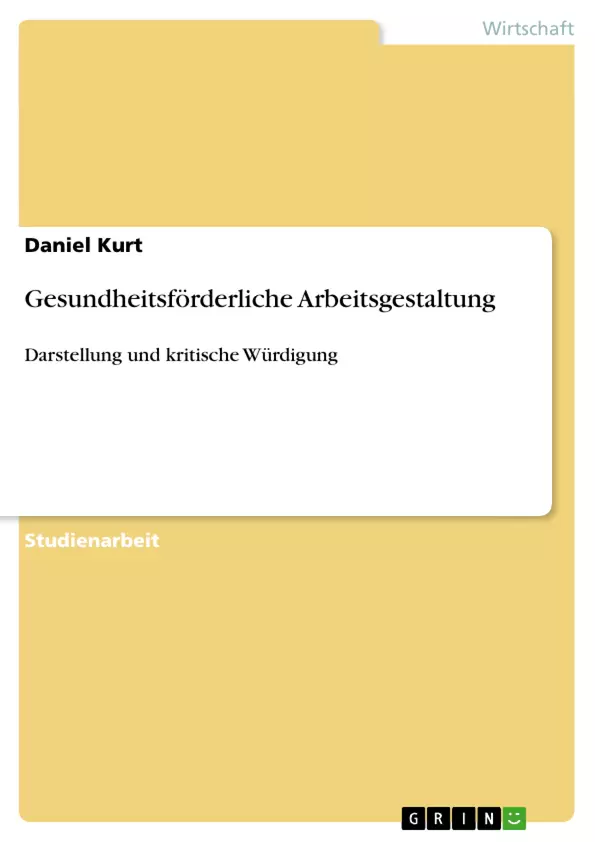1 Einleitung
Der strukturelle Wandel der Arbeitswelt wird geprägt von einer Intensivierung der Tätigkeiten. Das bedeutet, immer weniger Beschäftigte müssen immer mehr in immer kürzerer Zeit leisten. Die Anforderungen an die Qualität der Produkte steigt und immer öfter wird die Verantwortung für Arbeitsergebnisse nicht mehr von den Vorgesetzten allein ... getragen, (vgl. Ducki, 2000). Viele Arbeitsplätze verändern sich inhaltlich (z.b. Architekten müssen Umweltschutzaspekte berücksichtigen) oder strukturell (z.b. werden flexible Arbeitszeiten vereinbart).
Andererseits begünstigt der Wandel aber auch die Bildung von gesundheitlichen Risiken. Unternehmen versuchen einerseits die Leistung ihrer Beschäftigten durch immer mehr finanzielle Anreize zu erhöhen, andererseits sollen diese auch mehr Verantwortung für die Qualität der Produkte übernehmen bei gleichzeitigem Zeitdruck und erhöhtem Abstimmungsbedarf über den eigene Arbeitsplatz hinaus und fehlenden Informationen. Dies führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die sich u.a. in Fehlzeiten durch Krankheiten, Burnout, Aggressivität gegenüber Kollegen oder nachlassender Produktivität äußern. Es entsteht der Eindruck, dass Arbeit wieder stärker partialisiert wird und allgemein anerkanntes Wissen, z.b. über intrinsische Motivation und Gruppenarbeit, durch 'Shareholder-Value-Orientierung', 'Downsizing' oder 'Outsourcing' vergessen wird.
Mittlerweile werden Unternehmen zunehmend sensibilisiert im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Führungskräfte sehen ihre gesellschaftliche Verantwortung u.a. im Erhalt der Leistungsfähigkeit ... und der Fürsorge für Mitarbeiter und deren Familien (vgl. Pundt et. al., 2007). Der betrieblichen Gesundheitsförderung kommt vor diesem Hintergrund die Aufgabe zu, gesundheitliche Risiken und Potentiale zur Persönlichkeitsentwicklung aufzudecken und die Arbeit so zu organisieren, daß diese Risiken vermieden werden und das Potential tatsächlich ausgeschöpft werden kann.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher aus arbeitspsychologischer Sicht mit den folgenden Fragen:
1. Was bedeutet Gesundheitsförderung, wie wird Gesundheit definiert und in welchem Zusammenhang
stehen Präventionsmaßnahmen und Gesundheit? (Kapitel 2)
2. Welches sind gesundheitsförderliche und -schädliche Arbeitsbedingungen und wie können diese Bedingungen wissenschaftstheoretisch begründet werden? (Kapitel 3)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Bestimmungen
- Einordnung der Begriffe Gesundheit und Prävention
- Arbeitsschutz und Betriebliche Gesundheitsförderung
- Theoretische Grundlagen und Methodik
- Das Konzept 'Psychische Anforderungen/Belastungen'
- Stress als psychische Belastung
- Arbeitsanalyse, -bewertung und -gestaltung
- Analyseinstrumente
- Wie beeinflussen Arbeitsbedingungen die Gesundheit?
- Instrumente der Verhaltens- und der Verhältnisprävention
- Instrumente der Verhältnisprävention
- Instrumente der Verhaltensprävention
- Betriebliche Gesundheitsprogramme
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich aus arbeitspsychologischer Sicht mit den Auswirkungen von Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit der Beschäftigten und dem Einsatz der Betrieblichen Gesundheitsförderung zur Optimierung der Arbeitsgestaltung. Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen gesundheitsförderlichen und -schädlichen Arbeitsbedingungen und deren Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit der Beschäftigten.
- Definition von Gesundheit und Prävention
- Die Rolle von Arbeitsschutz und Betrieblicher Gesundheitsförderung
- Theoretische Modelle zur Erklärung des Zusammenhangs von Arbeit und Gesundheit
- Analyse und Bewertung von Arbeitsbedingungen
- Praktische Gestaltungsempfehlungen für eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Intensivierung der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten dar. Sie führt in das Thema der Betrieblichen Gesundheitsförderung ein und formuliert die Forschungsfragen der Arbeit.
Begriffliche Bestimmungen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Gesundheit und Prävention und beleuchtet unterschiedliche Konzepte der Gesundheit. Außerdem werden die Bereiche Arbeitsschutz und Betriebliche Gesundheitsförderung einander gegenübergestellt.
Theoretische Grundlagen und Methodik: Dieses Kapitel stellt das Konzept der 'Psychischen Anforderungen/Belastungen' vor und erklärt Stress als eine bedeutende psychische Belastung.
Arbeitsanalyse, -bewertung und -gestaltung: Das vierte Kapitel befasst sich mit der Analyse und Bewertung von Arbeitsbedingungen und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit. Es werden Analyseinstrumente vorgestellt, die zur Bewertung von Arbeitsbedingungen verwendet werden können.
Instrumente der Verhaltens- und der Verhältnisprävention: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Instrumente der Verhaltens- und der Verhältnisprävention und beleuchtet die praktische Anwendung dieser Instrumente im Kontext der Betrieblichen Gesundheitsförderung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themengebiete der Betrieblichen Gesundheitsförderung, Arbeitspsychologie, Arbeitsgestaltung, Gesundheitsrisiken, Stress, Prävention, Analyseinstrumente, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Weitere wichtige Begriffe sind Gesundheit, Wohlbefinden, Arbeitsbedingungen und psychische Belastung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter gesundheitsförderlicher Arbeitsgestaltung?
Es ist die Organisation der Arbeit mit dem Ziel, gesundheitliche Risiken (wie Stress oder Burnout) zu vermeiden und Potenziale zur Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter auszuschöpfen.
Wie wirkt sich die Intensivierung der Arbeitswelt auf die Gesundheit aus?
Hoher Zeitdruck, ständiger Abstimmungsbedarf und steigende Verantwortung bei gleichzeitigem Personalabbau führen oft zu Fehlzeiten, Aggressivität und nachlassender Produktivität.
Was ist der Unterschied zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention?
Verhaltensprävention setzt beim Individuum an (z.B. Rückenschule), während Verhältnisprävention die Arbeitsbedingungen und Strukturen (z.B. ergonomische Arbeitsplätze, Arbeitszeiten) optimiert.
Welche Rolle spielt Stress als psychische Belastung?
Stress wird als Reaktion auf ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten gesehen und gilt als einer der Hauptfaktoren für arbeitsbedingte Erkrankungen.
Warum ist eine Arbeitsanalyse wichtig?
Mithilfe von Analyseinstrumenten können Unternehmen systematisch aufdecken, welche Bedingungen krank machen und wo gezielte Verbesserungen im Arbeitsschutz nötig sind.
Was bedeutet „Shareholder-Value-Orientierung“ für den Arbeitsschutz?
Oft führt ein einseitiger Fokus auf Finanzkennzahlen zu Downsizing oder Outsourcing, wodurch bewährtes Wissen über gesundheitsförderliche Gruppenarbeit oder Motivation verloren gehen kann.
- Quote paper
- Daniel Kurt (Author), 2007, Gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88406