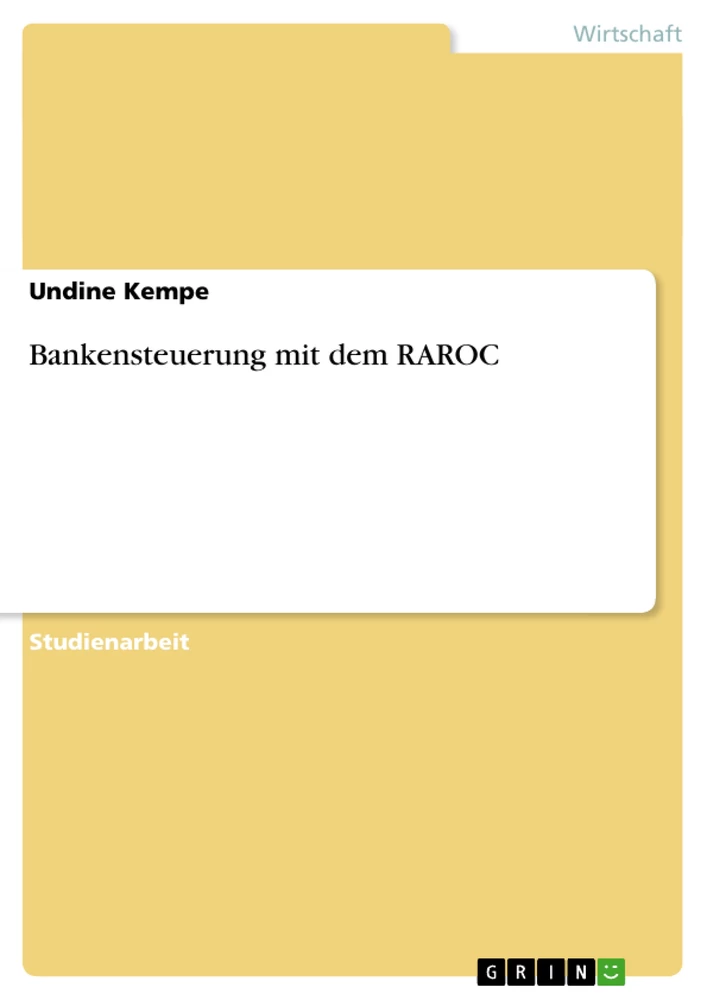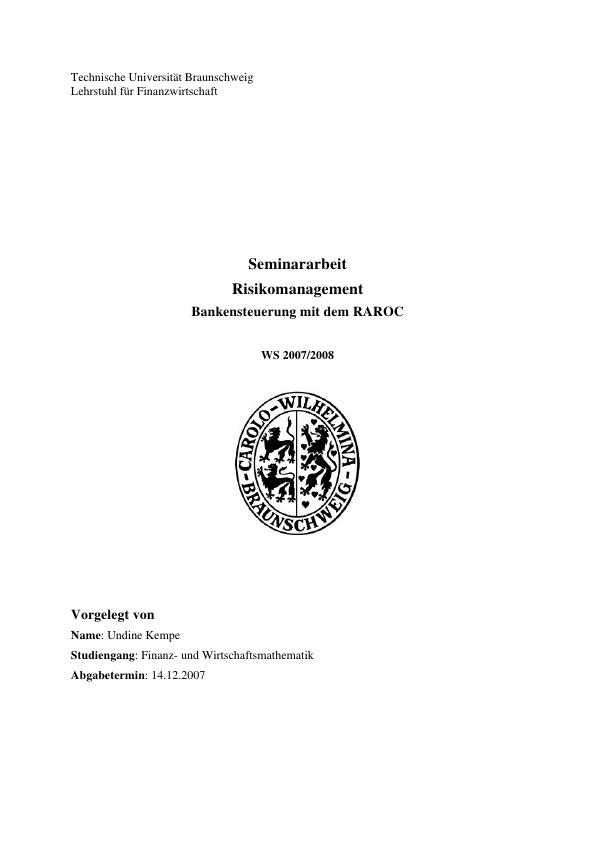Banken sind heutzutage an einer wert- und risikoorientierten Unternehmensführung ausgerichtet. Da die Aktivitäten einer Bank mit Marktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken verbunden sind und diese aufgrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen und gesetzlicher Vorschriften eine wichtige Rolle spielen, sind Entscheidungsträger von Banken meist mit einer Relation zwischen Risiko und Rendite konfrontiert. Die Grundlage der Rendite- und Risikosteuerung ist die risikoadjustierte Performancemessung (RAPM), die am Ende der siebziger Jahre von dem amerikanischen Investmentbank Bankers Trust eingeführt wurde, um die risikoadjustierte Performance des Handelsgeschäfts der Bank zu messen. Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über ausgewählte risikoadjustierte Performancemaße in Banken zu erhalten und die Untersuchung wie RAPM von Banken genutzt werden um eine gezielte optimale Risikosteuerung durchzuführen.
Darauf aufbauend gliedert sich die vorliegende Arbeit in zwei Schwerpunkte. Nach einer kurzen Charakterisierung der bestehenden Risikoarten und der Bedeutung des Risikokapitals werden Methoden der Risikoaggregation erläutern, welche sich grob in bottom-up und top-down Ansätze einteilen lassen. Bottom-up Ansätze lassen detaillierte Analysen zu, bringen jedoch einen weitaus größeren Arbeitsaufwand mit sich, während top-down Ansätze von aggregierten Daten, nämlich Verlustverteilungen ausgehen, was letztlich in der Praxis häufiger Anwendung findet. Kapital 2 schließt mit einem Beispiel der Deutsche Bank AG zur Berechnung des ökonomischen Kapitals ab.
Der zweite Schwerpunkt der wissenschaftlichen Darstellung wird von Kapital 3 gebildet und beginnt mit einer kurzen Einführung allgemeiner RAPM-Kennzahlen. Ferner werden die ausgewählten Beispiele Return-on-Risk-Adjusted-Capital (RORAC) und Risk-Adjusted-Return-on-Capital (RAROC) näher beleuchtet. Gefolgt von einem Berechnungsbeispiel der Kennzahlen, wird auf die Verwendung des Kennzahlensystems eingegangen bzw. darauf, wie mithilfe von RAPM eine Bank gesteuert werden kann und welche Probleme dabei auftreten können. Zuletzt ist eine Zusammenfassung formuliert, welche die Betrachtung abrunden soll und Verbesserungsmöglichkeiten andeutet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Risiken einer Bank
- Risikoarten
- Bedeutung des ökonomischen Kapitals
- Verfahren zur Bestimmung des ökonomischen Kapitals
- Beispiel: Ökonomisches Kapital der Deutsche Bank AG
- Risikoadjustierte Performancemaße
- RAPM-Kennzahlen
- Return on Riskadjusted Capital (RORAC)
- Risk Adjusted Return on Risk Adjusted Capital (RARORAC)
- Beispiel zur Berechnung von RORAC, RAROC und EVA
- Verwendung von RAPM und damit einhergehende Probleme
- Verwendung risikoadjustierter Performancemessung
- Problematische Bestimmung der Hurdle Rate
- Problematische Anreizsysteme für Mitarbeiter
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Risikomanagement in Banken und analysiert die Anwendung von risikoadjustierten Performancemaßen (RAPM) zur Steuerung der Bankaktivitäten. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Risikoarten, die Bedeutung des ökonomischen Kapitals und die Verfahren zur Bestimmung desselben. Außerdem werden die RAPM-Kennzahlen RORAC und RAROC detailliert vorgestellt und anhand eines Beispiels erläutert. Die Arbeit untersucht auch die Verwendung von RAPM in der Praxis und die damit verbundenen Herausforderungen, wie die Bestimmung der Hurdle Rate und die Gestaltung von Anreizsystemen für Mitarbeiter.
- Risikoarten in Banken
- Bedeutung und Berechnung des ökonomischen Kapitals
- Risikoadjustierte Performancemessung (RAPM)
- Anwendung von RORAC und RAROC in der Bankensteuerung
- Herausforderungen bei der Verwendung von RAPM
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Risikomanagements in Banken ein und beleuchtet die Bedeutung einer wert- und risikoorientierten Unternehmensführung. Es werden die verschiedenen Risikoarten, mit denen Banken konfrontiert sind, dargestellt und die Rolle des Risikokapitals im Kontext der Rendite- und Risikosteuerung hervorgehoben.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die verschiedenen Risikoarten, die eine Bank beeinflussen. Es werden die Marktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken sowie strategische Risiken und Reputationsrisiken genauer erläutert. Des Weiteren werden Verfahren zur Bestimmung des ökonomischen Kapitals vorgestellt und anhand eines Beispiels der Deutsche Bank AG illustriert.
Kapitel 3 befasst sich mit risikoadjustierten Performancemaßen (RAPM) und führt in die verschiedenen Kennzahlen ein, die im Kontext des Risikomanagements eingesetzt werden. Der Fokus liegt auf den Kennzahlen Return on Riskadjusted Capital (RORAC) und Risk-Adjusted-Return-on-Capital (RAROC). Es wird ein Berechnungsbeispiel für die Kennzahlen präsentiert und ihre Anwendung in der Bankensteuerung diskutiert.
Schlüsselwörter
Risikomanagement, Bankensteuerung, RAPM, RORAC, RAROC, ökonomisches Kapital, Risikoarten, Hurdle Rate, Anreizsysteme, Performancemessung.
- Quote paper
- Undine Kempe (Author), 2007, Bankensteuerung mit dem RAROC, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88394