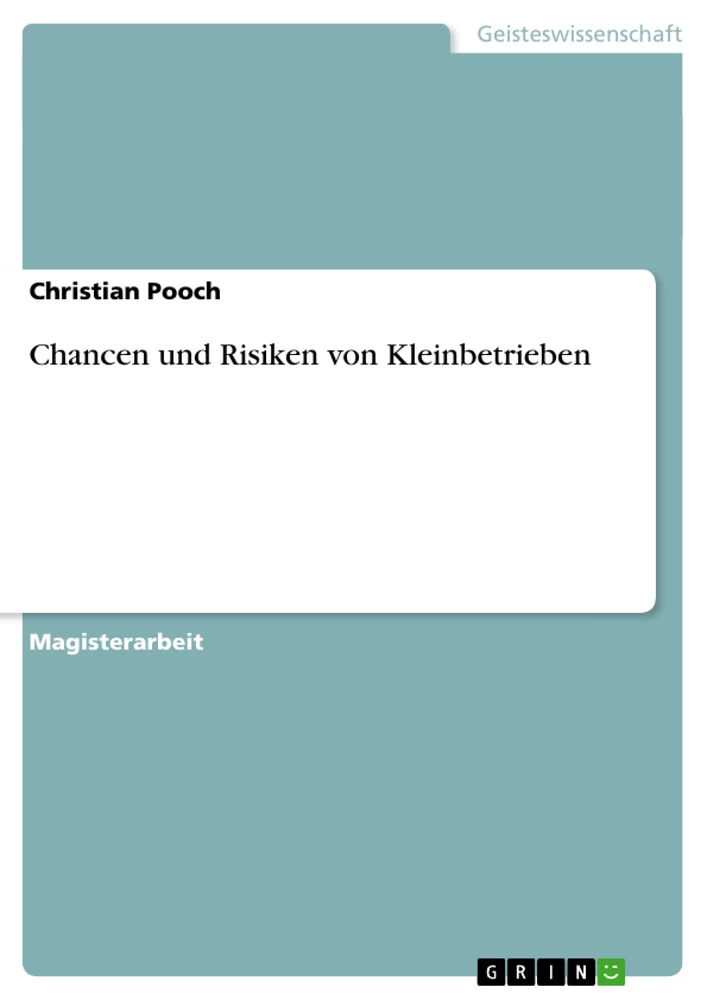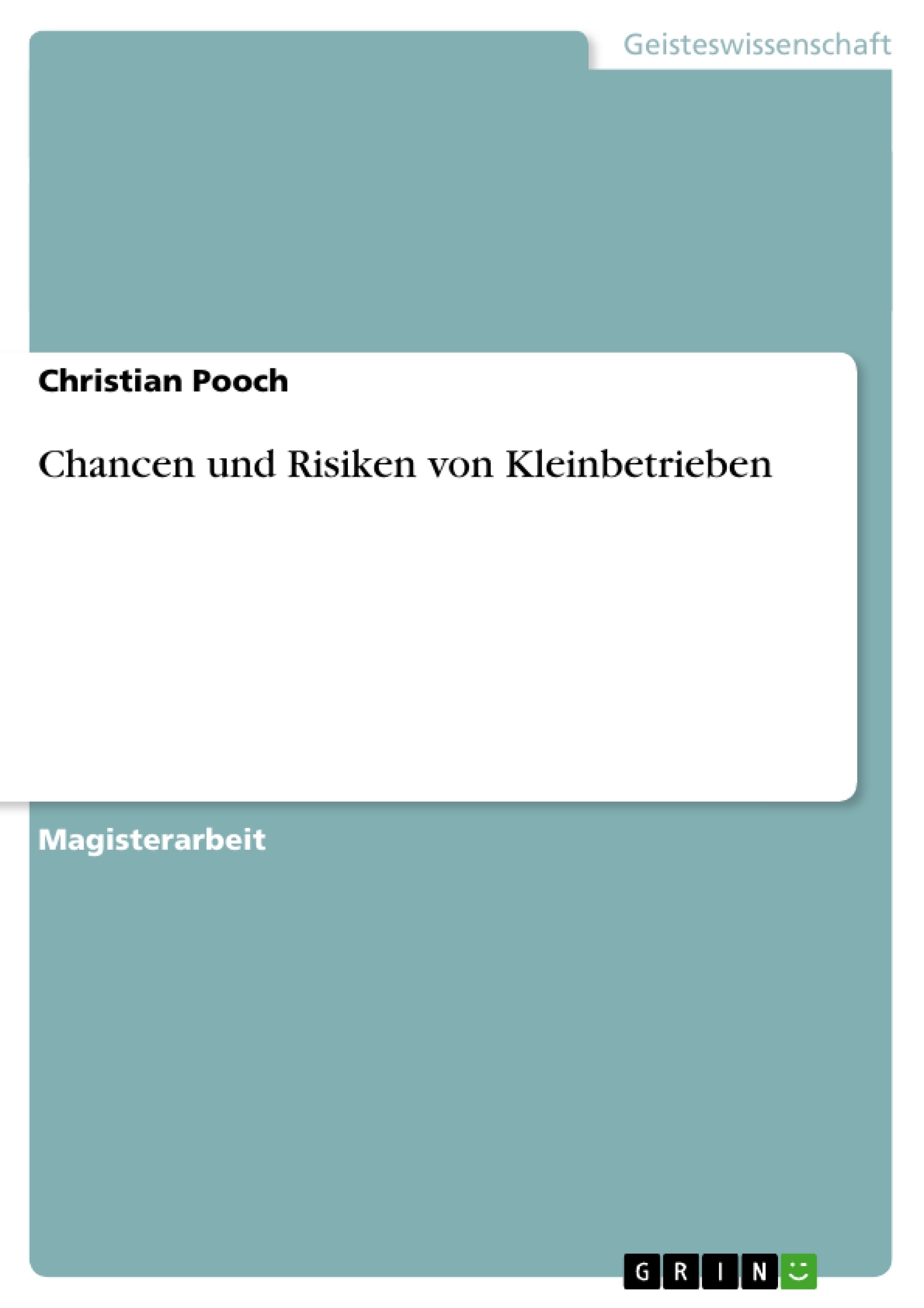Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet die Theorie der Entfremdung von Arbeit.
Entfremdungsphänomene können sich auf verschiedene Weise einstellen, für die vorliegende Arbeit ist aber lediglich die Entfremdung von (Erwerbs-) Arbeit interessant. Im Zuge einer zunehmenden Industrialisierung, entfremdet sich der Mensch zunehmend von seiner Arbeit. Arbeitsteilung und Technisierung trennen den Menschen vom Produkt seiner Arbeit. Der Sinnbezug seiner Tätigkeit geht zunehmend verloren, Vereinzelung und psychische Probleme sind die Folge.
Der Mensch entfernt sich im Prozess der Entfremdung aber nicht nur von seiner Arbeit, sondern auch von seinen Mitmenschen. Ein Bestandteil dieser Überlegungen ist die Einschätzung, dass die Arbeit einen entscheidenden Beitrag zur Lebenswelt des Menschen leistet. Er verbringt einen großen Teil seines Lebens notwendigerweise mit Arbeit. In Deutschland befindet sich der durchschnittliche Arbeiter ca. 40 Stunden pro Woche an seinem Arbeitsplatz. Hier tritt er in Beziehung zu seinen Mitmenschen, hier findet er einen Großteil seiner sozialen Kontakte, hier wird er sozialisiert.
Sozialisierung von Erwachsenen findet freilich nicht ausschließlich im Arbeitsleben statt, der Mensch findet soziale Kontakte auch in seiner Freizeit, in der Familie und beim Ausüben von Hobbys. Sozialisierung in der Arbeitswelt nimmt aber einen großen Anteil ein und wirkt damit zu einem Teil identitätsstiftend. Der Mensch identifiziert sich mit seiner Arbeit, er begreift sich als Arbeiter, Angestellter oder Manager, als Zahnarzt, Architekt oder Kellner.
Selbst die negative Ausprägung von Arbeit, die Arbeitslosigkeit kann vergemeinschaftend wirken und so kann auch der Status der Arbeitslosigkeit Teil der Identität des einzelnen werden. Lernen zwei sich vorher unbekannte Menschen kennen, ist eine der ersten Fragen meist auch die Frage nach der Arbeit. Alter, Wohnort und Arbeitsstelle sind Fakten die uns beim anderen interessieren, die uns helfen einzuschätzen „wer“ der andere ist. Arbeit nimmt also einen großen Stellenwert ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entfremdung
- Der Entfremdungsbegriff bei Emile Durkheim
- Der Entfremdungsbegriff bei Erich Fromm
- Der Entfremdungsbegriff bei Michel Crozier
- Kritik der entfremdungstheoretischen Ansätze bei May
- Ein einheitlicher Entfremdungsbegriff
- Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Kleinbetriebe
- Sozialwissenschaftliche Forschung
- Wirtschaftswissenschaftliche Mittelstandsforschung
- Zur Definition von Kleinbetrieben
- Qualitative Definitionskriterien
- Quantitative Definitionskriterien
- Betriebsgrößenklassen
- Institutionelle Klassifizierung von Betriebsgrößenklassen
- Klassifizierung in der Wissenschaft
- Kleinbetriebe im Verständnis der vorliegenden Arbeit
- Die Bedeutung von Kleinbetrieben in beschäftigungspolitischer und volkswirtschaftlicher Hinsicht
- Typologien von Kleinbetrieben
- Die Typologie von Brussig et al.
- Offene Betriebe
- Determinierte Betriebe
- Prägende Betriebe
- Die Typologie von Weimer
- „Der handwerkliche oder handwerksnahe Kleinbetrieb“
- „Der unterentwickelte Industriebetrieb“
- „Problemlöser“
- Die Typologie von Brussig et al.
- Erkenntnisgewinn für das Thema dieser Arbeit
- Sozialbeziehungen in Kleinbetrieben
- Das Konzept der betriebliche Sozialordnung
- Die gemeinschaftliche Sozialordnung
- instrumentalistische Sozialordnung
- Einflussfaktoren auf die Sozialordnung
- Erkenntnisgewinn für das Thema dieser Arbeit
- Die Person des Unternehmers
- Mitbestimmung und Beteiligung der Beschäftigten im Betrieb
- Institutionalisierte Interessenvertretung (Gewerkschaft und Betriebsrat)
- Der Betriebsrat
- Der gewerkschaftliche Einfluss in Kleinbetrieben
- Bewertung der geringen Betriebsratsquote
- Mitarbeiterbeteiligung
- Institutionalisierte Interessenvertretung (Gewerkschaft und Betriebsrat)
- Entlohnungsbedingungen in Kleinbetrieben
- Die Attraktivität der Arbeit im Kleinbetrieb
- Spezifische Vor- und Nachteile von Kleinbetrieben
- Vorteile
- Nachteile
- Beschäftigungsstabilität in Kleinbetrieben
- Zukünftige Entwicklungstendenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht Chancen und Risiken von deutschen Kleinbetrieben, insbesondere im Hinblick auf die Qualität und Attraktivität der Arbeit für die Beschäftigten. Die Arbeit greift auf die Theorie der Entfremdung von Arbeit zurück und untersucht, ob die Strukturen von Kleinbetrieben zu einer Reduzierung von Entfremdungstendenzen führen können.
- Analyse des Entfremdungsbegriffs und seiner Relevanz für die Arbeitswelt
- Untersuchung der Bedeutung von Kleinbetrieben in der deutschen Wirtschaft und Arbeitswelt
- Bewertung der Auswirkungen von Kleinbetriebsstrukturen auf die Qualität und Attraktivität der Arbeit
- Analyse der Sozialbeziehungen in Kleinbetrieben und ihrer Auswirkungen auf die Entfremdung von Arbeit
- Bewertung der Rolle von Mitbestimmung und Beteiligung der Beschäftigten in Kleinbetrieben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Entfremdung von Arbeit und stellt die Relevanz des Themas für die heutige Arbeitswelt heraus. Anschließend werden verschiedene Entfremdungsbegriffe im Kontext der Arbeit vorgestellt und kritisch betrachtet. Die Arbeit beleuchtet den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu Kleinbetrieben, wobei sowohl sozialwissenschaftliche als auch wirtschaftswissenschaftliche Perspektiven einbezogen werden. Das Kapitel zur Definition von Kleinbetrieben untersucht verschiedene qualitative und quantitative Kriterien sowie die Klassifizierung von Betriebsgrößenklassen.
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Kleinbetrieben in Bezug auf Beschäftigungspolitik und Volkswirtschaft und untersucht Typologien von Kleinbetrieben, um verschiedene Betriebstypen zu identifizieren. Das Kapitel zu Sozialbeziehungen in Kleinbetrieben analysiert das Konzept der betrieblichen Sozialordnung und untersucht den Einfluss von Faktoren wie dem Unternehmer und der Mitbestimmung der Beschäftigten auf die Arbeitsbeziehungen.
Die Arbeit setzt sich außerdem mit Entlohnungsbedingungen und der Attraktivität der Arbeit im Kleinbetrieb auseinander. Sie stellt spezifische Vor- und Nachteile von Kleinbetrieben heraus und untersucht die Beschäftigungsstabilität in Kleinbetrieben. Schließlich werden Zukünftige Entwicklungstendenzen im Bereich der Kleinbetriebe betrachtet.
Schlüsselwörter
Entfremdung, Arbeit, Kleinbetriebe, Sozialbeziehungen, Mitbestimmung, Arbeitsqualität, Beschäftigungsstabilität, Entlohnungsbedingungen, Typologien, Sozialordnung, Deutschland.
- Das Konzept der betriebliche Sozialordnung
- Citation du texte
- Christian Pooch (Auteur), 2007, Chancen und Risiken von Kleinbetrieben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88389