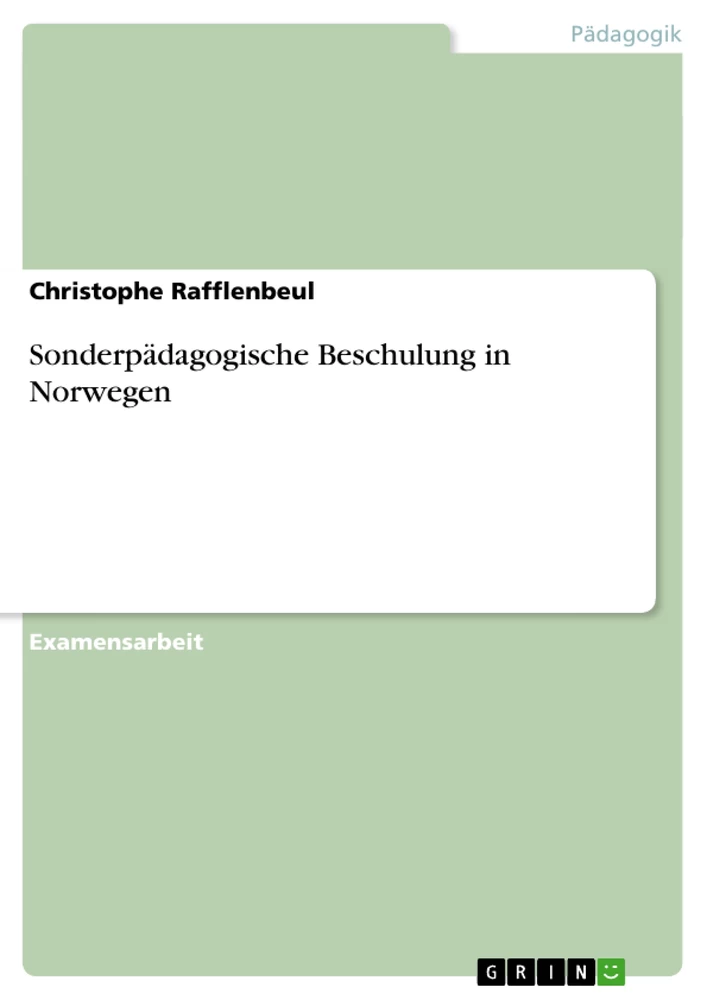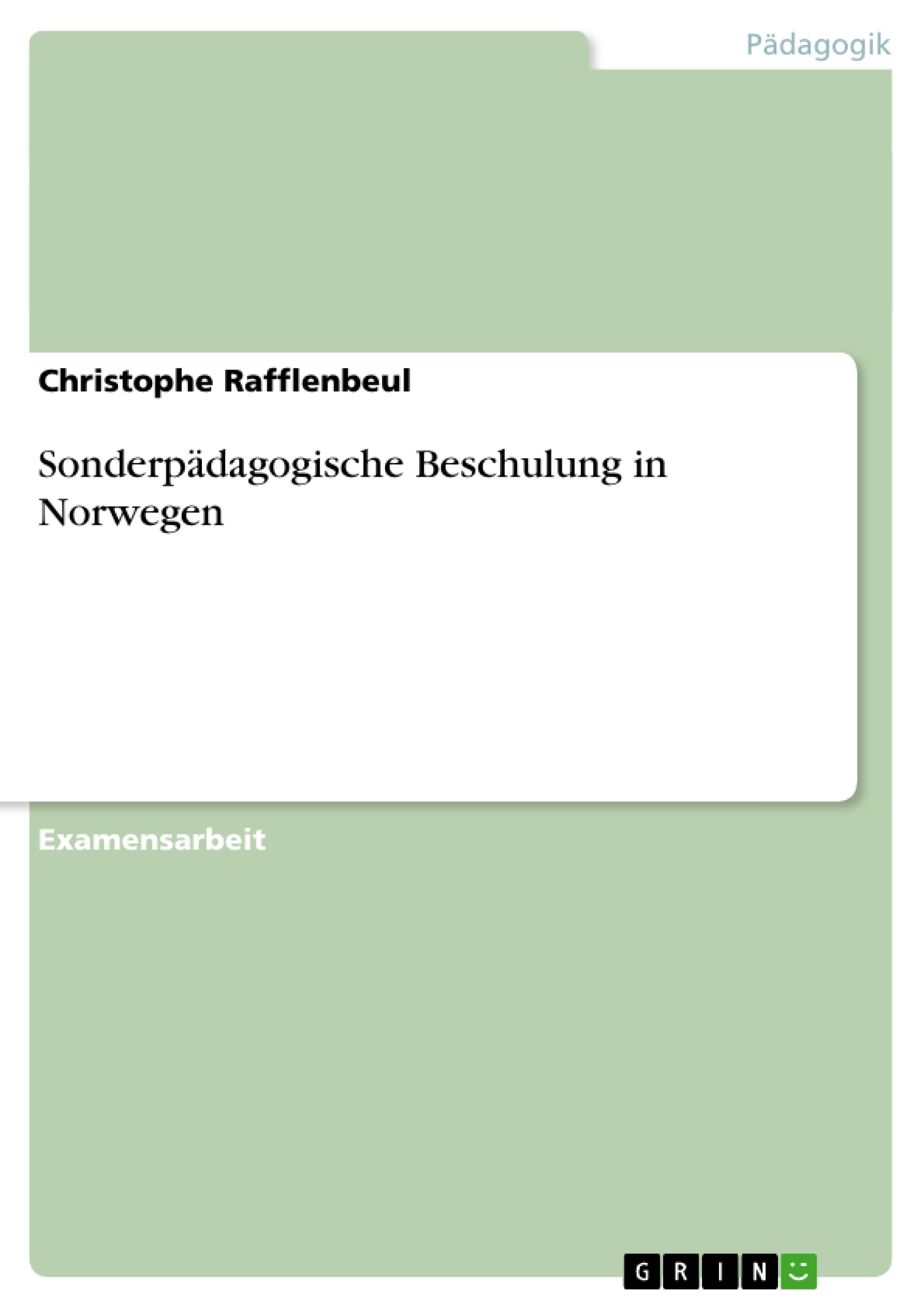Ich wurde durch einen Artikel „Mut fürs Leben mitgeben“ aus der Frankfurter Rundschau auf das norwegische Schulsystem aufmerksam. In diesem Artikel wurden die ausgezeichneten Leistungen der skandinavischen und insbesondere der norwegischen Schüler angepriesen. Als Besonderheit für diese Leistungen wurde das norwegische Schulsystem kurz vorgestellt und, durch die fast 100% Integration der Schüler mit Behinderungen, seine Differenz zu anderen bestehenden europäischen Bildungssystemen erwähnt. Auch wurden die guten Ergebnisse Norwegens innerhalb der PISA-Studie geschildert, die im europäischen Vergleich ebenfalls auf eine Sonderstellung Norwegens verweisen. Aus diesem Artikel heraus wuchs in mir die Idee zu diesem Thema meine Examensarbeit anzufertigen.
Ich stellte mir die Frage, aus welchem Grund die Schüler in Norwegen derart gute Ergebnisse hervorbringen und wodurch diese Leistungen begünstigt werden? Weshalb und inwiefern werden Schüler in Norwegen gut gefördert? Hat eventuell das integrative Schulsystem einen Anteil an den guten Ergebnissen der PISA-Studie? Wie sieht die integrative Beschulung in Norwegen aus und wieso konnte sich ein integratives Schulsystem in Norwegen etablieren? Gibt es einen Zusammenhang zwischen schulischer Integration und guten Schulleistungen? Oder gibt es andere Faktoren im norwegischen Schulsystem, die das gute Abschneiden der norwegischen Schüler bei der PISA-Studie begünstigen? Dies sind Fragen, denen ich im Rahmen dieser Arbeit näher auf den Grund gehen möchte.
Dazu werde ich in den folgenden Kapiteln die Ergebnisse der PISA-Studie von Norwegen im Vergleich zu anderen europäischen und nichteuropäischen Ländern genauer vorstellen. Des Weiteren zeige ich den Verlauf der schulischen Integration im historischen Kontext auf, deren Weiterentwicklung, die in der UNESCO-Konferenz von Salamanca aus dem Jahr 1994 und den aus ihr hervorgehenden Entscheidungen münden und welche Folgen die Salamanca-Erklärung sowohl für die norwegischen Bildungspolitik als auch für die Integrationsbewegung hat.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung und Problemstellung der Arbeit
- Die Ergebnisse der PISA-Studie für Norwegen und andere europäische und nichteuropäische Länder im Vergleich
- Darstellung der historischen Entwicklung des Spezialunterrichts bis hin zum integrativen Schulsystems in Norwegen
- Die Salamanca-Konferenz und ihre Folgen für Norwegen
- Darstellung des integrativen Schulsystems Norwegens
- Vorschulische Erziehung
- Die 10 Jährige Einheits- und Grundschule (grunnskole)
- Weiterführende Schule
- Die Spezialschule
- Die Sonderpädagogischen Zentren (Kompetenzzentren)
- Die Pädagogisch-Psychologischen Dienste
- Schulvorstellungen und Fallbeispiele für integrativen Unterricht in norwegischen Schulen
- Die Lutvann Skole (Kinderstufe)
- Die Haugeasen Ungdomskole
- Begriffsklärung von Integration und Behinderung und deren Einfluss auf die norwegischen Prinzipien der Integration inklusive ihrer theoretischen Einreihung
- Prinzipien der Integration
- Der ökosystemische Ansatz von A. Sander und die Theorie des Gemeinsamen Gegenstands von G. Feuser
- Historische und gesellschaftliche Entwicklung Norwegens
- Das familiäre Prinzip
- Das karitative Prinzip
- Das egalitäre Prinzip (Gleichheitsprinzip)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das integrative Schulsystem in Norwegen und analysiert die Gründe für die guten Leistungen norwegischer Schüler in der PISA-Studie. Der Fokus liegt dabei auf der Verbindung zwischen Inklusion und schulischem Erfolg.
- Die Ergebnisse der PISA-Studie für Norwegen im Vergleich zu anderen Ländern
- Die historische Entwicklung des integrativen Schulsystems in Norwegen
- Die Bedeutung der Salamanca-Konferenz und ihre Folgen für die norwegische Bildungspolitik
- Theoretische Ansätze der Integrationspädagogik und deren Relevanz für das norwegische Modell
- Der Einfluss der gesellschaftlichen und historischen Entwicklung Norwegens auf das Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Zielsetzung und Problemstellung. Im Anschluss werden die Ergebnisse der PISA-Studie für Norwegen im Vergleich zu anderen Ländern vorgestellt. Kapitel 3 beleuchtet die historische Entwicklung des Spezialunterrichts bis hin zum integrativen Schulsystem in Norwegen. Die Auswirkungen der Salamanca-Konferenz auf Norwegen werden im darauffolgenden Kapitel behandelt. Kapitel 5 bietet einen umfassenden Einblick in das integrative Schulsystem Norwegens, einschließlich verschiedener Schulformen und Institutionen. Das sechste Kapitel befasst sich mit konkreten Beispielen für integrativen Unterricht in norwegischen Schulen. Kapitel 7 geht auf die Definition von Integration und Behinderung sowie deren Einfluss auf die norwegischen Prinzipien der Integration ein, inklusive der Einordnung in theoretische Ansätze. In Kapitel 8 werden die historische und gesellschaftliche Entwicklung Norwegens im Kontext des Bildungssystems dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen schulische Integration, inklusive Bildung, PISA-Studie, Salamanca-Konferenz, norwegisches Schulsystem, gesellschaftliche Entwicklung, Integrationspädagogik, ökosystemischer Ansatz, gemeinsamer Gegenstand.
- Quote paper
- Christophe Rafflenbeul (Author), 2004, Sonderpädagogische Beschulung in Norwegen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88380