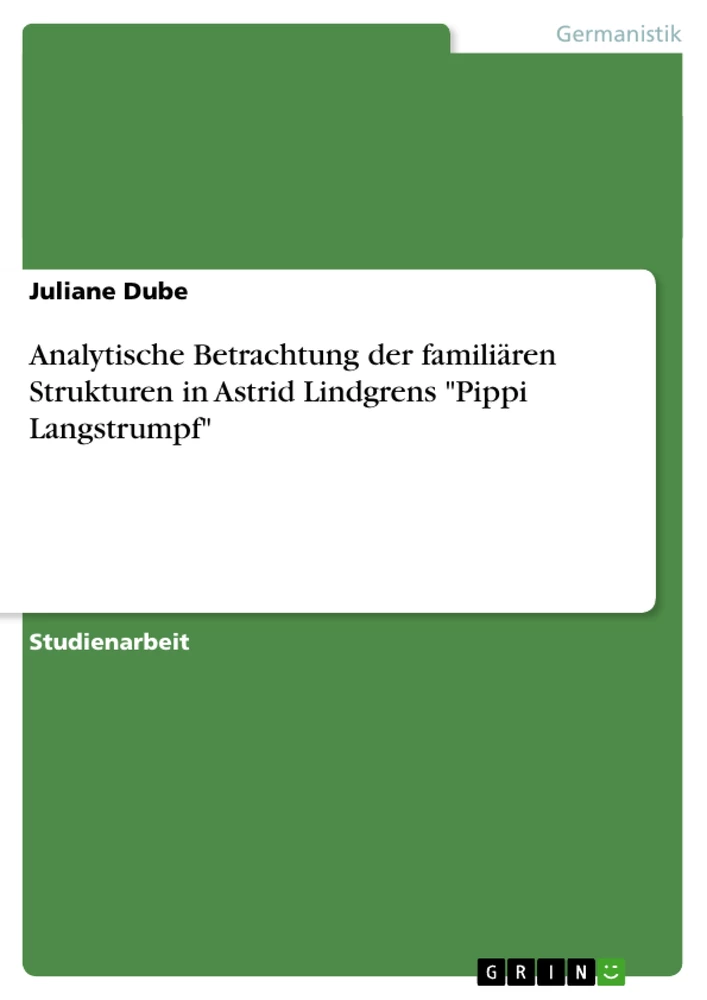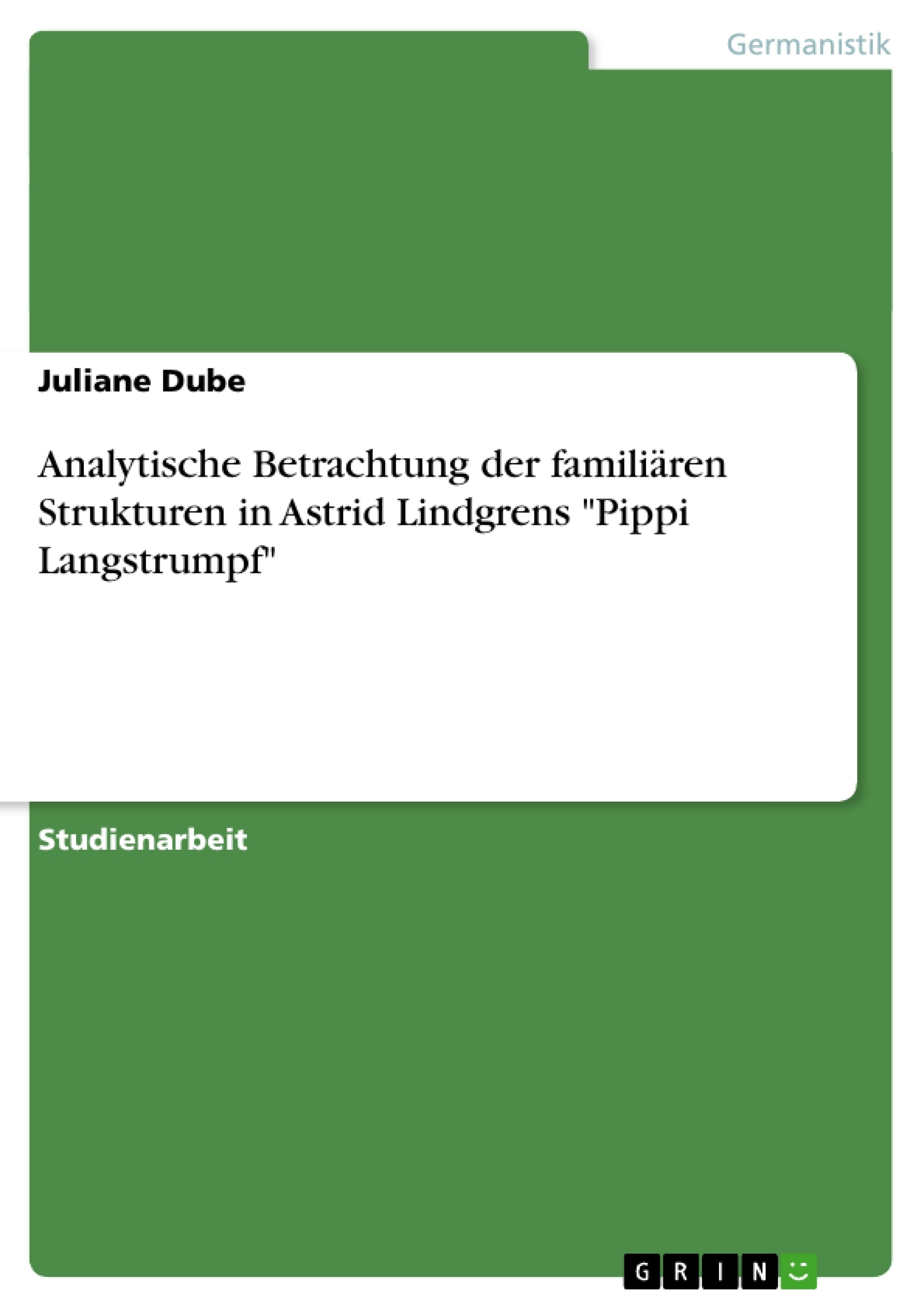Die Idee zur vorliegenden Arbeit entstand im Rahmen des Literaturseminars zum Thema „Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur“ an der Universität Duisburg-Essen. Neben den Werken über Winnie Pu, Biene Maja und Heidi wurde ebenso der Best- und Longseller Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren besprochen.
Auch nach fast 60 Jahren der Erstausgabe in deutscher Übersetzung, besitzen die Pippi-Geschichten für mich eine unvergleichliche Anziehung. Die Freude auf eine Einkehr in eine Welt ohne den neuzeitlichen Druck und Zwang, ohne Zukunftsängste und finanzielle Sorgen waren für mich Grund genug mich mit dem Werk von Pippi Langstrumpf erneut und intensiver auseinanderzusetzen.
Die Geschichte von Pippi Langstrumpf und ihren Freunden ist eine Geschichte über grenzenlose Freiheit, Freundschaft und Mut. Es ist eine auktoriale Erzählung über eine Welt, in der es keine Erwachsenen gibt bzw. in der sie keine große Rolle spielen. Pippi als „ewiges Kind“ und somit Gegenbild des aufklärerischen, viel zu schnell erwachsen werdenden Kindes, lebt den Traum von vielen Mädchen und Jungen. Die Darstellung einer verkehrten Welt, in der ein Mädchen übermenschliche Kräfte besitzt, niemals zur Schule geht und einen Vater hat, der Negerkönig der Taka-Tuka-Insel ist, lässt so manchen Leser, egal ob Kind oder Erwachsenen, in Tagträume versinken.
Pippi ist respektlos, rebellisch, frech und geht meist unbewusst gegen die vordergründigen Ruhe- und Ordnungsparolen an. Sie negiert und verweigert sich Regeln und Normen solange sie für sich deren Sinn nicht entdecken kann. Ihre Charakterzüge sind für die meisten Erwachsenen abstoßend und unerhört. Ihr fehlt die übliche Erziehung und das gute Benehmen, weswegen sie öfter mit den Erwachsenen aneinander gerät. Obwohl sich die Erwachsenen sehr darum bemühen, Pippi zu sozialisieren, ihr Regeln und Normen beizubringen, bleibt sie doch nonkonformistisch.
Lindgren appelliert mit ihren Pippi-Geschichten an den Leser sich gegen den zeitgenössisch geltenden Tugendkatalog zu wehren, der sich nur damit begnügt Anstand, Ordnung, Zeiteinteilung und andere Äußerlichkeiten zu predigen. Pippi besitzt alle Macht der Welt. Doch sie benutzt sie nicht, um nur ihre eigenen Interessen durchzusetzen, sondern kämpft zusammen mit Thomas und Annika unter der Fahne der Freundschaft und Hilfsbereitschaft gegenüber Schwächeren und Benachteiligten. Pippi Langstrumpf ist ein literarisches Beispiel dafür, dass man über Macht verfügen kann, ohne sie zu missbrauchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehungskontext
- 2.1 Die Entwicklung des schwedischen Familienbildes im Verlauf
- 2.2 Lindgrens Auffassung von Erziehung und ihrer Verankerung im Werk
- 3. Pippi Langstrumpf - Halbwaise oder Waisenkind?
- 4. Annika und Thomas – Freunde oder Ersatzfamilie?
- 5. Familie Settergreen - Beispiel für das traditionelle Familienbild
- 6. Pippi Langstrumpf im literaturwissenschaftlichen Diskurs
- 6.1 Endlose Diskussionen zum Klassikerbegriff in der Kinder- und Jugendliteratur
- 6.2 Pippi Langstrumpf, ein Klassiker nach Reinbert Tabbert?
- 6.3 Pippi Langstrumpf, ein Klassiker nach Bettina Kümmerling-Maibauer?
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die familiären Strukturen in Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ im Kontext der Entwicklung des schwedischen Familienbildes im 20. Jahrhundert und der zeitgenössischen pädagogischen Diskussionen. Es wird analysiert, welche familiären Bindungen in der Geschichte dargestellt werden und inwieweit diese von traditionellen Familienbildern abweichen. Die Arbeit beleuchtet zudem die Frage, ob Pippi Langstrumpf als Kinderbuchklassiker gelten kann, anhand etablierter Kriterienkataloge.
- Entwicklung des schwedischen Familienbildes im 20. Jahrhundert
- Analyse der familiären Beziehungen in „Pippi Langstrumpf“
- Pippis Rolle als Gegenbild zum traditionellen Kind
- Der Einfluss der Reformpädagogik auf Lindgrens Werk
- Die Klassifizierung von „Pippi Langstrumpf“ als Kinderliteraturklassiker
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit den familiären Strukturen in Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ auseinanderzusetzen. Es wird auf die anhaltende Popularität der Pippi-Geschichten hingewiesen und die zentrale Frage nach den dargestellten familiären Beziehungen und deren Abweichung von traditionellen Modellen formuliert. Die Autorin deutet bereits zu Beginn die Bedeutung von Pippi als ein Gegenbild zu den Normen der damaligen Zeit an.
2. Entstehungskontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund der Entstehung von „Pippi Langstrumpf“. Es wird die Entwicklung des schwedischen Familienbildes vom traditionellen „Hausgemeinschaft“-Modell hin zur Kernfamilie im 20. Jahrhundert nachgezeichnet. Dabei werden die Auswirkungen der Industrialisierung und die Veränderungen im Rollenverständnis von Mann und Frau diskutiert. Der Einfluss reformpädagogischer Ideen auf Lindgrens Werk und deren Verankerung in den Geschichten wird ebenfalls thematisiert, unter Bezugnahme auf relevante Persönlichkeiten und Strömungen.
3. Pippi Langstrumpf - Halbwaise oder Waisenkind?: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die besondere Situation Pippis als scheinbar allein erziehende junge Frau. Es untersucht ihre Lebensumstände und ihre Beziehung zu ihrem Vater, dem Negerkönig von Taka-Tuka-Land, und hinterfragt die Konnotationen von „Halbwaise“ und „Waisenkind“ im Kontext der Geschichte. Es analysiert, wie diese Konstellation Pippis Unabhängigkeit und Freiheit prägt und gleichzeitig ihr soziales Umfeld beeinflusst.
4. Annika und Thomas – Freunde oder Ersatzfamilie?: Dieser Abschnitt analysiert die Beziehungen Pippis zu Annika und Thomas. Es wird untersucht, inwieweit Annika und Thomas als Ersatzfamilie für Pippi fungieren und wie diese Freundschaftsbeziehungen ihren Einfluss auf die drei Charaktere und das Narrativ der Geschichte haben. Die Dynamik dieser Beziehungen wird im Detail beleuchtet, und es wird thematisiert, wie diese Freundschaften zu Pippis Charakter und Handlungsweisen beitragen.
5. Familie Settergreen - Beispiel für das traditionelle Familienbild: Dieses Kapitel beleuchtet die Familie Settergreen als Beispiel für ein traditionelles Familienbild und setzt es in Kontrast zu Pippis Lebensweise. Es werden die Unterschiede in den Erziehungsstilen, den Wertvorstellungen und dem familiären Zusammenleben verglichen, um die Besonderheit von Pippis Welt herauszustellen. Die Bedeutung der Kontrastierung mit der konventionellen Familie Settergreen für das Verständnis von Pippis Charakter und deren Rebellion wird dabei hervorgehoben.
6. Pippi Langstrumpf im literaturwissenschaftlichen Diskurs: Dieses Kapitel diskutiert die Einordnung von „Pippi Langstrumpf“ als Kinderbuchklassiker unter Zuhilfenahme von verschiedenen Kriterienkatalogen. Es werden die Ansätze von Reinbert Tabbert und Bettina Kümmerling-Maibauer zur Definition eines Klassikers vorgestellt und ihre Anwendung auf die Pippi-Bücher analysiert. Zusätzliche Ergebnisse einer Befragung von Schülern zum Buch werden diskutiert und in die Analyse einbezogen.
Schlüsselwörter
Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, Familienstrukturen, schwedisches Familienbild, Reformpädagogik, Kinderbuchklassiker, Antiautoritarismus, Freiheit, Unabhängigkeit, Freundschaft, Traditionelles Familienmodell, Kinderliteratur.
Häufig gestellte Fragen zu "Pippi Langstrumpf" - Familienstrukturen und Klassikerstatus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die familiären Strukturen in Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" im Kontext der Entwicklung des schwedischen Familienbildes im 20. Jahrhundert und der zeitgenössischen pädagogischen Diskussionen. Es wird analysiert, wie die dargestellten familiären Bindungen von traditionellen Familienbildern abweichen und ob "Pippi Langstrumpf" als Kinderbuchklassiker gelten kann.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des schwedischen Familienbildes, analysiert die familiären Beziehungen in "Pippi Langstrumpf" (Pippi, Annika, Thomas, Familie Settergreen), untersucht Pippis Rolle als Gegenbild zum traditionellen Kind, den Einfluss der Reformpädagogik auf Lindgrens Werk und die Klassifizierung von "Pippi Langstrumpf" als Kinderliteraturklassiker anhand etablierter Kriterienkataloge.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Entstehungskontext (Entwicklung des schwedischen Familienbildes und Lindgrens pädagogischer Ansatz), Pippi als Halbwaise/Waisenkind, die Beziehung zwischen Pippi, Annika und Thomas, die Familie Settergreen als Beispiel für ein traditionelles Familienbild, "Pippi Langstrumpf" im literaturwissenschaftlichen Diskurs (inkl. Diskussion der Klassikerdefinition nach Tabbert und Kümmerling-Maibauer) und Zusammenfassung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Entwicklung des schwedischen Familienbildes im 20. Jahrhundert, relevante reformpädagogische Ideen und Strömungen, sowie die Ansätze von Reinbert Tabbert und Bettina Kümmerling-Maibauer zur Definition eines Kinderbuchklassikers. Zusätzlich werden Ergebnisse einer (nicht näher spezifizierten) Schülerbefragung einbezogen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Darstellung von familiären Beziehungen in "Pippi Langstrumpf" im Vergleich zu traditionellen Familienmodellen und bewertet den Status des Buches als Kinderliteraturklassiker unter Berücksichtigung der diskutierten Kriterien. Die konkreten Schlussfolgerungen werden in der Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und der Gesamtzusammenfassung dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die zentralen Begriffe sind: Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, Familienstrukturen, schwedisches Familienbild, Reformpädagogik, Kinderbuchklassiker, Antiautoritarismus, Freiheit, Unabhängigkeit, Freundschaft, traditionelles Familienmodell, Kinderliteratur.
Wo finde ich mehr Informationen zum Entstehungskontext von "Pippi Langstrumpf"?
Kapitel 2 der Arbeit beleuchtet den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund der Entstehung von "Pippi Langstrumpf", inklusive der Entwicklung des schwedischen Familienbildes im 20. Jahrhundert und dem Einfluss reformpädagogischer Ideen auf Lindgrens Werk.
Wie wird Pippis Beziehung zu Annika und Thomas analysiert?
Kapitel 4 untersucht die Beziehung zwischen Pippi, Annika und Thomas im Detail. Es wird analysiert, inwieweit Annika und Thomas als Ersatzfamilie für Pippi fungieren und wie diese Freundschaftsbeziehungen die drei Charaktere und das Narrativ der Geschichte beeinflussen.
Wie wird der Klassikerstatus von "Pippi Langstrumpf" diskutiert?
Kapitel 6 widmet sich der Einordnung von "Pippi Langstrumpf" als Kinderbuchklassiker. Es werden die Ansätze von Reinbert Tabbert und Bettina Kümmerling-Maibauer zur Definition eines Klassikers vorgestellt und auf die Pippi-Bücher angewendet. Ergebnisse einer Schülerbefragung werden ebenfalls berücksichtigt.
- Quote paper
- Juliane Dube (Author), 2008, Analytische Betrachtung der familiären Strukturen in Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88370