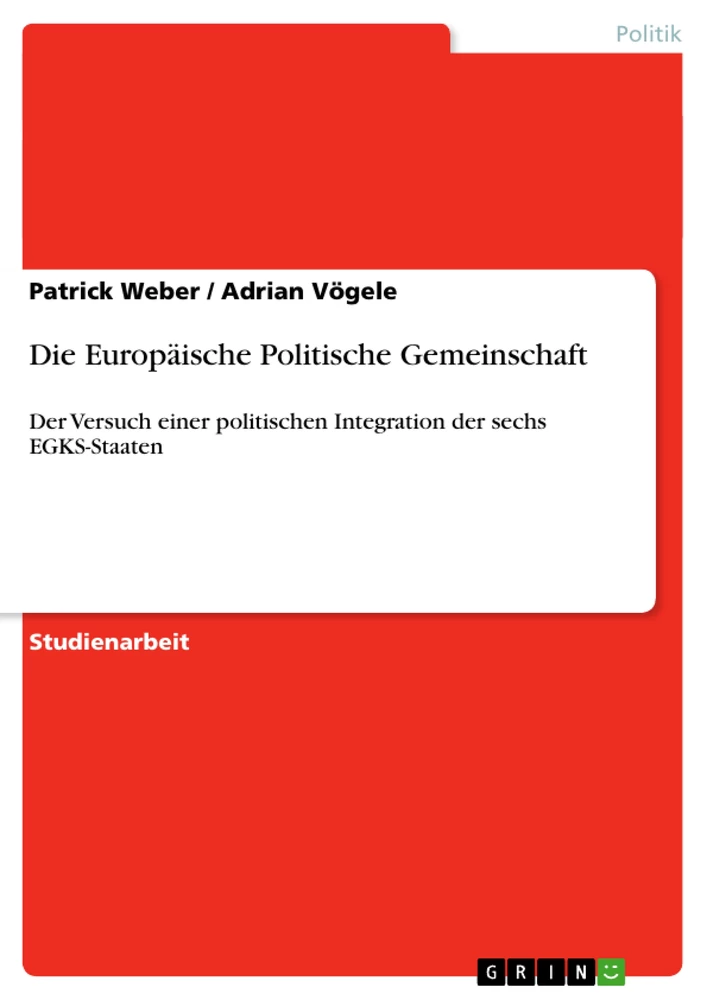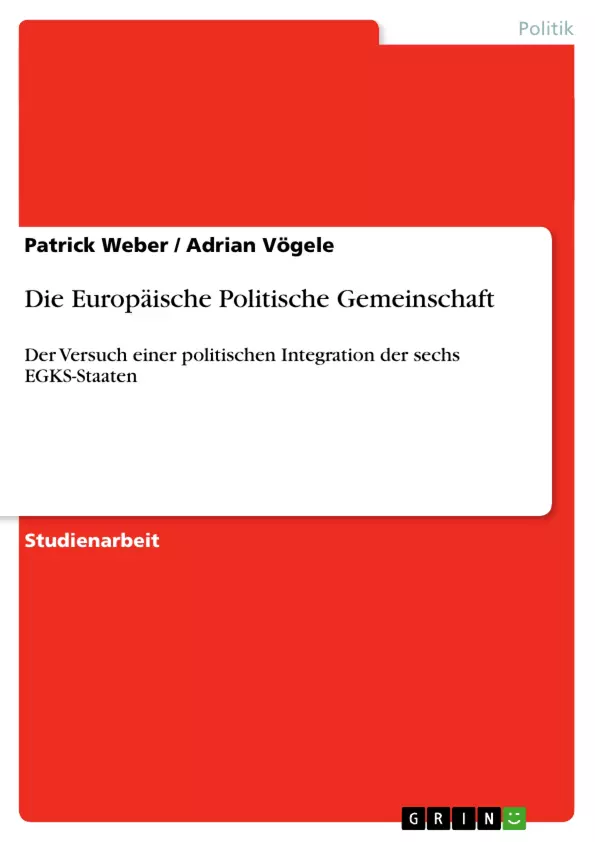Die Europäische Union (EU), wie sie sich gegenwärtig präsentiert, entzieht sich der herkömmlichen Einteilung staatlicher Gebilde in Bundesstaat oder Staatenbund. Sie ist „weder eine Föderation wie die USA noch einfach eine Organisation für die Zusammenarbeit von Regierungen wie die UNO“ (Europäische Union 2006: 4). Dennoch handelt es sich um ein staatenähnliches politisches System, dessen Besonderheit in den europäischen In-stitutionen und Organen liegt (Kohler-Koch 2004: 105–111). Geschaffen wurden diese im Rahmen der europäischen Verträge und es hat sich eingebürgert, die Geschichte der europäischen Integration mit dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1951 beginnen zu lassen (Europäische Uni-on 2006: 5). Diese Darstellung ist insofern gerechtfertigt, als der Versuch einer umfassenden politischen Integration bei den Verhandlungen zur Gründung des Europarats scheiterte. Die ambitionierten Pläne zahlreicher föderalistischer Gruppierungen konnten sich nicht gegen die Kräfte durchsetzen, die nur einen gemässigten Unionismus vertraten (Knipping 2004: 57).
Was bei der Fokussierung auf die europäischen Verträge gerne vergessen wird, sind die Verhandlungen über eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und eine Europäische Politische Gemeinschaft (EPG), welche parallel zu den Verhandlungen über die EGKS geführt wurden. Am 27. Mai 1952 unterzeichneten die Aussenminister der sechs Mitglieder der EGKS nach monatelangen Verhandlungen den Vertrag für die EVG (Loth 1996: 93-100). Folgerichtig stand nun auch die politische Integration zur Debatte, denn ohne ein politisches Konzept konnte eine wirtschaftliche und militärische Integration nur bedingt stattfinden (Krüger 2006: 241). Die am 13. September 1952 eingesetzte Ad-hoc-Kommission erarbeitete gemäss dem Artikel 38 des EVG-Vertrags einen Entwurf für die Satzung der Europäischen Gemeinschaft, welche am 10. März 1953 von dieser Kommission verabschiedet wurde. Freilich scheiterte dieser Vorstoss letztendlich am Widerstand der neuen französischen Regierung, welche das Thema EVG/EPG im August 1954 von der Tagesordnung strich und somit allen Plänen eines politisch vereinten Europas ein abruptes Ende bereitete (Gehler 2005: 137).
Dennoch verfügen wir heute mit dem Satzungsentwurf für die EPG über ein beeindruckendes Dokument, das eindeutig ein föderalistisches Konzept mit supranationalem Charakter verkörpert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorie
- 2.1 Definition: Was ist eine Föderation?
- 2.2 Funktion einer Föderation
- 2.3 Hypothesen
- 2.4 Begriffsbestimmung
- 3 Fallbetrachtung: Das Projekt EPG
- 3.1 Der Weg in die Verhandlungen zur EPG
- 3.2 Ideologische Kongruenz der EGKS-Staaten
- 3.3 Aussenpolitische Sachzwänge und gegenseitige Abhängigkeit
- 3.4 Das Scheitern der EPG
- 4 Schluss
- 4.1 Praktische und theoretische Grenzen eines föderalistischen Integrationskonzepts
- 4.2 Perspektiven der Integration
- 5 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Faktoren, welche einen weitreichenden politischen Integrationsprozess der sechs Mitgliedstaaten der EGKS im Rahmen des Projekts Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) gefördert haben. Der Fokus liegt auf der Analyse des föderalistischen Konzepts, das im Satzungsentwurf der EPG zum Ausdruck kommt, und der Betrachtung der Bedingungen, die zur Entstehung einer solchen Föderation führen.
- Föderalistische Integrationstheorien
- Das Projekt der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG)
- Ideologische und außenpolitische Faktoren der Integration
- Grenzen eines föderalistischen Integrationskonzepts
- Vergleich zwischen dem EPG-Projekt und dem Modell einer Föderation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Besonderheit der Europäischen Union als staatenähnliches System und setzt die Geschichte der europäischen Integration mit dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 1951 in Verbindung. Sie hebt die gescheiterten Verhandlungen zur Gründung eines Europäischen Rates hervor und betont die oft vergessenen parallelen Verhandlungen über eine Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG). Der Fokus wird auf den Satzungsentwurf der EPG gelegt, der als ein beeindruckendes Dokument eines föderalistischen Konzepts mit supranationalem Charakter gilt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Faktoren zu untersuchen, welche einen so weitreichenden politischen Integrationsprozess der sechs EGKS-Mitgliedstaaten gefördert haben und warum der Ansatz letztlich scheiterte. Die Bedeutung föderalistischer Theorien für die Analyse wird hervorgehoben, im Gegensatz zu funktionalistischen Ansätzen.
2 Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beginnt mit einer Definition des Begriffs "Föderation," indem verschiedene Aspekte, wie gemeinsame Werte und Interessen der beteiligten Gruppen, sowie die Aufrechterhaltung der Existenz der einzelnen Einheiten, betrachtet werden. Der institutionell-funktionalistische Ansatz wird diskutiert, der die Entscheidungsbefugnisse der Zentralregierung im Verhältnis zu den Regionalregierungen differenziert. Es wird zwischen konföderalen und föderalen Organisationsformen unterschieden, wobei der Fokus auf der engeren Definition der Föderation als quasi-bundesstaatliche Organisation liegt. Der Kapitelteil beschreibt die Funktionen einer Föderation, wie die Bewältigung von äusserem Druck und die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes, wobei die Herausforderungen durch Misstrauen zwischen den Mitgliedern angesprochen werden. Abschließend werden die Bedingungen für die Entstehung einer Föderation erörtert, einschließlich der Absichten der Politiker und der Notwendigkeit eines konstitutionellen Akts.
3 Fallbetrachtung: Das Projekt EPG: Dieses Kapitel analysiert den konkreten Fall der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG). Es beschreibt den Verlauf der Verhandlungen, die ideologische Kongruenz der beteiligten EGKS-Staaten, sowie die außenpolitischen Sachzwänge und die gegenseitige Abhängigkeit, die den Integrationsprozess beeinflusst haben. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Gründe für das letztendliche Scheitern des EPG-Projekts und der damit verbundenen Implikationen für die europäische Integration. Die Kapitelteile betrachten die verschiedenen Faktoren und deren Zusammenwirken im Detail, um ein umfassendes Bild des historischen Ereignisses zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Europäische Politische Gemeinschaft (EPG), Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), Föderalismus, politische Integration, supranationale Institutionen, außenpolitische Sachzwänge, ideologische Kongruenz, Integrationstheorien, bundesstaatliche Organisationsform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse des Projekts Europäische Politische Gemeinschaft (EPG)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Faktoren, die den weitreichenden politischen Integrationsprozess der sechs EGKS-Mitgliedstaaten im Rahmen des Projekts Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) beeinflusst haben. Der Fokus liegt auf dem föderalistischen Konzept der EPG und den Bedingungen für die Entstehung einer solchen Föderation. Die Arbeit untersucht sowohl den Erfolg als auch das Scheitern des Projekts.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt föderalistische Integrationstheorien, das Projekt EPG, ideologische und außenpolitische Faktoren der Integration, die Grenzen eines föderalistischen Integrationskonzepts und einen Vergleich zwischen dem EPG-Projekt und dem Modell einer Föderation. Es beinhaltet auch eine detaillierte Fallstudie des EPG-Projekts.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beleuchtet die Geschichte der europäischen Integration und den Fokus auf das EPG-Projekt. Kapitel 2 (Theorie) definiert den Begriff "Föderation" und diskutiert verschiedene Integrationstheorien. Kapitel 3 (Fallbetrachtung: Das Projekt EPG) analysiert detailliert das EPG-Projekt, einschließlich der Verhandlungen, ideologischer Faktoren und außenpolitischer Sachzwänge. Kapitel 4 (Schluss) behandelt die praktischen und theoretischen Grenzen des föderalistischen Konzepts und Perspektiven der Integration. Kapitel 5 (Anhang) ist im Inhaltsverzeichnis aufgeführt, jedoch ohne detaillierte Beschreibung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die einen weitreichenden politischen Integrationsprozess der sechs EGKS-Mitgliedstaaten gefördert haben, und die Gründe für das Scheitern des EPG-Projekts zu untersuchen. Dabei wird der föderalistische Ansatz im Gegensatz zu funktionalistischen Ansätzen betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Europäische Politische Gemeinschaft (EPG), Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), Föderalismus, politische Integration, supranationale Institutionen, außenpolitische Sachzwänge, ideologische Kongruenz, Integrationstheorien, bundesstaatliche Organisationsform.
Wie wird der Begriff "Föderation" in der Arbeit definiert?
Der Begriff "Föderation" wird als quasi-bundesstaatliche Organisation definiert, die gemeinsame Werte und Interessen der beteiligten Gruppen berücksichtigt, während die Existenz der einzelnen Einheiten erhalten bleibt. Der institutionell-funktionalistische Ansatz wird diskutiert, der die Entscheidungsbefugnisse der Zentralregierung im Verhältnis zu den Regionalregierungen differenziert. Es wird zwischen konföderalen und föderalen Organisationsformen unterschieden.
Welche Rolle spielen ideologische und außenpolitische Faktoren in der Analyse?
Die Arbeit analysiert die ideologische Kongruenz der EGKS-Staaten und die außenpolitischen Sachzwänge und gegenseitige Abhängigkeit, die den Integrationsprozess des EPG-Projekts beeinflusst haben. Diese Faktoren werden als wichtige Einflussgrößen auf den Erfolg oder das Scheitern des Integrationsprozesses betrachtet.
Warum ist das EPG-Projekt gescheitert?
Das Dokument untersucht die Gründe für das Scheitern des EPG-Projekts im Detail, jedoch ohne explizit eine einzige Ursache zu nennen. Vielmehr wird ein umfassendes Bild der verschiedenen Faktoren und deren Zusammenwirken gezeichnet, die zum Scheitern beigetragen haben.
Welche Bedeutung hat der Satzungsentwurf der EPG?
Der Satzungsentwurf der EPG wird als beeindruckendes Dokument eines föderalistischen Konzepts mit supranationalem Charakter beschrieben. Er dient als zentraler Bezugspunkt für die Analyse des föderalistischen Ansatzes im EPG-Projekt.
- Quote paper
- Patrick Weber (Author), Adrian Vögele (Author), 2007, Die Europäische Politische Gemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88327