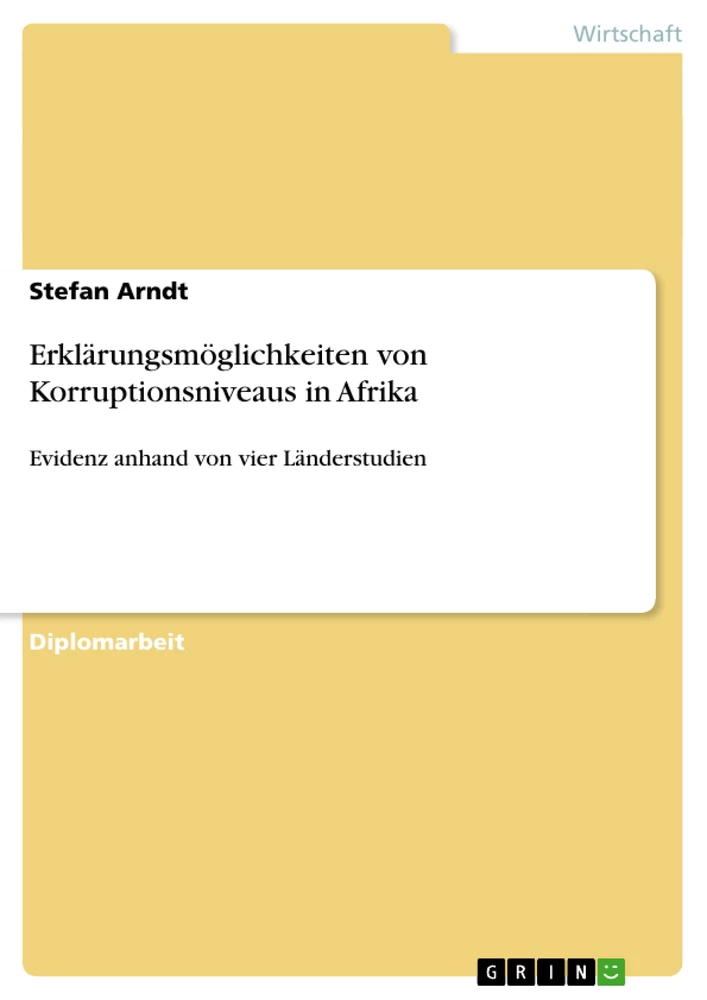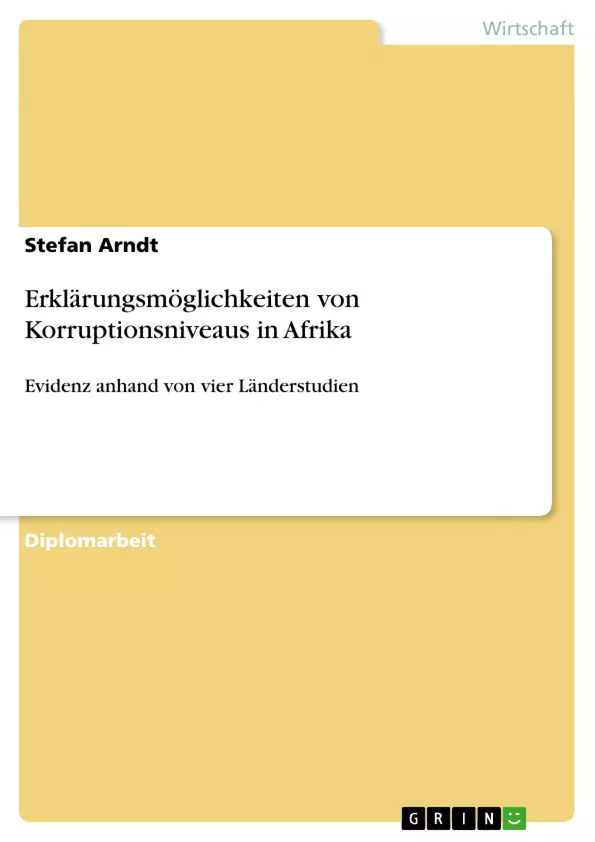Die Arbeit beschäftigt sich damit wie sich die anhaltend hohen Korruptionsniveaus in den Entwicklungsländern Afrikas erklären lassen.
Die Arbeit beginnt (nach einer Einleitung in Kapitel 1) mit einer Definitionsfindung (Kapitel 2) und der damit verbundenen Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen von Korruption. Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit der Messung von Korruption.
Der vierte Teil der Arbeit gibt einen Überblick über die Maßnahmen gegen Korruption, die in der Literatur vorgeschlagen und in der Realität schon durchgeführt worden sind.
Im fünften Kapitel wird zunächst das Korruptionsproblem speziell in Afrika dargestellt. Dann werden die Untersuchungskriterien für die folgenden Fallstudien vorgestellt. Der Verfasser bezieht sich hierbei auf die Studie von Brunetti & Weder (2003) und unterscheidet zwischen Determinanten der internen Kontrolle von Korruption, Determinanten der externen Kontrolle von Korruption und Indirekten Determinanten von Korruption.
In Kapitel 6 werden fallstudienartig die vier Länder Kamerun, Nigeria, Namibia und Südafrika untersucht. Sowohl Kamerun als auch Nigeria sind beim CPI auf den untersten Rängen vertreten (mit Aufwärtstrend). Dagegen sind Namibia und Südafrika eher auf den mittleren Rängen platziert. Gemeinsam sind den vier Ländern die politische Struktur sowie die Abhängigkeit von einem Hauptexportgut. Bei der Fallstudienanalyse geht der Verfasser bei jedem Land zunächst auf den (1) geschichtlichen Hintergrund des Landes, dann auf die oben genannten Kriterien (2) interne Kontrolldeterminanten, (3) externe Kontrolldeterminanten und (4) indirekte Determinanten ein. Bei den externen Kontrolldeterminanten unterscheidet der Verfasser in (a) Rechtssystem und Korruptionsausmaß, (b) die Rolle der Zivilgesellschaft und (c) die Rolle der Medien und Pressefreiheit.
Im siebten Kapitel versucht der Verfasser schließlich, allgemeine Erklärungsmuster der zuvor behandelten Fallstudien herauszuarbeiten. Als Haupterklärungsgründe für die vorherrschenden Korruptionsniveaus werden der Rohstoffreichtum und bad governance genannt. Schließlich wird das Korruptionsproblem noch in die allgemeinere Unterentwicklungsproblematik eingeordnet.
Die Arbeit schließt in Kapitel 8 mit einigen Schlussfolgerungen, z.B. der weiteren Verbesserung der vorhandenen Messinstrumente oder einer stärker interdisziplinären Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- Definition und Überblick über die Korruptionsforschung
- 2 Korruption: Definition und Formen
- 2.1 Definitionsfindung
- 2.2 Formen von Korruption
- 2.3 Theoriegeschichte der ökonomischen Korruptionsforschung
- 2.4 Zwischenfazit
- 3 Messung von Korruption
- 3.1 Empirie über Ursachen und Folgen von Korruption: objektive Messverfahren
- 3.2 Die subjektiven Messverfahren
- 3.2.1 Messinstrumente von Transparency International
- 3.2.1.1 Der Corruption Perception Index
- 3.2.1.2 Der Bribe Payers Index
- 3.2.1.3 Das Global Corruption Barometer
- 3.2.2 Der Governance Research Indicator der Weltbank
- 3.3 Zwischenfazit Messinstrumente
- 4 Bekämpfung von Korruption
- 4.1 Ansätze in der Literatur
- 4.2 Maßnahmen internationaler Organisationen im Kampf gegen Korruption
- 4.2.1 Maßnahmen der OECD
- 4.2.2 Maßnahmen der Vereinten Nationen
- 4.2.3 Maßnahmen der Extractive Industries Transparency Initiative
- 4.2.4 Maßnahmen der Afrikanischen Union
- 4.2.5 Maßnahmen der International Chamber of Commerce
- 4.2.6 Maßnahmen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds
- 4.3 Zwischenfazit zur Bekämpfung von Korruption
- 5 Korruption in Afrika – der besondere Fall?
- 5.1 Afrika und Korruption
- 5.2 Kriterien für die Untersuchung
- 6 Fallstudien zu vier ausgewählten Ländern
- 6.1 Kamerun
- 6.1.1 Zur Geschichte Kameruns
- 6.1.2 Interne Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.1.3 Externe Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.1.3.1 Rechtssystem und Korruptionsausmaß
- 6.1.3.2 Die Rolle der Zivilgesellschaft
- 6.1.3.3 Rolle der Medien und Pressefreiheit
- 6.1.4 Indirekte Determinanten der Korruption
- 6.2 Namibia
- 6.2.1 Zur Geschichte Namibias
- 6.2.2 Interne Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.2.3 Externe Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.2.3.1 Rechtssystem und Korruptionsausmaß
- 6.2.3.2 Die Rolle der Zivilgesellschaft
- 6.2.3.3 Rolle der Medien und Pressefreiheit
- 6.2.4 Indirekte Determinanten der Korruption
- 6.3 Nigeria
- 6.3.1 Zur Geschichte Nigerias
- 6.3.2 Interne Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.3.3 Externe Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.3.3.1 Rechtssystem und Korruptionsausmaß
- 6.3.3.2 Die Rolle der Zivilgesellschaft
- 6.3.3.3 Rolle der Medien und Pressefreiheit
- 6.3.4 Indirekte Determinanten der Korruption
- 6.4 Südafrika
- 6.4.1 Zur Geschichte Südafrikas
- 6.4.2 Interne Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.4.3 Externe Determinanten der Kontrolle von Korruption
- 6.4.3.1 Rechtssystem und Korruptionsausmaß
- 6.4.3.2 Die Rolle der Zivilgesellschaft
- 6.4.3.3 Rolle der Medien und Pressefreiheit
- 6.4.4 Indirekte Determinanten der Korruption
- 7 Allgemeine Erklärungsmuster
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht Korruption in Afrika und versucht, die unterschiedlichen Korruptionsniveaus in vier afrikanischen Ländern zu erklären. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein tieferes Verständnis der komplexen Faktoren zu entwickeln, die das Auftreten von Korruption beeinflussen.
- Definition und Formen von Korruption
- Messung von Korruption
- Bekämpfung von Korruption
- Korruption in Afrika: Der besondere Fall
- Fallstudien zu vier ausgewählten Ländern (Kamerun, Namibia, Nigeria, Südafrika)
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Forschungslandschaft der Korruptionsforschung und führt in die Thematik der Diplomarbeit ein.
- Kapitel 2: Korruption: Definition und Formen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und den Formen von Korruption. Es beleuchtet die theoretischen Grundlagen der ökonomischen Korruptionsforschung.
- Kapitel 3: Messung von Korruption: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Messmethoden für Korruption. Es wird auf objektive und subjektive Messverfahren sowie auf gängige Indikatoren wie den Corruption Perception Index (CPI) eingegangen.
- Kapitel 4: Bekämpfung von Korruption: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ansätze zur Bekämpfung von Korruption, sowohl in der Literatur als auch in der Praxis. Es beleuchtet Maßnahmen internationaler Organisationen wie der OECD, der Vereinten Nationen und der Weltbank.
- Kapitel 5: Korruption in Afrika – der besondere Fall?: Dieses Kapitel betrachtet die Besonderheiten von Korruption in Afrika und die relevanten Kriterien für die Untersuchung.
- Kapitel 6: Fallstudien zu vier ausgewählten Ländern: In diesem Kapitel werden vier Fallstudien zu Kamerun, Namibia, Nigeria und Südafrika durchgeführt. Die einzelnen Fallstudien analysieren die Determinanten der Kontrolle von Korruption in den jeweiligen Ländern und stellen die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten für die Bekämpfung von Korruption dar.
Schlüsselwörter
Korruption, Afrika, Fallstudien, Korruptionsniveaus, Determinanten, Kontrolle von Korruption, Rechtssystem, Zivilgesellschaft, Medien, Pressefreiheit, Entwicklung, Wirtschaft, Governance, Transparency International, Corruption Perception Index (CPI), Bribe Payers Index (BPI), Global Corruption Barometer (GCB), Weltbank, OECD, Afrikanische Union.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Korruptionsniveau in vielen afrikanischen Staaten so hoch?
Haupterklärungsgründe sind laut Arbeit der Rohstoffreichtum (Ressourcenfluch), mangelnde Regierungsführung (Bad Governance) und schwache institutionelle Kontrollen.
Wie wird Korruption international gemessen?
Wichtige Instrumente sind der Corruption Perception Index (CPI) von Transparency International sowie der Governance Research Indicator der Weltbank.
Welche Länder wurden in den Fallstudien untersucht?
Die Arbeit analysiert Kamerun und Nigeria (niedrige CPI-Ränge) sowie Namibia und Südafrika (mittlere CPI-Ränge) im Vergleich.
Welche Rolle spielen Medien und Zivilgesellschaft bei der Korruptionsbekämpfung?
Sie fungieren als externe Kontrolldeterminanten. Pressefreiheit und eine aktive Zivilgesellschaft können Korruption aufdecken und den politischen Druck zur Reform erhöhen.
Was sind interne Kontrolldeterminanten von Korruption?
Dazu gehören staatliche Strukturen, die Unabhängigkeit der Justiz und verwaltungsinterne Prüfmechanismen, die Korruption bereits im Entstehen verhindern sollen.
Welche internationalen Maßnahmen gibt es gegen Korruption?
Es gibt Abkommen der OECD, der UN und der Afrikanischen Union sowie Initiativen wie die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
- Citar trabajo
- Dipl. Volksw. Stefan Arndt (Autor), 2007, Erklärungsmöglichkeiten von Korruptionsniveaus in Afrika, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88320