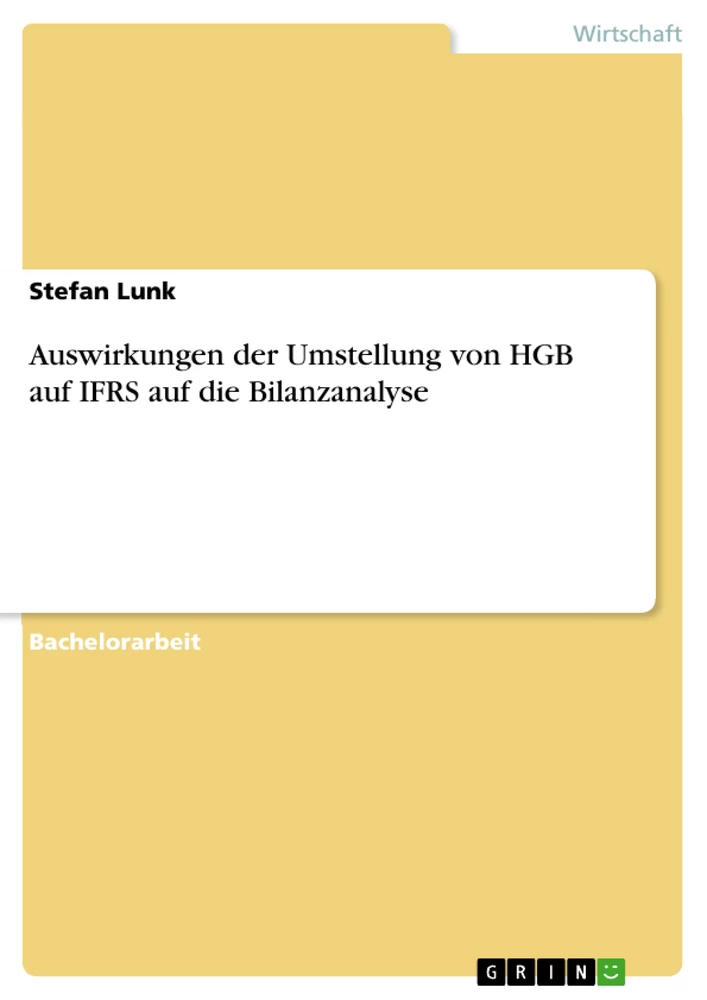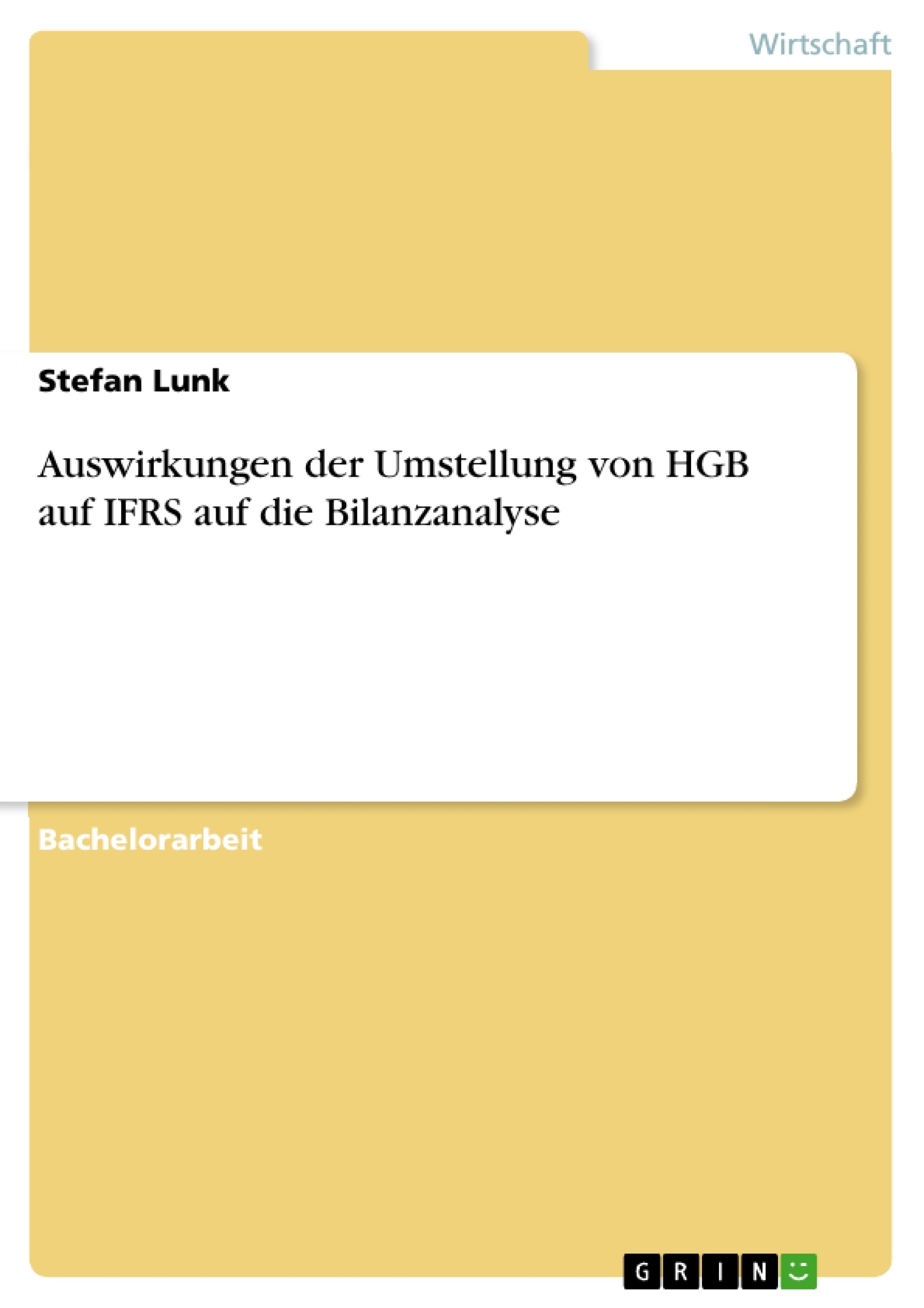Durch die zunehmende Globalisierung der Güter- und Kapitalmärkte wird auch die internationale Vergleichbarkeit von Unternehmensdaten immer wichtiger.
Beispielsweise benötigen potentielle Investoren vergleichbare Informationen über verschiedene Unternehmen um die zukünftigen Erfolgsaussichten realistisch einschätzen zu können. Durch die Anwendung verschiedener Rechnungslegungskonzepte können Unternehmen nicht unmittelbar miteinander verglichen werden, was u. a. zu einer Behinderung des Kapitalmarktes und Investitionsentscheidungen führt.
Auf Grund dessen müssen die meisten kapitalmarktorientierten Unternehmen seit 2005 ihre Konzernabschlüsse gemäß IFRS erstellen. Eine Ausnahme besteht für vorher nach US-GAAP bilanzierende Unternehmen, die erst seit 2007 nach IFRS bilanzieren müssen. Aber auch nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen haben mittlerweile gemäß § 315a Abs. 3 HGB ein Wahlrecht zur Aufstellung des Konzernabschlusses nach IFRS, wodurch in Zukunft die Anzahl der IFRS-Abschlüsse weiter steigen dürfte.
Wegen der unterschiedlichen Behandlung gleicher Sachverhalte in den Rechnungslegungssystemen kann die Anwendung der IFRS anstelle der HGB-Rechnungslegung Auswirkungen auf das Gesamtbild eines Unternehmens haben, welches durch die Bilanzanalyse ermittelt werden soll. Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Auswirkungen der unterschiedlichen Rechnungslegung auf wichtige Kennzahlen des Jahresabschlusses eines Unternehmens darzustellen. Um möglichst allgemeingültig zu bleiben wird hauptsächlich auf die Unterschiede im Einzelabschluss eingegangen und nur an geeigneter Stelle auf Bilanzierungsfragen im Konzernabschluss, wobei nur auf wesentliche Unterschiede eingegangen wird.
Es soll dargestellt werden, dass ein Bilanzanalytiker bei der Betrachtung zweier verschiedener Abschlüsse darauf zu achten hat, warum einzelne Posten der Bilanz und dadurch wichtige Kennzahlen beim direkten Vergleich eventuell einen anderen Wert aufweisen. Um das zu erreichen wird auf die Aufstellung einer Strukturbilanz verzichtet, damit die wesentlichen und erkennbaren Unterschiede nicht wieder eliminiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition Bilanzanalyse
- 2.2 Grundkonzeptionen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS
- 3. Wesentliche Unterschiede in der Rechnungslegung
- 3.1 Allgemeine Ansatzkriterien für Vermögenswerte und Schulden
- 3.1.1 Nach IFRS
- 3.1.2 Nach HGB
- 3.2 Sachanlagen
- 3.3 Immaterielle Vermögenswerte
- 3.4 Leasingverhältnisse
- 3.5 Finanzanlagen
- 3.5.1 Finanzinstrumente
- 3.5.2 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
- 3.6 Langfristige Fertigungsaufträge
- 3.7 Vorratsvermögen
- 3.8 Latente Steuern
- 3.9 Pensionsrückstellungen
- 3.10 Sonstige Rückstellungen
- 3.1 Allgemeine Ansatzkriterien für Vermögenswerte und Schulden
- 4. Auswirkungen auf die Analyse ausgewählter Kennzahlen
- 4.1 Analyse der Vermögenslage
- 4.1.1 Intensitätskennzahlen
- 4.1.2 Umschlagskoeffizienten
- 4.2 Analyse der Finanzlage
- 4.2.1 Eigen- und Fremdkapitalquote
- 4.2.2 Deckungsgrade
- 4.3 Analyse der Ertragslage
- 4.3.1 Eigenkapitalrentabilität
- 4.3.2 Umsatzrentabilität
- 4.1 Analyse der Vermögenslage
- 5. Darstellung der Auswirkungen anhand empirischer Untersuchungen
- 6. Fazit
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis befasst sich mit den Auswirkungen der Umstellung von HGB auf IFRS auf die Bilanzanalyse. Ziel ist es, die wesentlichen Unterschiede in der Rechnungslegung nach HGB und IFRS zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Berechnung und Interpretation von Bilanzkennzahlen aufzuzeigen.
- Definition und Bedeutung der Bilanzanalyse
- Grundkonzeptionen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS
- Wesentliche Unterschiede in der Rechnungslegung von HGB und IFRS
- Auswirkungen auf die Berechnung und Interpretation relevanter Bilanzkennzahlen
- Empirische Analyse der Auswirkungen der Umstellung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Bilanzanalyse im Kontext der Umstellung von HGB auf IFRS. Die Forschungsfrage und die Gliederung der Arbeit werden dargelegt.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Bilanzanalyse und die Grundkonzeptionen der Rechnungslegung nach HGB und IFRS. Dabei werden die jeweiligen Ziele und Prinzipien der beiden Rechnungslegungsstandards erläutert.
- Kapitel 3: Wesentliche Unterschiede in der Rechnungslegung
Kapitel 3 analysiert die wesentlichen Unterschiede in der Rechnungslegung nach HGB und IFRS, insbesondere hinsichtlich der Ansatzkriterien für Vermögenswerte und Schulden. Es werden verschiedene Bilanzpositionen wie Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Leasingverhältnisse und Finanzanlagen im Detail betrachtet.
- Kapitel 4: Auswirkungen auf die Analyse ausgewählter Kennzahlen
Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen der Unterschiede in der Rechnungslegung auf die Berechnung und Interpretation von ausgewählten Bilanzkennzahlen. Dabei werden Kennzahlen aus den Bereichen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage analysiert.
- Kapitel 5: Darstellung der Auswirkungen anhand empirischer Untersuchungen
In Kapitel 5 werden die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Analyse der Auswirkungen der Umstellung von HGB auf IFRS vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Auswirkungen der Umstellung von HGB auf IFRS auf die Bilanzanalyse. Wichtige Schlüsselwörter sind: Bilanzanalyse, HGB, IFRS, Rechnungslegung, Bilanzkennzahlen, Vermögenswerte, Schulden, Intensitätskennzahlen, Umschlagskoeffizienten, Eigenkapitalrentabilität, Umsatzrentabilität.
- Quote paper
- Stefan Lunk (Author), 2008, Auswirkungen der Umstellung von HGB auf IFRS auf die Bilanzanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88298