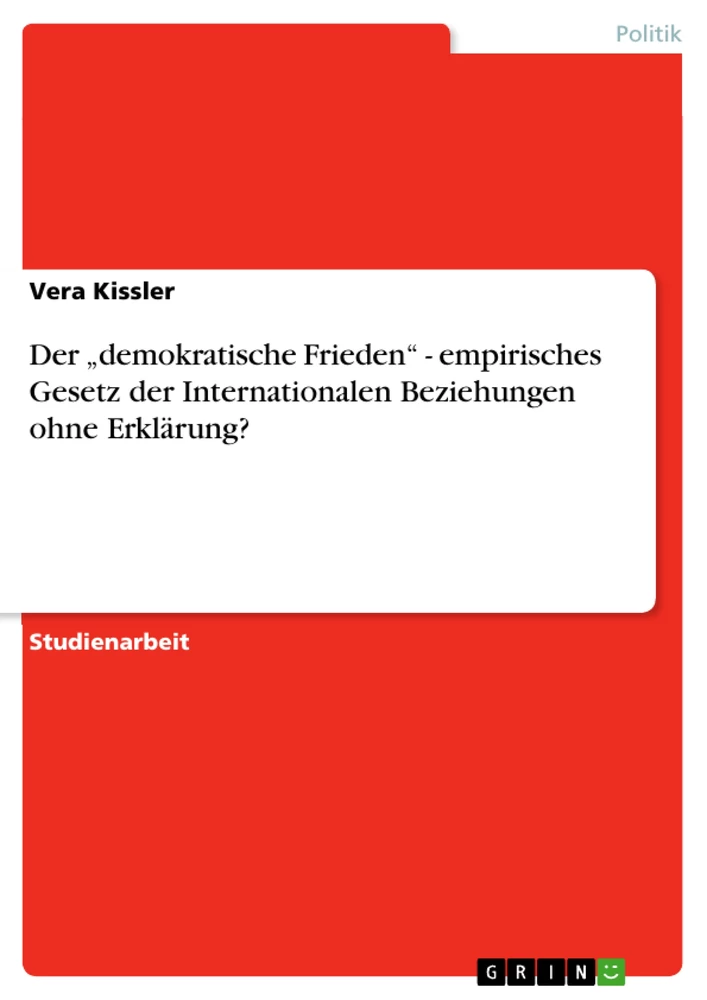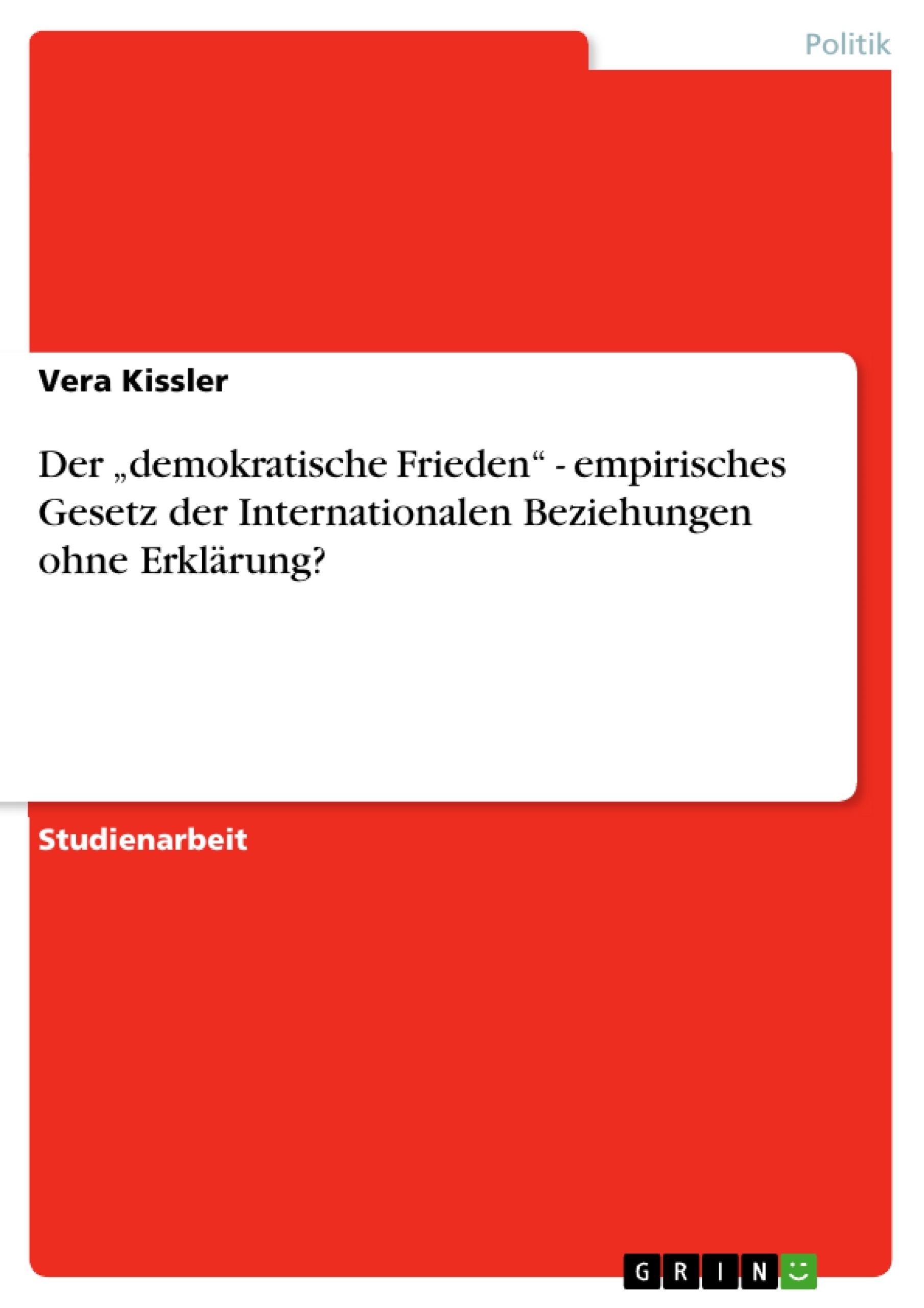Die These, dass Demokratien keinen Krieg gegeneinander führen, ist keinesfalls neu. So beruft sich die Forschung noch heute auf Immanuel Kants „Schrift zum ewigen Frieden“. Bemerkenswert ist aber, dass das Theorem erst in den 1980er Jahren gleichsam wiederentdeckt wurde, durch Michael W. Doyle (1983). Zuvor war herrschende Meinung, dass Demokratien nicht weniger gewaltbereit agierten als andere Staaten auch.
Mittlerweile ist jedoch allgemein anerkannt, dass es sich beim demokratischen Frieden um so etwas wie das „einzige empirische Gesetz der Internationalen Beziehungen“ (Jack S. Levy) handelt – wenngleich die Forschung naturgemäß nur probabilistische Aussagen machen kann. Der Forschung zum demokratischen Frieden kommt auch eine besondere praktische Bedeutung zu, wurde das Theorem doch in der amerikanischen Außenpolitik mit dem Ende des Kalten Kriegs popularisiert.
Der Befund des demokratischen Friedens hat sich in zahlreichen Untersuchungen als ausreichend robust erwiesen, sodass es nur noch wenig grundlegende Kritik daran gibt.
Nichtsdestotrotz bleibt seine Erklärung äußerst strittig, bzw. gibt es noch keine zufrieden stellende Erklärung. Die Debatte darüber wird in der „scientific community“ sehr differenziert geführt und es gibt eine Vielzahl von Studien. Daher verfolgt diese Arbeit das Ziel, auf kompilatorische Weise den Stand der Forschung darzustellen.
Dazu wird in einem ersten Schritt die monadische von der dyadischen Sichtweise auf den demokratischen Frieden abgegrenzt. Sodann folgt eine Darstellung der verschiedenen Erklärungsansätze für den demokratischen Frieden, die einerseits von der inneren Verfasstheit von Staaten, andererseits von ihrem Beziehungsgeflecht her argumentieren.
Eine Erklärung des Phänomens zu finden ist in der Tat unerlässlich, will man die Ursachen des demokratischen Friedens verstehen und sichergehen, dass es sich nicht um ein bloßes statistisches Artefakt handelt.
Dieser Unterstellung und anderen Ansätzen der Kritik am liberalen Forschungsprogramm zum demokratischen Frieden wird in einem abschließenden Kapitel nachgegangen. Dort wird auch eine Problematisierung der verwendeten Begrifflichkeiten von Demokratie, Frieden und Krieg vorgenommen. In einer Schlussbetrachtung wird der Stand der Forschung kritisch beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der Befund - zwei Sichtweisen auf den demokratischen Frieden
- 3 Klassische Erklärungen mit Blick auf die nationalstaatliche Ebene
- 3.1 Partizipation und Gewaltabneigung der Bürger
- 3.2 Demokratische Normen gewaltfreien Konfliktaustrags
- 3.3 Institutionalistische Argumentationen
- 4 Alternative Erklärungen mit Blick auf die Beziehungsebene
- 4.1 Internationale Organisationen als Friedensbünde
- 4.2 Ökonomische Interdependenz
- 5 Kritik am liberalen Forschungsprogramm
- 5.1 Ein statistisches Artefakt?
- 5.2 Demokratiespezifische Gewalt
- 5.3 Ein unscharfer Demokratiebegriff
- 5.4 Ein problematischer Friedens- bzw. Kriegsbegriff
- 6 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den Forschungsstand zum Thema „Demokratischer Frieden“ kompilatorisch darzustellen. Die Debatte um die Erklärung dieses Phänomens ist komplex und vielschichtig. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Erklärungsansätze und kritische Auseinandersetzungen damit.
- Das empirische Phänomen des demokratischen Friedens und seine verschiedenen Interpretationen (dyadisch vs. monadisch).
- Klassische und alternative Erklärungen des demokratischen Friedens auf nationaler und zwischenstaatlicher Ebene.
- Kritikpunkte am liberalen Forschungsprogramm zum demokratischen Frieden.
- Die Problematik der verwendeten Begrifflichkeiten (Demokratie, Frieden, Krieg).
- Die Bedeutung des demokratischen Friedens für die internationale Politik.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die These des demokratischen Friedens vor, die besagt, dass Demokratien keinen Krieg gegeneinander führen. Sie skizziert die historische Entwicklung der Forschung zu diesem Thema und hebt die Uneinigkeit über die Erklärung des Phänomens hervor. Die Arbeit wird als kompilatorische Darstellung des Forschungsstandes positioniert und die Unterscheidung zwischen monadischer und dyadischer Sichtweise auf den demokratischen Frieden wird als zentrale Fragestellung eingeführt.
2 Der Befund - zwei Sichtweisen auf den demokratischen Frieden: Dieses Kapitel befasst sich mit den beiden vorherrschenden Perspektiven auf den demokratischen Frieden: dem dyadischen Ansatz, der besagt, dass dieser nur zwischen Demokratien besteht, und dem monadischen Ansatz, der Demokratien generell als friedfertiger betrachtet. Das Kapitel diskutiert die Entwicklung der Forschung von einer primär dyadischen hin zu einer zunehmend monadischen Perspektive und beleuchtet die jeweiligen Argumente und empirischen Befunde. Die Schwierigkeit, den empirischen Befund eindeutig zu interpretieren, wird hervorgehoben. Es wird deutlich, dass die Unterscheidung zwischen beiden Ansätzen nicht immer trennscharf ist.
3 Klassische Erklärungen mit Blick auf die nationalstaatliche Ebene: Dieses Kapitel befasst sich mit den klassischen Erklärungen des demokratischen Friedens, die sich auf die innere Verfassung der Staaten konzentrieren. Es werden drei Hauptargumente vorgestellt: die Partizipation und Gewaltabneigung der Bürger, demokratische Normen gewaltfreien Konfliktaustrags und institutionalistische Argumentationen. Die Kapitel erklären, wie diese Faktoren zu einer geringeren Kriegsbereitschaft zwischen Demokratien beitragen sollen. Die Argumente werden differenziert und in ihrer Reichweite kritisch hinterfragt.
4 Alternative Erklärungen mit Blick auf die Beziehungsebene: Im Gegensatz zu Kapitel 3 werden hier alternative Erklärungen des demokratischen Friedens vorgestellt, die sich auf die Beziehungen zwischen Staaten konzentrieren. Das Kapitel untersucht den Einfluss internationaler Organisationen als Friedensbünde sowie den Einfluss ökonomischer Interdependenz. Die Argumentation erläutert, wie diese Faktoren die Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen Demokratien reduzieren. Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Erklärungen werden analysiert.
5 Kritik am liberalen Forschungsprogramm: Dieses Kapitel widmet sich der Kritik am liberalen Forschungsprogramm zum demokratischen Frieden. Es werden verschiedene Einwände untersucht, darunter die Möglichkeit, dass der demokratische Frieden ein statistisches Artefakt ist, die Existenz demokratiespezifischer Gewalt, die Unschärfe des Demokratiebegriffs und ein problematischer Friedens- bzw. Kriegsbegriff. Die Kapitel hinterfragt die grundlegenden Annahmen des liberalen Ansatzes und diskutiert die methodischen und konzeptuellen Herausforderungen der Forschung.
Schlüsselwörter
Demokratischer Frieden, Dyadischer Ansatz, Monadischer Ansatz, Klassische Erklärungen, Alternative Erklärungen, Internationale Beziehungen, Demokratie, Autokratie, Krieg, Frieden, Liberalismus, Empirische Forschung, Statistische Artefakte, Institutionalismus, Ökonomische Interdependenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Demokratischer Frieden"
Was ist das zentrale Thema des Dokuments?
Das Dokument behandelt den Forschungsstand zum Thema "Demokratischer Frieden". Es untersucht die These, dass Demokratien seltener Krieg gegeneinander führen, beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze und deren Kritikpunkte.
Welche unterschiedlichen Perspektiven auf den demokratischen Frieden werden betrachtet?
Es werden der dyadische Ansatz (Krieg zwischen Demokratien unwahrscheinlich) und der monadische Ansatz (Demokratien generell friedlicher) unterschieden und verglichen. Die Arbeit diskutiert die Vor- und Nachteile beider Perspektiven und die Schwierigkeiten, den empirischen Befund eindeutig zu interpretieren.
Welche klassischen Erklärungen für den demokratischen Frieden werden genannt?
Klassische Erklärungen auf nationaler Ebene fokussieren auf: die Partizipation und Gewaltabneigung der Bürger, demokratische Normen gewaltfreien Konfliktaustrags und institutionalistische Argumentationen. Diese sollen die geringere Kriegsbereitschaft zwischen Demokratien erklären.
Welche alternativen Erklärungen für den demokratischen Frieden werden präsentiert?
Alternative Erklärungen auf zwischenstaatlicher Ebene konzentrieren sich auf: den Einfluss internationaler Organisationen als Friedensbünde und den Einfluss ökonomischer Interdependenz als Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen Demokratien reduzieren.
Welche Kritikpunkte am liberalen Forschungsprogramm zum demokratischen Frieden werden angesprochen?
Die Kritik umfasst die Möglichkeit, dass der demokratische Frieden ein statistisches Artefakt ist, die Existenz demokratiespezifischer Gewalt, die Unschärfe des Demokratiebegriffs und die Problematik der verwendeten Friedens- und Kriegsbegriffe. Methodische und konzeptionelle Herausforderungen der Forschung werden diskutiert.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in: Einleitung, Der Befund - zwei Sichtweisen auf den demokratischen Frieden, Klassische Erklärungen mit Blick auf die nationalstaatliche Ebene, Alternative Erklärungen mit Blick auf die Beziehungsebene, Kritik am liberalen Forschungsprogramm und Schlussfolgerungen. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Dokuments?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Demokratischer Frieden, Dyadischer Ansatz, Monadischer Ansatz, Klassische Erklärungen, Alternative Erklärungen, Internationale Beziehungen, Demokratie, Autokratie, Krieg, Frieden, Liberalismus, Empirische Forschung, Statistische Artefakte, Institutionalismus, Ökonomische Interdependenz.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, den Forschungsstand zum Thema "Demokratischer Frieden" kompilatorisch darzustellen und die verschiedenen Erklärungsansätze sowie deren kritische Auseinandersetzungen zu beleuchten.
- Quote paper
- Vera Kissler (Author), 2007, Der „demokratische Frieden“ - empirisches Gesetz der Internationalen Beziehungen ohne Erklärung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88289