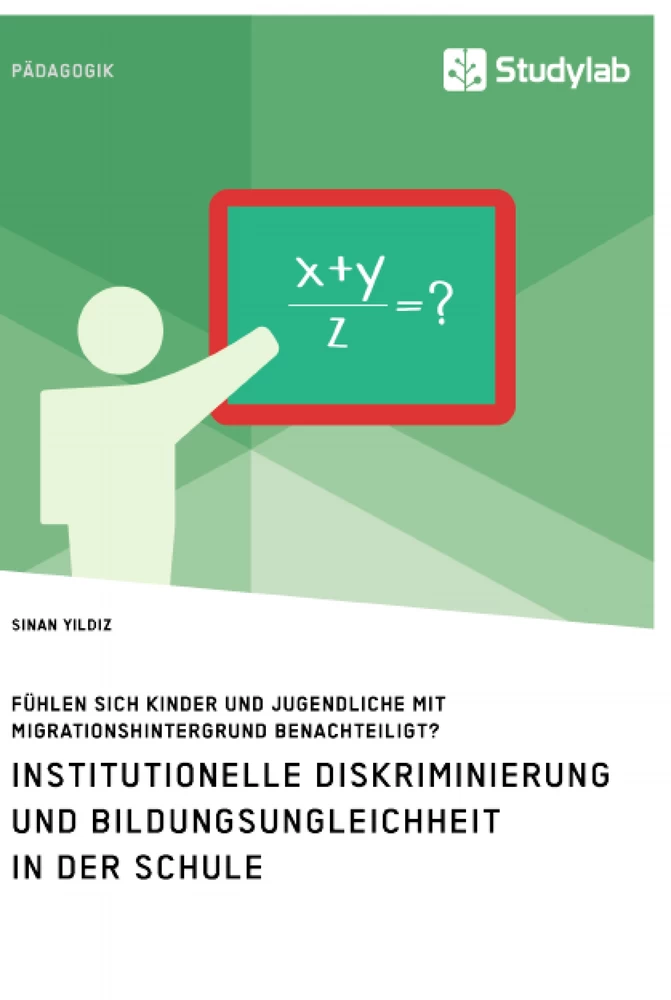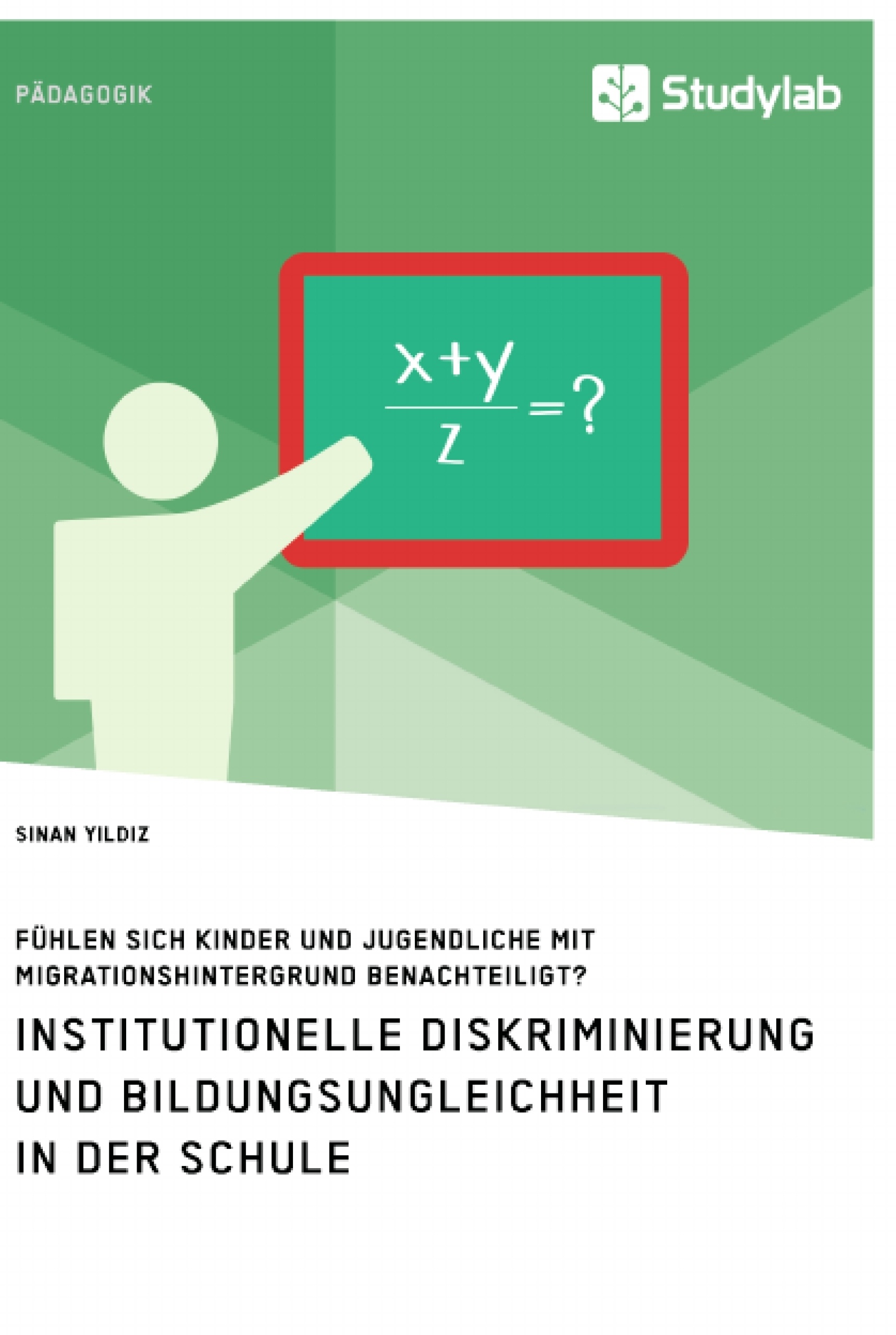Das deutsche Grundgesetz verbietet es, Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer Sprache ungleich zu behandeln. Studien decken jedoch Unterschiede in den Bildungschancen auf, die unter anderem mit dem Migrationshintergrund zusammenhängen. Doch fühlen sich Schülerinnen und Schüler im deutschen Bildungssystem wirklich diskriminiert oder benachteiligt?
Grundsätzlich entwickeln Kinder bereits im Alter von sechs bis acht Jahren einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sinan Yildiz untersucht deshalb in seiner Publikation, ob Diskriminierung in Schulen noch immer gegenwärtig ist und wie Schülerinnen und Schüler die aktuelle Situation wahrnehmen. Seinen Fokus legt er auf die Erfahrungen von Lernenden mit Migrationshintergrund.
Dazu stellt er die Entwicklung von Migration und Bildung seit 1945 dar und geht auf verschiedene Zuwanderungsgruppen in Deutschland ein. Anschließend setzt er sich mit den Gründen für eine mögliche Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund auseinander. Sein Buch erklärt, wie institutionelle Diskriminierung funktioniert und welche Auswirkung diese Mechanismen auf das Empfinden der betroffenen Schülerinnen und Schüler haben.
Aus dem Inhalt:
- Integration;
- Bildungsgerechtigkeit;
- Bildungsungleichheit;
- soziale Herkunft;
- Chancengleichheit
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugend" Versuch einer Definition
- ,,Adoleszenz“ – Begriffsbestimmung
- Migration und Bildung in Deutschland seit 1945
- Zuwanderungsgruppen in Deutschland
- Ursachen und Gründe von und für Migration
- Bildungsbe(nach) teiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und Zuwanderungshintergrund
- Soziale Disparitäten im deutschen Bildungssystem (PISA-Studie)
- Diskriminierung
- Institutionelle Diskriminierung
- Mögliche Präventionsmaßnahmen
- Empirische Erhebung
- Quantitative Forschungsmethode
- Erhebungsmethode
- Rahmenbedingungen
- Aufbau/Konzipierung des Fragebogens
- Durchführung der Befragung
- Auswertung der Ergebnisse
- Interpretation der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Thematik der institutionellen Diskriminierung und Bildungsungleichheit in der Schule. Sie untersucht, ob Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sich benachteiligt fühlen und beleuchtet die Gründe und Auswirkungen dieser Diskriminierung.
- Institutionelle Diskriminierung im Bildungssystem
- Bildungsbe(nach) teiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Soziale Disparitäten im deutschen Bildungssystem
- Empirische Erhebung zur Diskriminierungserfahrung von Schülern mit Migrationshintergrund
- Mögliche Präventionsmaßnahmen gegen Diskriminierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung definiert die Begriffe „Jugend“ und „Adoleszenz“ und führt in die Thematik der institutionellen Diskriminierung und Bildungsungleichheit ein.
- Migration und Bildung in Deutschland seit 1945: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Zuwanderung in Deutschland, analysiert die Ursachen und Gründe von Migration und untersucht die Bildungsbe(nach) teiligung von Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und Zuwanderungshintergrund. Es wird auch auf die PISA-Studie und ihre Erkenntnisse zu sozialen Disparitäten im deutschen Bildungssystem eingegangen.
- Diskriminierung: Das Kapitel definiert den Begriff der Diskriminierung, insbesondere die institutionelle Diskriminierung, und zeigt mögliche Präventionsmaßnahmen auf.
- Empirische Erhebung: Dieses Kapitel beschreibt die quantitative Forschungsmethode, die Erhebungsmethode und die Rahmenbedingungen der empirischen Studie. Es werden der Aufbau und die Konzipierung des Fragebogens sowie die Durchführung und Auswertung der Befragung erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen institutionelle Diskriminierung, Bildungsungleichheit, Migrationshintergrund, PISA-Studie, empirische Forschung und Präventionsmaßnahmen. Die Arbeit beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen von Diskriminierung im Bildungssystem und erforscht die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund.
- Arbeit zitieren
- Sinan Yildiz (Autor:in), 2020, Institutionelle Diskriminierung und Bildungsungleichheit in der Schule. Fühlen sich Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund benachteiligt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/882603