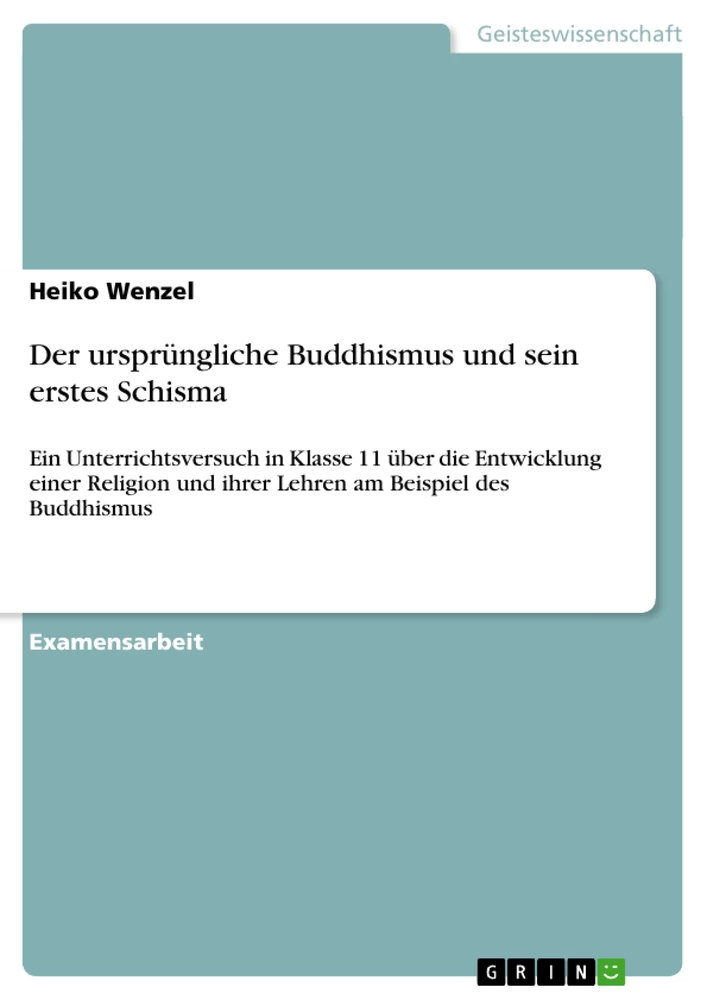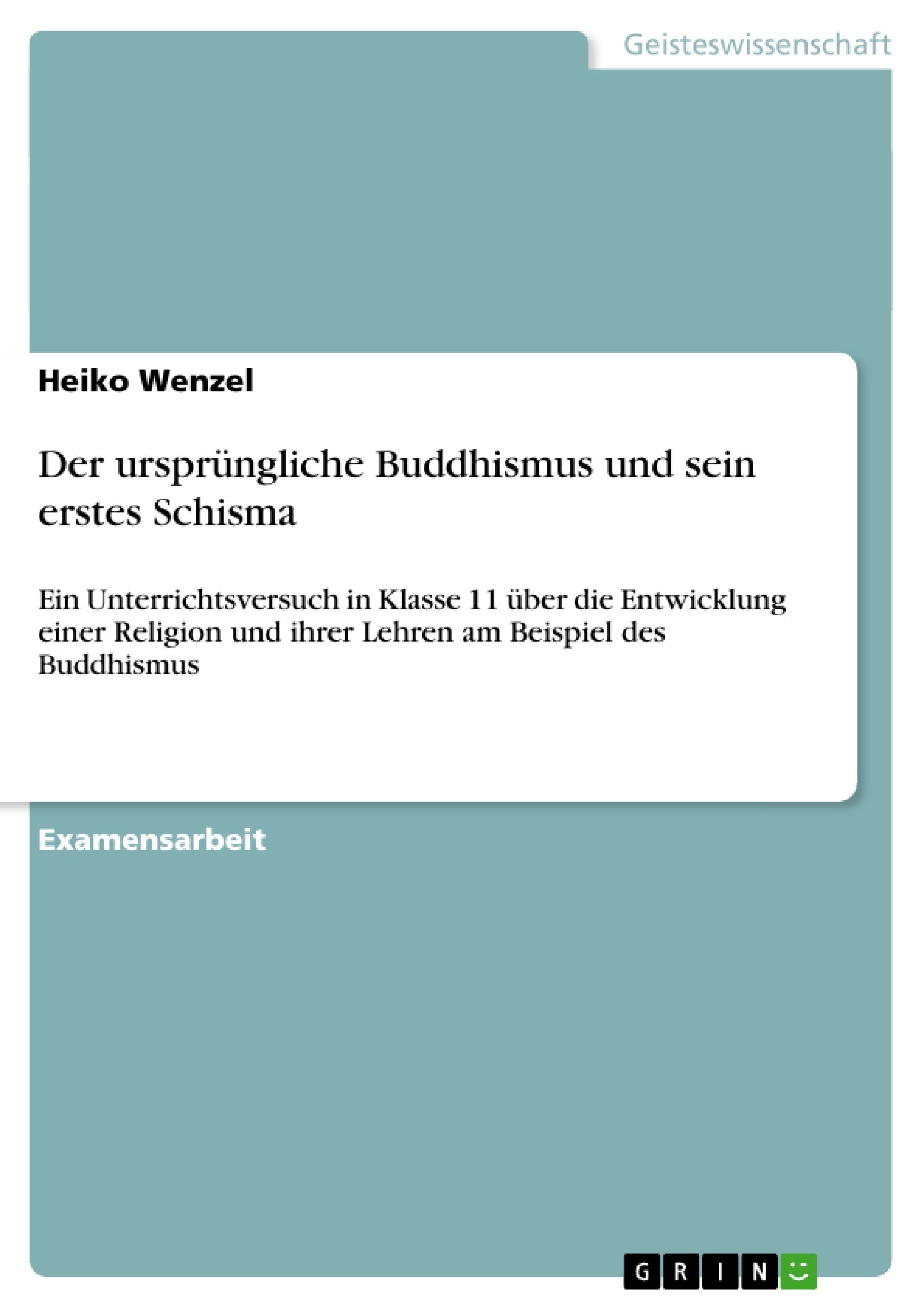Die praktische und theoretische Lehre des ursprünglichen Budhismus (Hauptteil); Schismen in Buddhismus, Islam und Christentum mit Hintergründen und Auswirkungen; didaktische Analyse; Anhang mit Text / Textauszügen; genaue Darstellung ausgewählter Unterrichtsstunde mit Verlaufsplan und Reflektion;
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Motivation
- Sachanalyse
- Vorbemerkung
- Der ursprüngliche Buddhismus
- Quellen
- Buddha
- Dharma
- Sangha
- Das erste Schisma
- Schismen in Christentum und Islam
- Didaktische Analyse
- Bedingungsanalyse
- Äußere Rahmenbedingungen
- Klassenanalyse
- Legitimation durch den Bildungsplan
- Didaktische Schwerpunkte und Konzeption der Unterrichtseinheit
- Die Textarbeit
- Bedingungsanalyse
- Dokumentation der Unterrichtseinheit
- Aufbau der Unterrichtseinheit
- Übersicht
- Dokumentationen und Evaluationen ausgewählter Stunden
- 3.4. Stunde (09.11.2007): Die erste edle Wahrheit
- 5. Stunde (16.11.2007): Die zweite edle Wahrheit
- 11. 12. Stunde (07.12.2007): Schismen in Christentum, Islam und Buddhismus
- Beschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dokumentiert eine Unterrichtseinheit zum ursprünglichen Buddhismus und seinem ersten Schisma für die 11. Klasse eines Gymnasiums. Ziel ist es, die Entwicklung einer Religion und ihrer Lehren am Beispiel des Buddhismus zu verdeutlichen und den Schülern einen vergleichenden Einblick in die Geschichte des Buddhismus, des Christentums und des Islams zu geben. Die Schüler sollen lernen, ethische und metaphysische Aspekte der verschiedenen Religionen zu reflektieren und zu vergleichen.
- Der ursprüngliche Buddhismus und seine zentralen Lehren (Buddha, Dharma, Sangha).
- Das erste Schisma im Buddhismus und seine Ursachen.
- Vergleich des Buddhismus mit dem Christentum und dem Islam hinsichtlich Toleranz und Gewalt.
- Die Bedeutung des Pali-Kanons als Quelle für die Erforschung des ursprünglichen Buddhismus.
- Didaktische Konzeption und Umsetzung der Unterrichtseinheit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Motivation: Die Einleitung beleuchtet die anhaltende Popularität des Buddhismus im Vergleich zu sinkenden Mitgliederzahlen christlicher Kirchen. Sie hebt die buddhistische Toleranz gegenüber Andersgläubigen hervor und kontrastiert sie mit den gewalttätigen Aspekten anderer Religionen, die aus dem Glauben an einen Schöpfergott resultieren. Die Einleitung betont die Herausforderungen bei der Übersetzung zentraler buddhistischer Begriffe und die Motivation, die Schüler mit den Lehren des Buddhismus vertraut zu machen, indem sie Stärken und Schwächen verschiedener Religionen im Vergleich beleuchten.
Sachanalyse: Vorbemerkung: Dieser Abschnitt erklärt die Verwendung von Sanskrit-Begriffen statt Pali-Begriffen im Text aufgrund der gängigen Praxis in Deutschland und in der verwendeten Literatur.
Sachanalyse: Der ursprüngliche Buddhismus: Dieses Kapitel beschreibt den Pali-Kanon als Hauptquelle für das Verständnis des ursprünglichen Buddhismus. Es erläutert die Entstehung des Kanons, die Rolle der Mönchskonzilien und die Unterteilung in drei Pitakas (Vinayapitaka, Suttapitaka, Abhidhammapitaka). Der Abschnitt geht auf die Person Buddhas (Siddhartha Gautama) ein, seine Herkunft, sein Leben vor und nach der Erleuchtung, und die historische Einbettung seines Lebens in das Kastenwesen und den vedischen Opferkult.
Sachanalyse: Das erste Schisma: Obwohl nur ein kurzer Überblick über das erste Schisma gegeben wird, legt dieser Abschnitt die Grundlage für den Vergleich mit Schismen in anderen Religionen wie Christentum und Islam. Die Kapitel behandelt die Bedeutung dieses Ereignisses in der Geschichte des Buddhismus.
Didaktische Analyse: Dieses Kapitel behandelt die didaktische Planung und Durchführung der Unterrichtseinheit. Es umfasst die Bedingungsanalyse (äußere Rahmenbedingungen und Klassenanalyse), die Legitimation durch den Bildungsplan und die didaktischen Schwerpunkte, insbesondere den Fokus auf die Textarbeit.
Dokumentation der Unterrichtseinheit: Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau und die Übersicht der Unterrichtseinheit. Wichtiger ist die detaillierte Dokumentation und Evaluation ausgewählter Stunden, die Einblicke in den Ablauf und die Schülerreaktionen gibt. Die einzelnen Stunden werden jedoch hier nicht einzeln zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Ursprünglicher Buddhismus, Pali-Kanon, Buddha, Dharma, Sangha, erstes Schisma, Christentum, Islam, Vergleichende Religionswissenschaft, Didaktik, Ethikunterricht, Toleranz, Gewalt, Karma, Nirvana.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsarbeit: Ursprünglicher Buddhismus und sein erstes Schisma
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit dokumentiert eine Unterrichtseinheit zum ursprünglichen Buddhismus und seinem ersten Schisma für die 11. Klasse eines Gymnasiums. Sie umfasst eine Einleitung, eine Sachanalyse (mit Fokus auf den ursprünglichen Buddhismus und das erste Schisma), eine didaktische Analyse der Unterrichtseinheit sowie eine detaillierte Dokumentation und Evaluation ausgewählter Unterrichtsstunden. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Themen werden im Rahmen der Sachanalyse behandelt?
Die Sachanalyse behandelt den ursprünglichen Buddhismus, inklusive Quellen (Pali-Kanon), Buddha, Dharma und Sangha. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem ersten Schisma im Buddhismus und dessen Ursachen, wobei Vergleiche mit Schismen im Christentum und Islam gezogen werden. Der Pali-Kanon wird als Hauptquelle für das Verständnis des ursprünglichen Buddhismus ausführlich erläutert.
Wie wird der ursprüngliche Buddhismus in der Arbeit dargestellt?
Der ursprüngliche Buddhismus wird anhand des Pali-Kanons beschrieben, mit Erläuterungen zur Entstehung des Kanons, der Rolle der Mönchskonzilien und seiner Unterteilung in drei Pitakas (Vinayapitaka, Suttapitaka, Abhidhammapitaka). Die Person Buddhas (Siddhartha Gautama), seine Herkunft, sein Leben und seine Einbettung in das damalige gesellschaftliche Gefüge werden ebenfalls thematisiert.
Welche didaktischen Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die didaktische Analyse umfasst die Bedingungsanalyse (äußere Rahmenbedingungen und Klassenanalyse), die Legitimation der Unterrichtseinheit durch den Bildungsplan und die didaktischen Schwerpunkte, insbesondere den Fokus auf die Textarbeit. Die Planung und Durchführung der Unterrichtseinheit werden detailliert beschrieben.
Wie ist die Dokumentation der Unterrichtseinheit aufgebaut?
Die Dokumentation der Unterrichtseinheit beinhaltet den Aufbau und die Übersicht der Einheit. Der Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Dokumentation und Evaluation ausgewählter Stunden, die Einblicke in den Ablauf und die Schülerreaktionen geben. Konkrete Beispiele umfassen Stunden zur ersten und zweiten edlen Wahrheit sowie zu Schismen in verschiedenen Religionen.
Welche Ziele verfolgt die Unterrichtseinheit?
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, die Entwicklung einer Religion und ihrer Lehren am Beispiel des Buddhismus zu verdeutlichen und einen vergleichenden Einblick in die Geschichte des Buddhismus, des Christentums und des Islams zu geben. Die Schüler sollen ethische und metaphysische Aspekte verschiedener Religionen reflektieren und vergleichen lernen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Ursprünglicher Buddhismus, Pali-Kanon, Buddha, Dharma, Sangha, erstes Schisma, Christentum, Islam, Vergleichende Religionswissenschaft, Didaktik, Ethikunterricht, Toleranz, Gewalt, Karma und Nirvana.
Was ist die Motivation hinter dieser Arbeit?
Die Arbeit ist motiviert durch den Vergleich der anhaltenden Popularität des Buddhismus mit sinkenden Mitgliederzahlen christlicher Kirchen. Die buddhistische Toleranz wird im Kontrast zu gewalttätigen Aspekten anderer Religionen, die aus dem Glauben an einen Schöpfergott resultieren, hervorgehoben. Die Übersetzungsschwierigkeiten zentraler buddhistischer Begriffe und der Wunsch, die Schüler mit den Lehren des Buddhismus vertraut zu machen, bilden weitere Motivationsfaktoren.
Welche Religionsvergleiche werden angestellt?
Die Arbeit vergleicht den Buddhismus mit dem Christentum und dem Islam, insbesondere hinsichtlich Toleranz und Gewalt, und nutzt das erste Schisma im Buddhismus als Vergleichsgrundlage für Schismen in anderen Religionen.
- Quote paper
- Heiko Wenzel (Author), 2008, Der ursprüngliche Buddhismus und sein erstes Schisma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88224