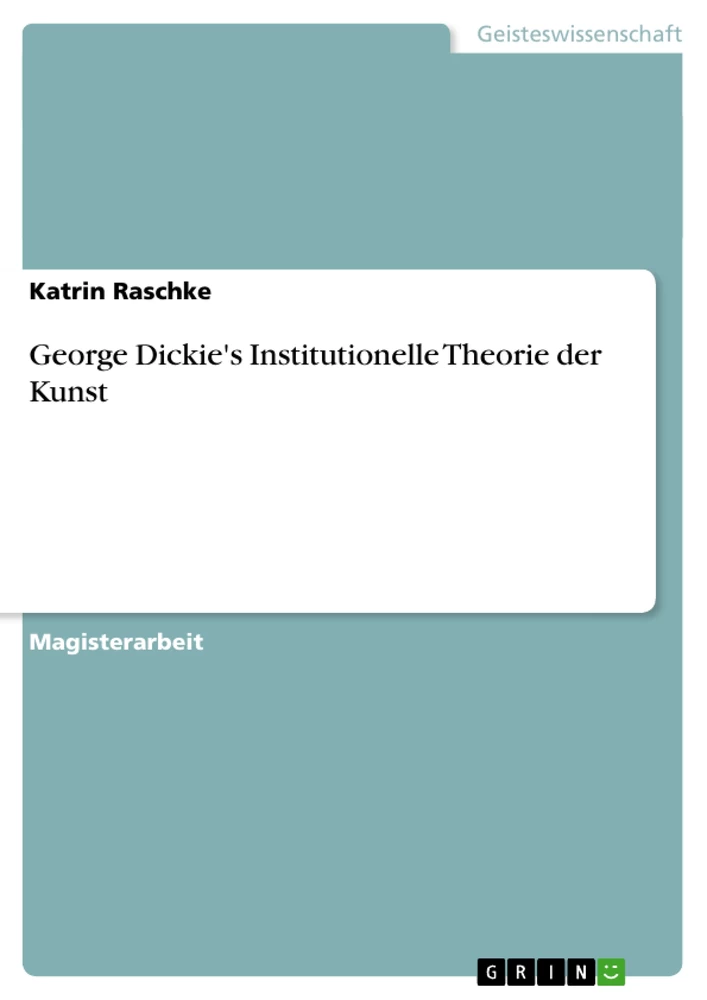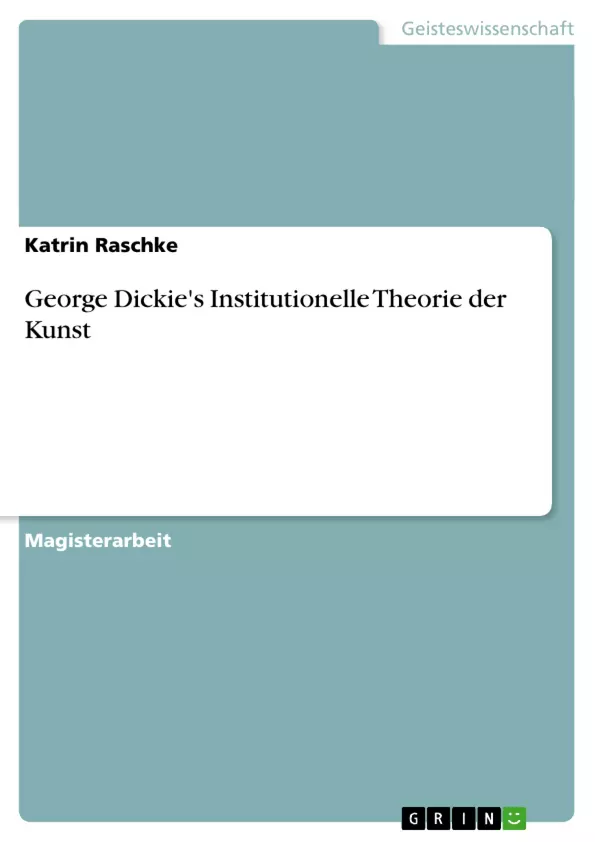Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelt der Philosoph George Dickie (*1926) die hier im Mittelpunkt stehende Institutionelle Theorie der Kunst. Ihr zufolge zeichnet sich ein Kunstwerk dadurch aus, dass es in einen ganz bestimmten institutionellen Rahmen, den Dickie in Anlehnung an Arthur Danto als „Kunstwelt“ bezeichnet, eingebettet ist bzw. eine ganz bestimmte Rolle innerhalb dieses Rahmens spielt.
Genau so wie ein Blatt mit fünf gleichfarbigen Karten von Zehn bis Ass nur vor dem Hintergrund eines Pokerspiels ein „Royal Flush“ ist, genau so soll es sich laut Dickie bei einem bestimmten Artefakt wie zum Beispiel bei einer bemalten Leinwand, einem Buch oder einem Musikstück nur dann um Kunst handeln, wenn es vor dem Hintergrund der Kunstwelt hergestellt wurde. Heißt es in Dickies erster Version (1969/1974) noch, dass etwas genau dann ein Kunstwerk ist, wenn es ein Artefakt ist, dass von jemandem – in der Regel dem Künstler selbst – im Namen der Kunstwelt einen bestimmten Status verliehen bekommen hat, bedeutet dies in Dickies zweiter und aktueller Version (1984), dass etwas genau dann ein Kunstwerk ist, wenn es von einem verständigen Künstler für die Präsentation vor einem verständigen Kunstwelt-Publikum hergestellt wurde.
Auch wenn Dickies Institutionstheorie – zumindest was den angelsächsischen Raum betrifft – im Großen und Ganzen zunächst einmal auf Zustimmung traf, wurden im Laufe der Jahre mehrere Einwände gegen diese vorgebracht, die auch durch Dickies zweite Version nicht entkräftet werden konnten. Ziel meiner Arbeit ist es, die meiner Meinung nach am meisten verbreiteten und stichhaltigsten Einwände zu klassifizieren und anschließend, wenn möglich, zu widerlegen.
Bevor ich jedoch im dritten Kapitel die Einwände gegen Dickies Kunsttheorie darstelle, werde ich im ersten Kapitel eine kurze historische und inhaltliche Einführung in das Thema geben. Anschließend erläutere ich im zweiten Kapitel, was genau unter Dickies Institutioneller Kunsttheorie zu verstehen ist. Um diese besser nachvollziehen zu können, beschränke ich mich hierbei nicht auf die Darstellung der aktuellen Version von Dickies Kunsttheorie (1984), sondern stelle zunächst die ursprüngliche Version (1969/1974) und deren zentrale Kritik, die zu der jetzigen Version führte, vor.
Inhaltsverzeichnis
- Historische und inhaltliche Einführung
- Der Bereich der Kunst
- Der Definitionsskeptizismus
- Die Institutionelle Theorie der Kunst
- George Dickies Institutionelle Theorie der Kunst
- Die erste Version
- Definition von „Kunst“
- Kritik an der ersten Version
- Die zweite Version
- Der ,,Kunst Zirkel“
- Einwände
- Erklärt Dickies Kunstdefinition, warum etwas ein Kunstwerk ist?
- Ist Dickies Kunstdefinition elitär bzw. anti-demokratisch?
- Schließt Dickies Kunstdefinition Kreativität aus?
- Ist Dickies Kunstdefinition relativistisch?
- Ist Dickies Kunstdefinition zirkulär?
- Gutartig und bösartig zirkuläre Definitionen
- Ist Dickies Kunstdefinition zu eng?
- Ist Dickies Kunstdefinition zu weit?
- „Kunstwelt\" als indexikalischer Ausdruck.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Institutionelle Theorie der Kunst von George Dickie zu analysieren und ihre Stärken und Schwächen zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Kritik an der Theorie, wobei die wichtigsten Einwände gegen Dickies Definition von Kunst im Fokus stehen.
- Die Definition von Kunst im Kontext der Institutionellen Theorie
- Die Rolle der "Kunstwelt" in der Definition von Kunstwerken
- Die Kritik an Dickies Theorie, insbesondere die Frage nach ihrer Eignung zur Erklärung von Kunst außerhalb der Kunstwelt
- Die Frage nach der Relativität und Zirkelhaftigkeit der Theorie
- Die Debatte um die Einordnung von Kunst in einen institutionellen Kontext und die Grenzen dieser Einordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine historische und inhaltliche Einführung in das Thema der Kunstdefinition und stellt den Kontext für Dickies Theorie dar. Es beleuchtet den Definitionsskeptizismus und die Entwicklung der Institutionellen Theorie der Kunst.
Das zweite Kapitel widmet sich der Darstellung von Dickies Institutioneller Theorie der Kunst, wobei sowohl die erste als auch die zweite Version der Theorie ausführlich beleuchtet werden. Die Definition von "Kunst" im Sinne von Dickie wird erläutert, die zentrale Rolle der "Kunstwelt" wird hervorgehoben und die Übertragung des Status eines Anwärters für Wertschätzung im Namen der Kunstwelt wird analysiert.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den wichtigsten Einwänden gegen Dickies Kunstdefinition. Es werden Argumente gegen die Eignung der Theorie zur Erklärung von Kunstwerken und ihre möglichen Auswirkungen auf die Bewertung von Kunst diskutiert. Die Frage nach der Relativität und Zirkelhaftigkeit der Theorie wird ebenfalls thematisiert, und es wird beleuchtet, ob Dickies Definition zu eng oder zu weit gefasst ist.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Institutionellen Theorie der Kunst von George Dickie. Die zentralen Themen sind die Definition von Kunst, die Rolle der Kunstwelt, die Kritik an der Theorie, die Frage nach der Relativität und Zirkelhaftigkeit, sowie die Einordnung von Kunst in einen institutionellen Kontext. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind: Artefaktizität, Wertschätzung, Definitionsskeptizismus, Kunstbegriff, Kunstwelt, Institution, Kunstdefinition, Einwände, Kritik.
- Arbeit zitieren
- Katrin Raschke (Autor:in), 2008, George Dickie's Institutionelle Theorie der Kunst, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88066