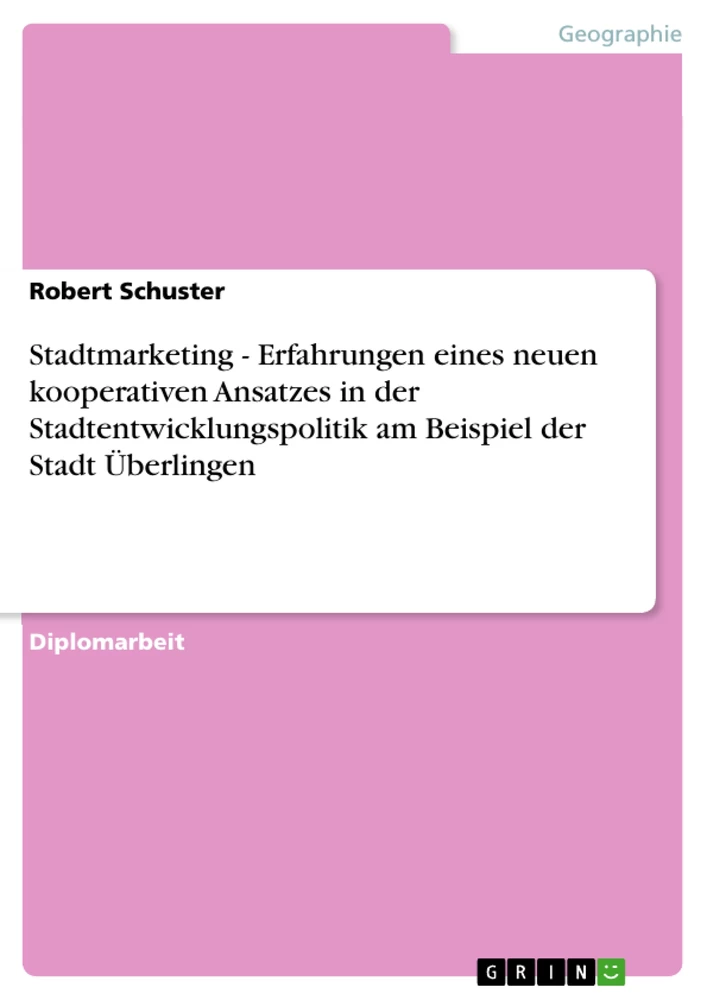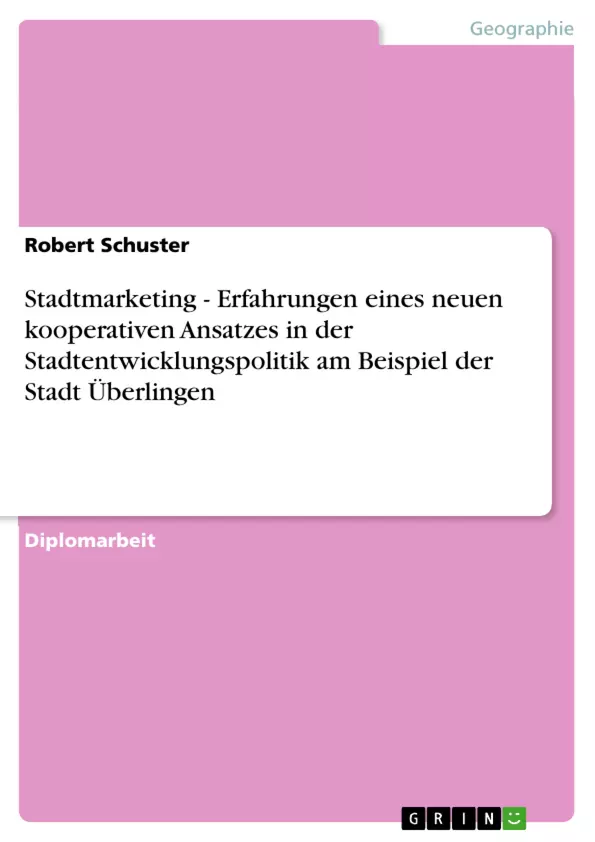1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
Eine Innovation erfaßt immer mehr Städte in Deutschland: es geht um neue Begriffe wie Stadtmarketing oder Citymanagement. Was Ende der Achtziger mit einzelnen Stadtmarketingprojekten in Städten wie Frankenthal, Schweinfurt oder Wuppertal begann, soll heute auch immer mehr anderen Städten, vor allem den mittleren und kleineren Kommunen, zur zukunftsträchtigen Entwicklung verhelfen. Der Begriff Stadtmarketing hat Hochkonjunktur: die Zahl der Veröffentlichungen steigt stetig an, Beratungsfirmen widmen sich zunehmend dem wachsenden Markt, veranstalten Tagungen und Symposien zu diesem Thema und erstellen kostspielige Konzepte für interessierte Kommunen. Je mehr sich Städte mit diesen Ansätzen um eine Entwicklung ihrer Stadt „am Markt“ bemühen, desto größer wird selbstverständlich auch für die anderen Kommunen der Zugzwang, sich neuer erfolgversprechender Strategien zu bedienen, um im Nullsummenspiel der interkommunalen Konkurrenz nicht plötzlich als Verlierer dazustehen.
Was steckt nun hinter diesen neuen Begriffen wie Stadtmarketing oder Citymanagement? Handelt es sich nur um geschickte wirtschaftsrhetorische Umschreibungen für bestehende Stadt-entwicklungsplanung oder Wirtschaftsförderung, um „alten Wein in neuen Schläuchen“? Oder ist die traditionelle Stadtentwicklungspolitik tatsächlich in Bewegung geraten und versucht mit neuartigen Konzepten auf die geänderten kommunalen Rahmenbedingungen zu reagieren? Trotz zahlreicher Projekte und wissenschaftlicher Veröffentlichungen besteht nach wie vor ein großer Bedarf an empirischen Untersuchungen, um die Bedeutung von Stadtmarketing zu bewerten.
Ziel der vorliegenden Arbeit soll somit sein, einen kleinen Teil dieses Forschungsdefizites abzubauen. Dies soll jedoch weder dadurch geschehen, daß ein lückenloser Überblick über die gesamt vorliegende Literatur wiedergegeben wird, noch daß versucht wird, alle Stadtmarketingprojekte in Deutschland (oder einer anderen Raumeinheit) zu untersuchen und somit einen Stand der Ausbreitung dieser Innovation zu bestimmen. Vielmehr ist beabsichtigt, anhand einer Fallstudie die Erfahrungen, Möglichkeiten und Grenzen dieses neuen Ansatzes konkret aufzuzeigen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Empirisches Vorgehen und methodische Grundlagen
- 2.1 Forschungsbedarf...
- 2.2 Vorgehen und methodische Begründung......
- 3 Einordnung des Themas in den theoretischen Hintergrund
- 3.1 Stadtmarketing als postfordistisches Phänomen….
- 3.1.1 Regulationstheoretischer Ansatz.
- 3.1.2 Der lokale Staat.....
- 3.1.3 Der lokale Raum im Postfordismus
- 3.2 Planungskultur in den Neunzigern.…….…………..\n
- 4 Stadtmarketing: Entwicklungen und Inhalte
- 4.1 Gründe für das Aufkommen von Stadtmarketing.
- 4.1.1 Interkommunale Konkurrenz....
- 4.1.2 Komplexität und Differenziertheit innerkommunaler Aufgaben und Prozesse.
- 4.1.3 Demokratiebewußtsein und Verwaltungsverdrossenheit…..\n
- 4.2 Vielzahl von Definitionen und Erfahrungen
- 4.3 Von der Absatzwirtschaft zum ganzheitlichen Stadtmarketing
- 4.3.1 Entwicklung des Marketingbegriffes.….......
- 4.3.2 Unterschiede zwischen einem Unternehmen und einer Stadt..\n
- 4.3.3 Formen des Stadtmarketing..\n
- 4.3.3.1 Pauschaltransfer von betriebswirtschaftlichen Marketingdenken auf die Stadt..\n
- 4.3.3.2 Stadtmarketing als Werbestrategie.\n
- 4.3.3.3 Stadtmarketing als projektbezogene Kooperation.\n
- 4.3.3.4 Stadtmarketing als Dienstleistungsmarketing.\n
- 4.3.3.5 Stadtmarketing als politische Neuinterpretation.\n
- 4.3.4 Einordnung bestehender Interpretationen .\n
- 4.4 Stadtmarketing als „kommunikative Stadtentwicklungspolitik“.\n
- 4.5 Frage zur Begrifflichkeit..\n
- 5 Kennzeichen typischer Stadtmarketingprojekte\n
- 5.1 Vorreiterstädte in Sachen Stadtmarketing und Citymanagement\n
- 5.2 Vorgehensweise bei Stadtmarketingprojekten.\n
- 5.2.1 Problemdruck und Initiierung\n
- 5.2.2 Organisationsform....\n
- 5.2.3 Ablaufphasen.\n
- 5.2.3.1 Situationsanalyse..\n
- 5.2.3.2 Leitbildentwicklung...\n
- 5.2.3.3 Maßnahmenfestsetzung.\n
- 5.2.3.4 Umsetzung, Erfolgskontrolle.\n
- 5.3 Chancen und Risiken\n
- 5.3.1 Chancen\n
- 5.3.2 Risiken.\n
- 6 Fallstudie Überlingen am Bodensee.\n
- 6.1 Empirisches Vorgehen..\n
- 6.1.1 Inhaltsanalyse..\n
- 6.1.2 Teilnehmende Beobachtung..\n
- 6.1.3 Leitfadeninterviews\n
- 6.1.4 Schriftliche Anfragen bei Nachbarstädten.\n
- 6.2 Charakteristik von Überlingen....\n
- 6.3 Projektverlauf .\n
- 6.3.1 Anfangssituation...\n
- 6.3.2 Situationsanalyse und Befragungen\n
- 6.3.3 Leitbilddiskussion.\n
- 6.3.4 Arbeitskreisphase.\n
- 6.3.5 Jetzige Situation..\n
- 6.4 Bewertung...\n
- 6.4.1 Versuch einer Klassifizierung der verschiedenen Meinungen….\n
- 6.4.2 Erfolge\n
- 6.4.3 Defizite..\n
- 6.4.4 Bewertung durch die Nachbarstädte.\n
- 6.4.5 Zusammenfassende Bewertung...\n
- 6.5 Empfehlungen für das Projekt Überlingen..\n
- 6.5.1,,Bewußtsein schaffen“..\n
- 6.5.2,,Motivator stärken“.\n
- 6.5.3,,Vorgehen bekannt machen“.\n
- 6.5.4,,Begriff Stadtmarketing relativieren“.\n
- 6.5.5,,Erarbeitete Erkenntnisse beachten und neue Ideen entwickeln“.\n
- 7 Zusammenfassung\n
- 7.1 Verallgemeinerungen.....\n
- 7.2 Fazit....\n
- Entwicklung und Hintergründe des Stadtmarketings
- Theoretische Ansätze und Konzepte des Stadtmarketings
- Kooperativer Ansatz im Stadtmarketing und seine Relevanz
- Erfahrungen und Herausforderungen des Stadtmarketing-Projekts in Überlingen
- Bewertung und Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Stadtmarketings
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung von Stadtmarketing in Deutschland. Sie untersucht die Hintergründe, Ziele und Strategien des neuen kooperativen Ansatzes im Stadtmarketing und analysiert die Erfahrungen eines konkreten Projekts in Überlingen am Bodensee.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit ein. Es beleuchtet die Relevanz des Themas Stadtmarketing im Kontext der Stadtentwicklungspolitik und erläutert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 stellt das empirische Vorgehen und die methodischen Grundlagen der Arbeit dar, einschließlich der Forschungsbedürfnisse und der methodischen Begründung. Kapitel 3 ordnet das Thema Stadtmarketing in den theoretischen Hintergrund ein, indem es den Zusammenhang mit dem Postfordismus, dem lokalen Staat und dem lokalen Raum beleuchtet. Es betrachtet außerdem die Planungskultur in den Neunzigern. Kapitel 4 analysiert die Entwicklungen und Inhalte des Stadtmarketings, die Gründe für sein Aufkommen und die Vielzahl der bestehenden Definitionen und Erfahrungen. Es untersucht verschiedene Formen des Stadtmarketings, von der Absatzwirtschaft zum ganzheitlichen Stadtmarketing, und bewertet bestehende Interpretationen. Kapitel 5 beschreibt die Kennzeichen typischer Stadtmarketingprojekte, die Vorgehensweise bei der Projektplanung und Umsetzung, sowie die Chancen und Risiken des Stadtmarketings. Schließlich präsentiert die Arbeit in Kapitel 6 eine Fallstudie zum Stadtmarketingprojekt in Überlingen am Bodensee. Hier werden das empirische Vorgehen, die Charakteristik von Überlingen, der Projektverlauf und die Bewertung des Projekts detailliert analysiert. Außerdem werden Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Projekts in Überlingen gegeben.
Schlüsselwörter
Stadtmarketing, kooperativer Ansatz, Stadtentwicklungspolitik, Postfordismus, lokaler Staat, Planungskultur, Überlingen, Fallstudie, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Stadtmarketing?
Stadtmarketing zielt darauf ab, die Stadt als attraktiven Standort für Bewohner, Wirtschaft und Tourismus zu positionieren und die interkommunale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Ist Stadtmarketing nur Werbung für eine Stadt?
Nein, moderneres Stadtmarketing wird als „kommunikative Stadtentwicklungspolitik“ verstanden, die projektbezogene Kooperationen und ganzheitliche Planung umfasst.
Welche Erfahrungen wurden in Überlingen gemacht?
Die Fallstudie Überlingen zeigt den Projektverlauf von der Situationsanalyse über die Leitbilddiskussion bis hin zur praktischen Umsetzung in Arbeitskreisen auf.
Was sind typische Phasen eines Stadtmarketingprojekts?
Typische Phasen sind die Initiierung bei Problemdruck, die Situationsanalyse, die Leitbildentwicklung, die Maßnahmenfestsetzung sowie die Umsetzung und Erfolgskontrolle.
Welche Risiken birgt Stadtmarketing?
Risiken bestehen in einer rein werblichen Oberflächlichkeit, mangelnder Bürgerbeteiligung oder der Enttäuschung von Erwartungen, wenn Ressourcen fehlen.
- Citar trabajo
- Robert Schuster (Autor), 1996, Stadtmarketing - Erfahrungen eines neuen kooperativen Ansatzes in der Stadtentwicklungspolitik am Beispiel der Stadt Überlingen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/88