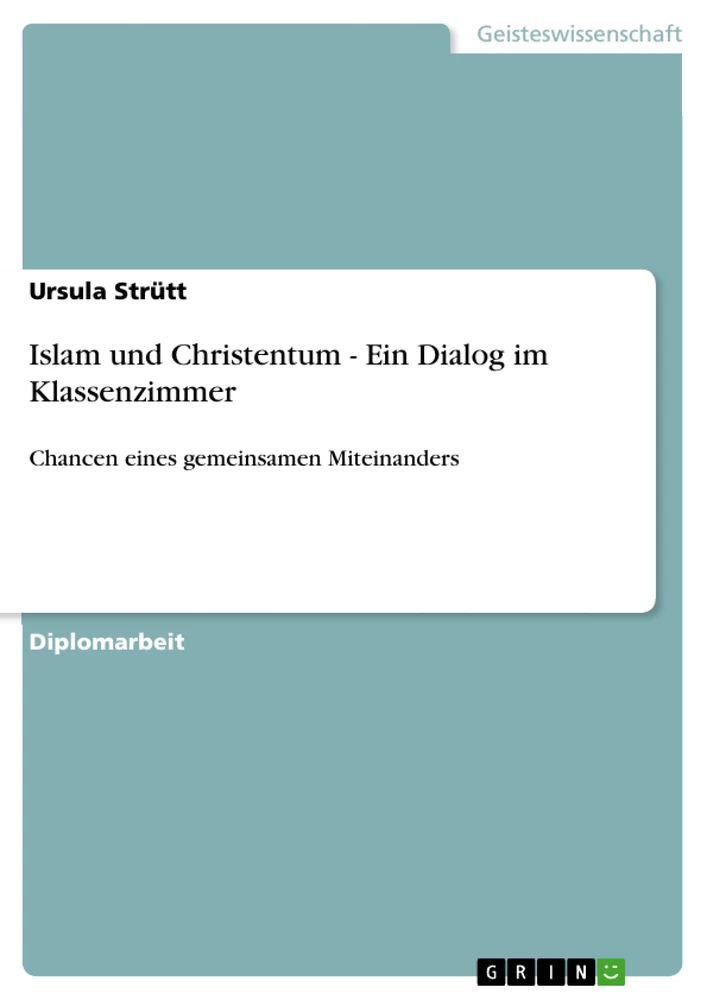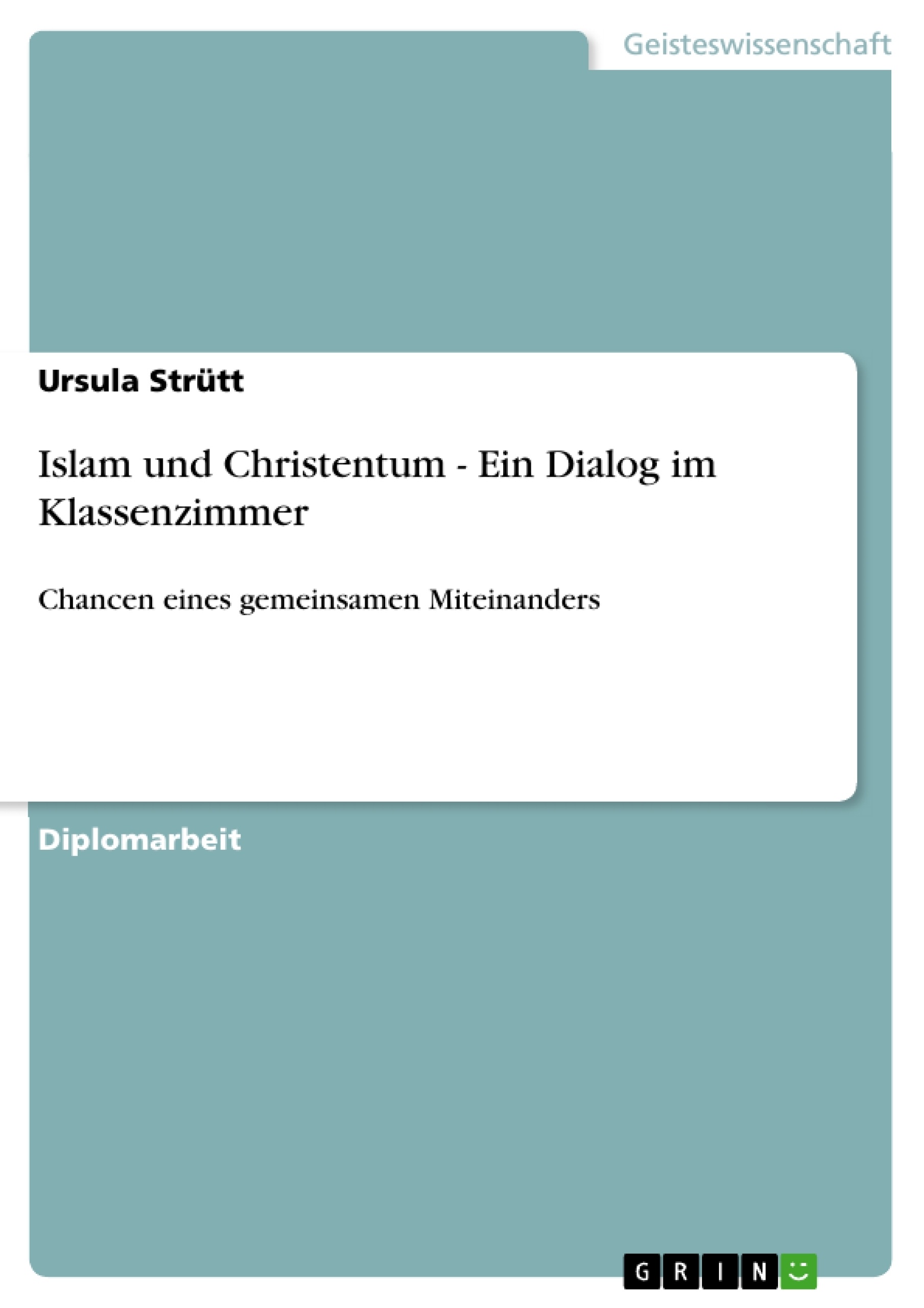Wie beeinflusst der Glaube, die Religion – Christentum und Islam - das Leben und das Verhalten der Menschen? Was sagen diese beiden Religionen übereinander?
Ich denke, die Kenntnis über die jeweils andere Religion, ihre Werte und die Auswirkungen der jeweiligen Lehren auf das konkrete, praktische Leben, kann ein erster Schritt zu einem friedlichen Miteinander sein. Dazu bedarf es eines Dialogs zwischen den beiden Religionen, der Gott sei Dank, oder sollte man sagen, Allah zum Dank, in letzter Zeit von beiden Seiten immer stärker forciert wird.
Um Missverständnisse auszuräumen, ist es notwendig zuerst einen genaueren Blick auf Probleme, Schwierigkeiten und Unterschiede zu werfen.
Für ein gelungenes Zusammenleben sind sicherlich die Gemeinsamkeiten beider Religionen wichtige Ausgangspunkte der Diskussion. Grundlage dafür könnten – neben den theologischen Inhalten - die Allgemeinen Menschenrechte und gemeinsame ethische Grundanliegen sein.
Gerade die Kinder- und Jugendarbeit kann eine gute Ausgangsbasis bilden für ein friedliches, tolerantes und sich gegenseitig befruchtendes Miteinander, nach dem volkstümlichen Sprichwort: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Theoretischer Teil
- Islam und Christentum im Spannungsfeld der Zeit
- I. Allgemeines
- 1. Islam - ein vielschichtiger Begriff
- 2. Zielgruppe der Arbeit
- 3. Integration
- 4. Religion und das Verhalten des Menschen
- Exkurs: Sind religiöse Menschen toleranter?
- 5. Christentum über Islam
- a. Vergangenheit
- b. Papst Gregor VII.
- c. Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils
- d. Gegenwart
- 6. Islam über Christentum
- a. Geschichte
- b. Aussagen im Koran
- c. Stellungnahmen neuerer Zeit
- 7. Gemeinsame Abstammung: Abraham
- a. Judentum
- b. Christentum
- c. Islam
- d. Greenberg: Der offene Bund
- e. Muslimisches Beziehungsdenken
- f. Abrahamische Ökumene
- g. Abrahamische Spiritualität
- II. Schwierigkeiten
- 1. Theologische Diskrepanzen
- a. Heilige Bücher
- b. Figur des Jesus Christus
- c. Zentrale Lehre
- 2. Fundamentalismus
- III. Lösungsansätze
- 1. Objektive Information
- 2. Dialog
- a. Verschiedene Ebenen
- b. Babylonisches Sprachgewirr
- 3. Verantwortung für die Welt: Eine gemeinsame Ethik
- a. Allgemeines
- Allgemeine Menschenrechte
- Weltethos
- b. Praktische Umsetzung
- B. Praktische Umsetzung
- I. Situation in Österreich
- 1. Statistiken
- 2. Rechtliche Situation
- 3. Jugend und Religion
- a. Individualisierte Religiosität
- b. Erlebnisorientierte Religiosität
- c. Biographische Religiosität
- 4. Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit
- 5. Wilhelm Heitmeyer: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
- II. Interreligiöses Lernen
- 1. Akzeptanz
- 2. Musik
- 3. Feste
- 4. Ansatzpunkte für die Arbeit mit Jugendlichen
- III. Vorhandene Modelle des Miteinanders in oberösterreichischen Bildungseinrichtungen
- 1. Kindergarten
- 2. Schule
- 3. Außerschulische Projekte
- 4. Resümee
- IV. Entwurf eines Konzeptes für ein fächerübergreifendes Projekt in der Berufsschule
- 1. Ausgangslage
- 2. Ziele
- a. Auszüge aus den Lehrplänen
- b. Projektziele
- 3. Projektdurchführung
- a. Allgemeines
- b. Themen
- c. Inhalte
- Zusammenfassung
- Literaturliste
- Herausforderungen und Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs in der Schule
- Theologische Diskrepanzen und Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum
- Integration und Multikulturalität im österreichischen Kontext
- Entwicklung eines Konzeptes für ein fächerübergreifendes Projekt zur Förderung des interreligiösen Lernens
- Interkulturelle Kompetenz und die Rolle der Bildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik des Dialogs zwischen Islam und Christentum im Kontext der Schule. Das Ziel der Arbeit ist es, Chancen eines gemeinsamen Miteinanders aufzuzeigen und Lösungsansätze für Herausforderungen im multikulturellen Schulalltag zu erarbeiten. Die Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Perspektiven des Islams und Christentums auf zentrale Themen wie die Heilige Schrift, die Figur Jesu und das Verhältnis von Religion und Gesellschaft. Dabei werden sowohl historische Entwicklungen als auch aktuelle Herausforderungen beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Diplomarbeit vor und beleuchtet die Bedeutung des interreligiösen Dialogs im heutigen Schulalltag. Der theoretische Teil befasst sich mit den Grundlagen des Islams und Christentums, beleuchtet historische Entwicklungen und zentrale Unterschiede zwischen beiden Religionen, und analysiert die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Religion und Gesellschaft. Im Abschnitt "Lösungsansätze" werden verschiedene Möglichkeiten für einen konstruktiven Dialog zwischen Islam und Christentum im Schulkontext aufgezeigt. Der praktische Teil befasst sich mit der Situation in Österreich, analysiert die Integrationsprozesse und stellt verschiedene Modelle des Miteinanders in oberösterreichischen Bildungseinrichtungen vor. Zum Abschluss wird ein Konzept für ein fächerübergreifendes Projekt in der Berufsschule entwickelt, das als Grundlage für die Förderung des interreligiösen Lernens dienen soll.
Schlüsselwörter
Islam, Christentum, Interreligiöser Dialog, Integration, Multikulturalität, Schule, Religionsunterricht, Konfliktlösung, Toleranz, respektvolles Miteinander, Konzeptentwicklung, fächerübergreifendes Projekt, Österreich, Bildungseinrichtungen.
- Quote paper
- Ursula Strütt (Author), 2007, Islam und Christentum - Ein Dialog im Klassenzimmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87944