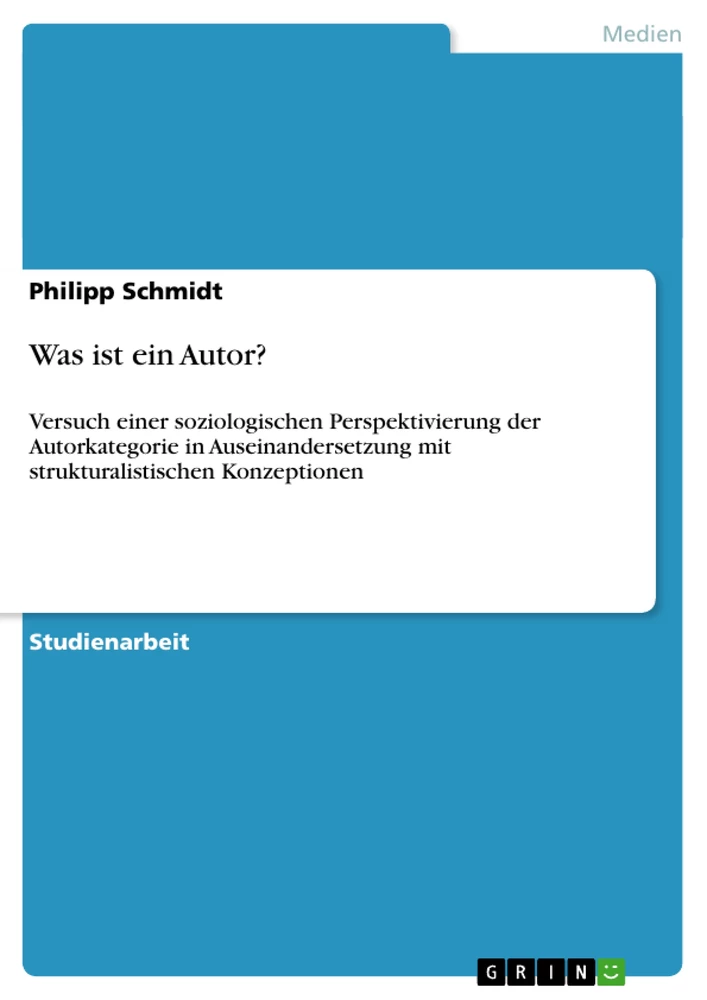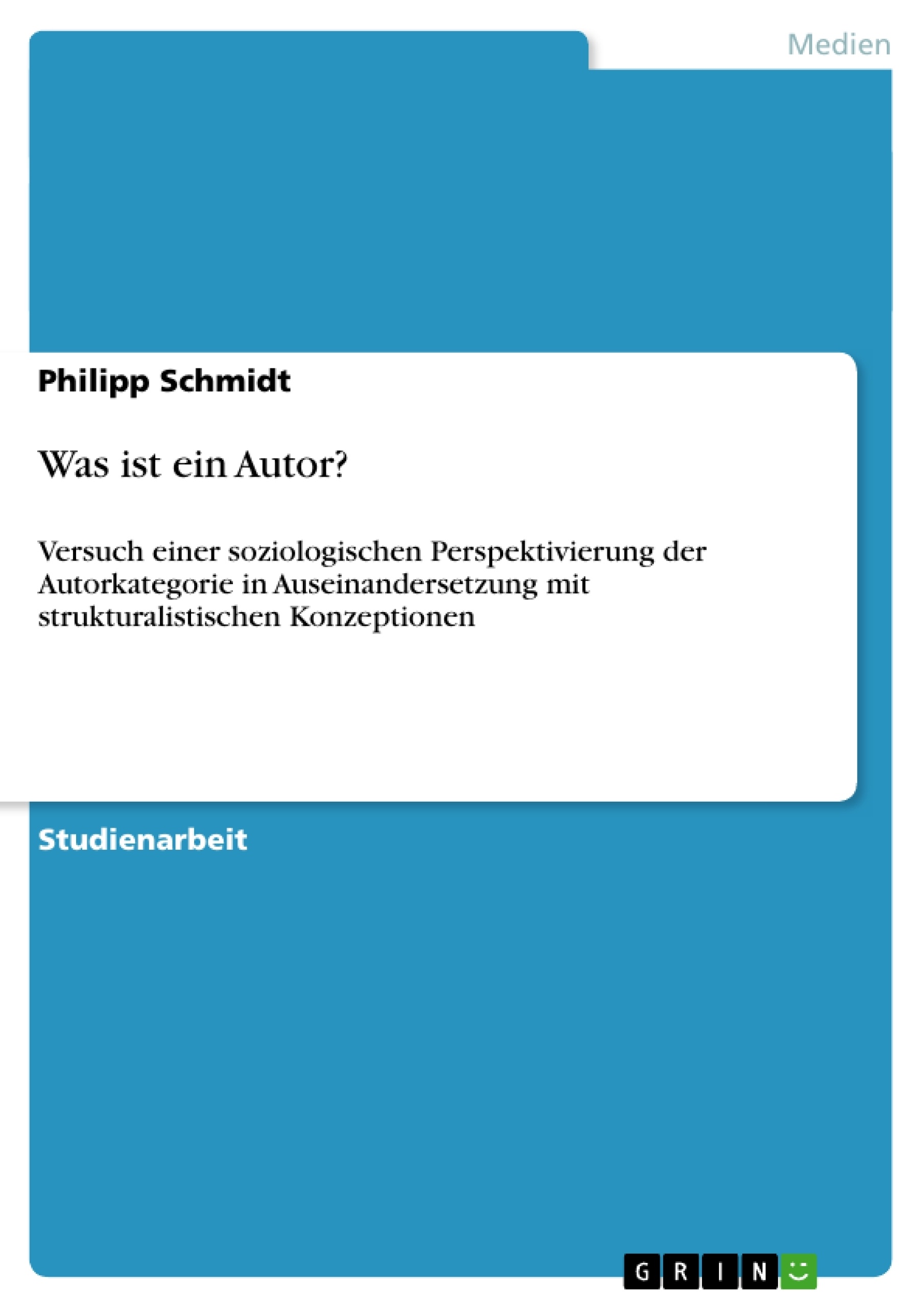Der Autor begegnet uns im diskursiven Raum literaturtheoretischer Auseinandersetzungen als eine höchst zwielichtige Gestalt. Er scheint verdächtig, vermittelt der Beiklang seines Namens doch gemeinhin das Bild des sich autonom wähnenden schöpferischen Subjekts, ruft sein Auftreten Assoziationen bezüglich eines quasi von naturhaften Impulsen getriebenen Genies hervor- begriffliche Assoziationen, die nicht zuletzt ihre historische Wirkmächtigkeit einer mit religiöser Symbolik aufgeladenen Mystifizierung verdanken.
Und dennoch, trotz vermeintlich unzeitgemäßer Bedeutungszuschreibungen, hat der Autor bis heute all die Angriffe, Denunziationen und Todesdrohungen, die man ihm gegenüber zur Geltung brachte, nahezu schadlos überstanden. Er scheint in seiner schattenhaften Gestalt nicht greifbar zu sein, und dies möglicherweise gerade deshalb, weil der Autor an einer Schnittstelle sein Dasein fristet, an einem Grenzort existiert, an dem, so ließe sich paradox formulieren, keiner mehr redet, obwohl einer spricht. Sich innerhalb der Kämpfe, die sich um die Figur des Autors entzünden, klar zu positionieren, die scheinbar uneinnehmbare Festung der Autorschaft entweder zu verteidigen, oder sich aber an ihrer andauernden Belagerung zu beteiligen, ist aus meiner Perspektive eine uneinlösbare Forderung.
Es verlangt gewiss einiges an Gespür in jenen Irrgärten, die um die Figur des Autors herum sich aufbauen, Orientierung zu finden. Ein erster und unabdingbarer Grundsatz dieses Unterfangens besteht meiner Ansicht nach vor allem darin, jene Kategorie stets in ihrer Ambivalenz zu begreifen. Dies zu leisten wird sich die vorliegende Arbeit immer wieder selbst vergewissern müssen.
In einem ersten Teil werde ich eine Annäherung an den Autorbegriff unternehmen, die sich in der Perspektive zweier einflussreicher diskursiver Positionen entwickeln soll. Hier wird es mir nicht zuletzt darum gehen in der Auseinandersetzung mit den Texten Roland Barthes und Michel Foucaults, das Terrain für eine weiterführende Auseinandersetzung mit der Autorthematik vorzubereiten.
In einem zweiten Teil möchte ich eine spezifische Perspektive auf die Kategorie des Autors entwickeln, die jenen in seinen sozialen Vermittlungsverhältnissen begreift. Zu diesem Zweck sollen die Arbeiten des Soziologen Pierre Bourdieu herangezogen und im Bezug auf die hier behandelte Thematik spezifiziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Autor als Strukturkategorie bei Roland Barthes und Michel Foucault
- Die strukturalistische Dekonstruktion des Autors (Roland Barthes)
- Der Autor als Diskursfunktion (Michel Foucault)
- Der Autor als soziales Phänomen: Eine Annäherung
- Der Autor als Naturverhältnis - Eine Abgrenzung
- Die Konstitution des legitimen Sprechers (Pierre Bourdieu )
- Der Autor als Sonderfall des legitimen Sprechers
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Autorbegriff aus verschiedenen Perspektiven und hinterfragt die Rolle des Autors im Diskurs. Sie analysiert die strukturalistische Dekonstruktion des Autors bei Roland Barthes und die poststrukturalistische Sichtweise Michel Foucaults, die den Autor als Diskursfunktion begreift.
- Die Dekonstruktion des Autors als schöpferisches Subjekt
- Der Autor als Produkt sozialer und diskursiver Strukturen
- Die Bedeutung von Macht und Autorität in der Konstruktion des Autors
- Der Autor als Funktionsträger in unterschiedlichen Diskursfeldern
- Die Ambivalenz des Autorbegriffs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Autorbegriff als eine umstrittene Kategorie, die im diskursiven Raum literaturtheoretischer Auseinandersetzungen eine ambivalente Gestalt einnimmt. Es wird auf die historische Entwicklung des Autorbegriffs und die Bedeutung seiner Mystifizierung eingegangen.
Das zweite Kapitel stellt zwei einflussreiche Positionen zur Dekonstruktion des Autors vor: die strukturalistische Dekonstruktion bei Roland Barthes und die poststrukturalistische Sichtweise Michel Foucaults. Es werden die zentralen Argumente beider Autoren sowie ihre Auswirkungen auf die literaturwissenschaftliche Debatte analysiert.
Das dritte Kapitel fokussiert auf den Autor als soziales Phänomen und untersucht seine Konstitution im Kontext gesellschaftlicher Strukturen und Machtverhältnisse. Hier wird auf die Arbeiten des Soziologen Pierre Bourdieu zurückgegriffen und die Bedeutung des Autors als legitimer Sprecher im sozialen Raum erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Autorbegriff, der strukturalistischen und poststrukturalistischen Dekonstruktion, der Rolle des Autors als Diskursfunktion und Machtträger, der Konstitution des Autors im sozialen Raum sowie der Bedeutung von Legitimität und Autorität in der Konstruktion des Autors.
- Arbeit zitieren
- Philipp Schmidt (Autor:in), 2008, Was ist ein Autor?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87869