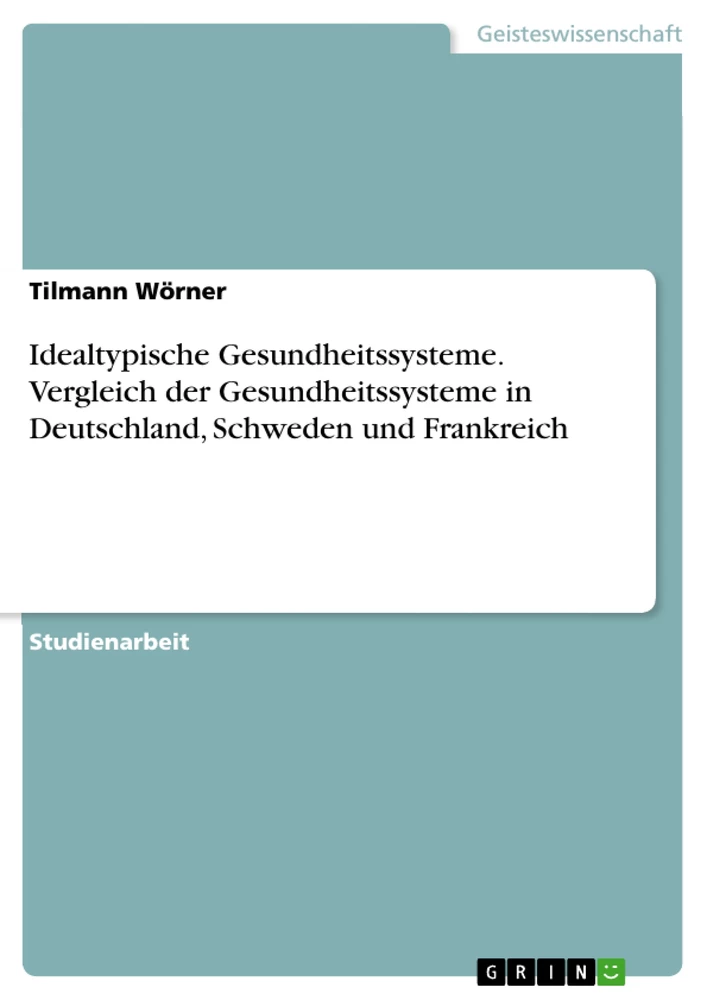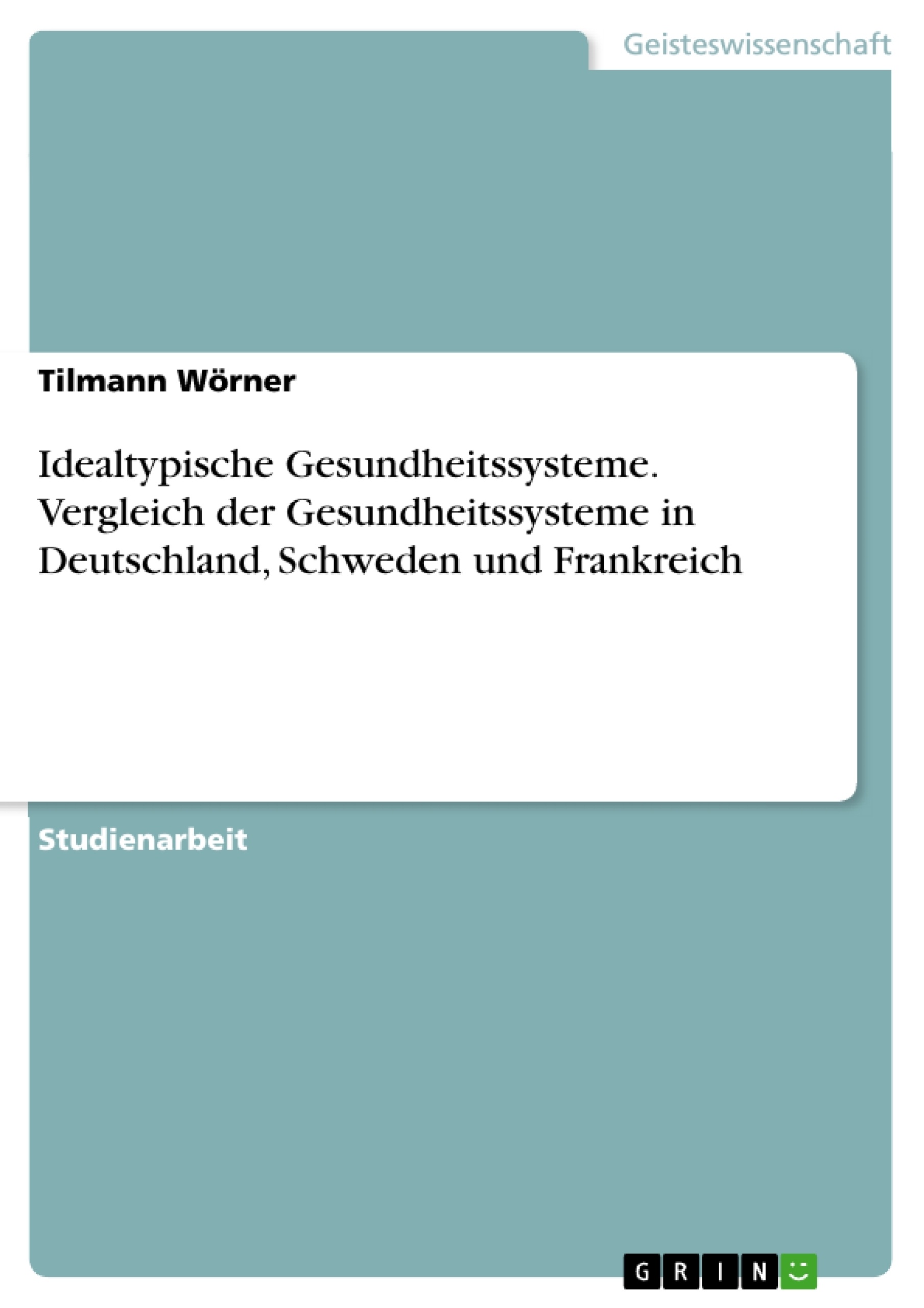Die Gesundheitssysteme in den einzelnen Staaten unterscheiden sich teilweise in sehr starkem Maße. Dies hat seinen Hintergrund unter anderem in der unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Tradition der jeweiligen Länder. Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, welche idealtypischen Modelle es im Gesundheitswesen gibt und wie im Einzelfall die konkrete Ausgestaltung vorgenommen wurde. Insbesondere soll ein Vergleich der Gesundheitssysteme in Deutschland, Frankreich und Schweden vorgenommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Methodische Vorgehensweise und Erkenntnisinteresse
- 2. Idealtypische Gesundheitssysteme
- 2.1 Beveridge-Modell
- 2.1.1 Steuerfinanzierte Systeme
- 2.2 Bismarck-Modell
- 2.3 Schematischer Vergleich des Bismarck- und des Beveridge-Modells
- 3. Das Gesundheitssystem in Schweden
- 3.1 Ambulante Versorgung in Schweden
- 3.2 Ist das schwedische Gesundheitssystem ein Beveridge-Modell?
- 4. Das Gesundheitssystem in Deutschland
- 4.1 Ambulante Versorgung in Deutschland
- 5. Das Gesundheitssystem in Frankreich
- 5.1 Ambulante Versorgung in Frankreich
- 6. Vergleich der betrachteten Gesundheitssysteme
- 7. Theoretischer Vergleich der Gesundheitssysteme
- 7.1 Machtressourcen-Ansatz und Neoinstitutionalismus
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die idealtypischen Modelle von Gesundheitssystemen und vergleicht die konkrete Ausgestaltung in Deutschland, Frankreich und Schweden. Der Fokus liegt auf einem Vergleich des Beveridge- und des Bismarck-Modells sowie der Analyse der ambulanten Versorgung in den drei ausgewählten Ländern.
- Vergleich der Beveridge- und Bismarck-Modelle
- Analyse des schwedischen Gesundheitssystems
- Analyse des deutschen Gesundheitssystems
- Analyse des französischen Gesundheitssystems
- Theoretischer Vergleich der Gesundheitssysteme mittels Machtressourcen-Ansatz und Neoinstitutionalismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der unterschiedlichen Gesundheitssysteme ein und begründet die Wahl der drei Vergleichsländer (Deutschland, Frankreich, Schweden) aufgrund ihrer unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Traditionen. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise, welche die Vorstellung idealtypischer Modelle (Beveridge und Bismarck), die Beschreibung der Gesundheitssysteme in den drei Ländern und einen theoretischen Vergleich beinhaltet. Der Schwerpunkt liegt auf der ambulanten Versorgung.
2. Idealtypische Gesundheitssysteme: Dieses Kapitel beschreibt die beiden idealtypischen Modelle von Gesundheitssystemen: das Beveridge-Modell, hauptsächlich steuerfinanziert und in Nordeuropa verbreitet, und das Bismarck-Modell, das beitragsfinanziert ist. Es wird betont, dass reale Gesundheitssysteme selten rein einem dieser Modelle entsprechen. Das Kapitel legt die Grundlagen für den späteren Vergleich der drei ausgewählten Länder.
2.1 Beveridge-Modell: Dieses Unterkapitel beschreibt detailliert das Beveridge-Modell, seine Finanzierung durch Steuern, seine Verbreitung in Nordeuropa und die historische Entwicklung basierend auf den Ideen von William Beveridge. Es betont die Zielsetzung eines universellen Zugangs zu Gesundheitsleistungen ohne finanzielle Barrieren und beleuchtet die Struktur eines nationalen Gesundheitsdienstes, wobei die Verantwortung für Finanzierung und Leistungserbringung in einer Hand liegt. Der Text erwähnt auch die zunehmende Bedeutung privater Zusatzversicherungen in einigen Ländern, die dieses Modell adaptiert haben.
3. Das Gesundheitssystem in Schweden: Dieses Kapitel beschreibt das schwedische Gesundheitssystem, mit einem Fokus auf die ambulante Versorgung. Es analysiert, inwiefern das System dem Beveridge-Modell entspricht und welche Besonderheiten es aufweist im Vergleich zum Idealmodell. Die Zusammenfassung des Kapitels wird sich auf die zentralen Merkmale des Systems und seine Einordnung im Kontext des internationalen Vergleichs konzentrieren.
4. Das Gesundheitssystem in Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich dem deutschen Gesundheitssystem, wiederum mit dem Fokus auf die ambulante Versorgung. Es beschreibt die zentralen Strukturen und Besonderheiten des Systems, um es im weiteren Vergleich mit Schweden und Frankreich zu positionieren. Die Zusammenfassung wird die wichtigsten Charakteristika des deutschen Systems herausarbeiten und den Vergleich mit den idealtypischen Modellen herstellen.
5. Das Gesundheitssystem in Frankreich: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das französische Gesundheitssystem und seine ambulante Versorgung. Ähnlich wie bei den vorherigen Kapiteln werden die zentralen Elemente des Systems dargestellt und im Kontext der idealtypischen Modelle und der anderen Vergleichsländer analysiert. Die Zusammenfassung wird die Charakteristika des französischen Systems hervorheben und den Vergleich mit den anderen Ländern ermöglichen.
6. Vergleich der betrachteten Gesundheitssysteme: Dieses Kapitel zieht eine vergleichende Bilanz der drei Gesundheitssysteme (Schweden, Deutschland, Frankreich), analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Detail und ordnet diese im Kontext der idealtypischen Modelle ein. Die Zusammenfassung wird die wesentlichen Ergebnisse des Vergleichs zusammenfassen und die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervorheben.
7. Theoretischer Vergleich der Gesundheitssysteme: Dieses Kapitel behandelt einen theoretischen Vergleich der Gesundheitssysteme unter Anwendung des Machtressourcen-Ansatzes und des Neoinstitutionalismus. Die Zusammenfassung wird die theoretischen Ansätze erläutern und deren Anwendung auf den Vergleich der Gesundheitssysteme darstellen.
Schlüsselwörter
Gesundheitssystem, Beveridge-Modell, Bismarck-Modell, Schweden, Deutschland, Frankreich, ambulante Versorgung, Steuerfinanzierung, Beitragsfinanzierung, Wohlfahrtsstaat, Machtressourcen-Ansatz, Neoinstitutionalismus, internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Gesundheitssystemen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und vergleicht verschiedene Gesundheitssysteme, insbesondere die in Schweden, Deutschland und Frankreich. Sie untersucht die idealtypischen Modelle von Beveridge und Bismarck und fokussiert sich auf die ambulante Versorgung in den drei ausgewählten Ländern. Die Arbeit nutzt theoretische Ansätze wie den Machtressourcen-Ansatz und den Neoinstitutionalismus, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Systeme zu erklären.
Welche Gesundheitssysteme werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Gesundheitssysteme von Schweden, Deutschland und Frankreich. Der Vergleich erfolgt sowohl anhand der idealtypischen Modelle von Beveridge und Bismarck als auch durch die Betrachtung der konkreten Ausgestaltung der ambulanten Versorgung in den drei Ländern.
Was sind die idealtypischen Modelle von Beveridge und Bismarck?
Das Beveridge-Modell ist ein hauptsächlich steuerfinanziertes Gesundheitssystem, das typischerweise in Nordeuropa anzutreffen ist und universellen Zugang zu Gesundheitsleistungen ohne finanzielle Barrieren anstrebt. Das Bismarck-Modell hingegen ist beitragsfinanziert und zeichnet sich durch eine stärkere Einbindung privater Akteure aus. Die Arbeit betont, dass reale Gesundheitssysteme selten rein einem dieser Modelle entsprechen.
Wie wird die ambulante Versorgung in den drei Ländern analysiert?
Die ambulante Versorgung in Schweden, Deutschland und Frankreich wird detailliert beschrieben und im Kontext der idealtypischen Modelle und im Vergleich zueinander analysiert. Der Fokus liegt auf den strukturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten der drei Systeme.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt den Machtressourcen-Ansatz und den Neoinstitutionalismus, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Gesundheitssysteme theoretisch zu erklären und zu verstehen. Diese Ansätze helfen dabei, die politischen und gesellschaftlichen Faktoren zu analysieren, die die Gestaltung der Gesundheitssysteme beeinflussen.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Idealtypische Gesundheitssysteme (mit Unterkapiteln zu Beveridge und Bismarck), Das Gesundheitssystem in Schweden, Das Gesundheitssystem in Deutschland, Das Gesundheitssystem in Frankreich, Vergleich der betrachteten Gesundheitssysteme, Theoretischer Vergleich der Gesundheitssysteme und Resümee. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesundheitssystem, Beveridge-Modell, Bismarck-Modell, Schweden, Deutschland, Frankreich, ambulante Versorgung, Steuerfinanzierung, Beitragsfinanzierung, Wohlfahrtsstaat, Machtressourcen-Ansatz, Neoinstitutionalismus, internationaler Vergleich.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die idealtypischen Modelle von Gesundheitssystemen zu untersuchen und die konkrete Ausgestaltung in Deutschland, Frankreich und Schweden zu vergleichen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Beveridge- und des Bismarck-Modells sowie der Analyse der ambulanten Versorgung in den drei ausgewählten Ländern.
- Quote paper
- Diplom-Soziologe / PR-Berater (DPRG) Tilmann Wörner (Author), 2007, Idealtypische Gesundheitssysteme. Vergleich der Gesundheitssysteme in Deutschland, Schweden und Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87829