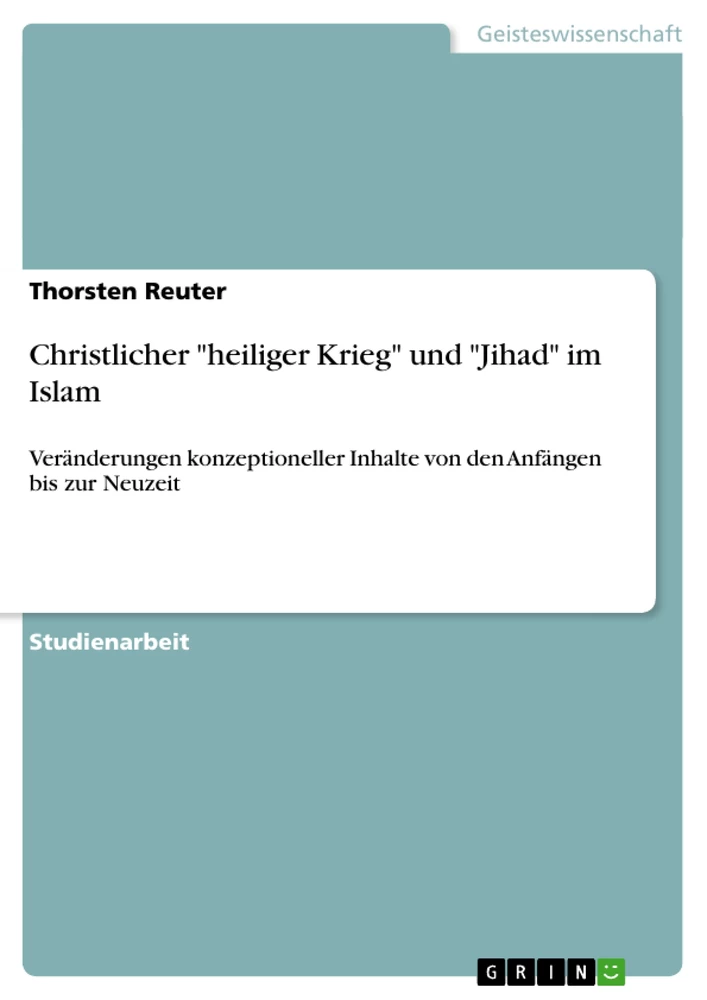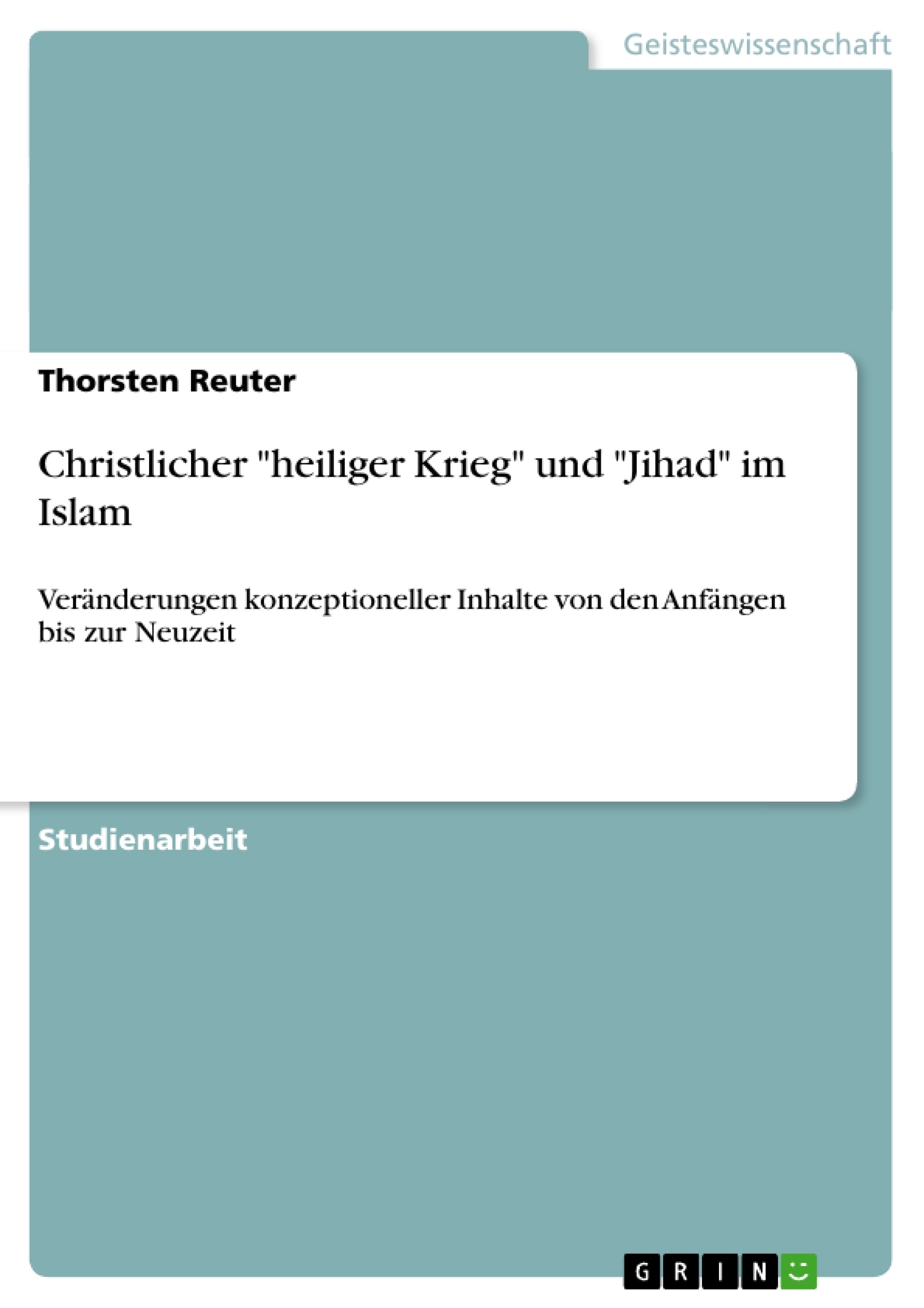Die vorliegende Arbeit untersucht die theologischen Konzepte sowohl des christlichen „heiligen Krieges“ als auch des islamischen „ğihāds“. Beide Konzeptionen erfuhren im Laufe der Jahrhunderte starke inhaltliche Veränderungen, die in Reaktion auf die jeweiligen politischen Realitäten modifiziert und angepasst werden mussten. Bedingt durch die oftmals zweideutigen, mitunter sogar gegensätzlichen Aussagen der Bibel und des Korans hinsichtlich Gewaltanwendung und Friedensausübung, waren und sind dem interpretatorischen Spielraum bei der Auslegung einzelner Textstellen kaum Grenzen gesetzt. Im Gegensatz zum Islam, bei dem der „ğihād-Gedanke“ bereits von den frühesten Anfängen an eine wesentliche Rolle einnahm, wurde innerhalb des Christentums die Idee des „heiligen Krieges“ erst wesentlich später ausformuliert. Unter „heiligem Krieg“ soll – entsprechend der Definition C. Erdmanns – nur diejenige kriegerische Betätigung verstanden werden, deren spezifische Ursache die Religion bildet. D. h., kriegerische Betätigungen, die mit dem Beistand Gottes oder der Heiligen geführt wurden, oder solche, die geweihte Gegenstände mit in die Kampf-handlungen führten, fallen nicht unbedingt in die Kategorie „heiliger Krieg“.
Im nun Folgenden wird zunächst der „heilige Krieg“ aus christlicher Perspektive, daran anschließend das diesbezügliche Verständnis aus islamischer Sicht behandelt, wobei insbesondere die wichtigsten und nachhaltigsten konzeptionellen Veränderungen bzw. Brüche im Mittelpunkt der Ausführungen stehen werden.
Zwei Aussagen Jesu könnten die vermeintlich pazifistische Botschaft des Neuen Testaments bekräftigen: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin.“ In ähnlich starkem Kontrast zur Verständniswelt des Alten Testaments steht die zweite Aussage: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet;“ Darf man diese überlieferten Worte noch als eine rein pazifistische Grundstruktur der Botschaft Jesu auslegen, so lässt folgende Aussage jedoch entgegengesetzte Interpretationen zu: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Idee des „heiligen Krieges“ im Christentum
- Urchristentum
- Vom gerechten zum „heiligen“ Krieg
- Gratian, Thomas von Aquin und Martin Luther
- Neuzeitliche Konstruktionen vom „heiligen Krieg“
- Die Befreiungskriege von 1813-1815
- Der Erste Weltkrieg
- Das islamische Konzept des „ğihād“
- Klassische „ğihād-Konzeption“ zu Lebzeiten Muhammads
- Klassische „ğihād-Konzeption“ nach Muhammads Tod
- Verdienst und Lohn beim Kampf gegen Ungläubige
- „ğihād“ und Kolonialismus
- Die Antwort der Modernisten auf westliche Domination
- Die Antwort der Fundamentalisten auf westliche Domination
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die theologischen Konzepte des christlichen „heiligen Krieges“ und des islamischen „ğihād“, ihre historischen Entwicklungen und Veränderungen im Kontext politischer Realitäten. Die Arbeit analysiert die Interpretationsspielräume in Bibel und Koran bezüglich Gewalt und Frieden und vergleicht die unterschiedlichen Ausformulierungszeiten beider Konzepte.
- Entwicklung des Konzepts des „heiligen Krieges“ im Christentum
- Entwicklung des Konzepts des „ğihād“ im Islam
- Interpretationsspielräume in Bibel und Koran bezüglich Gewalt und Frieden
- Einfluss politischer Realitäten auf die Konzepte
- Vergleich der beiden Konzepte im historischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die theologischen Konzepte des christlichen „heiligen Krieges“ und des islamischen „ğihād“, deren inhaltliche Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte und die Interpretationsspielräume in Bibel und Koran bezüglich Gewalt und Frieden. Der Fokus liegt auf den konzeptionellen Veränderungen und Brüchen beider Konzepte. Die Arbeit betont die unterschiedlichen Ausformulierungszeiten der Konzepte, wobei der „ğihād“ im Islam von Anfang an eine wesentliche Rolle spielte, während der „heilige Krieg“ im Christentum später ausformuliert wurde. Die Definition des „heiligen Krieges“ nach C. Erdmann wird als Grundlage verwendet.
Die Idee des „heiligen Krieges“ im Christentum: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Konzepts des „heiligen Krieges“ im Christentum. Zunächst werden die scheinbar pazifistischen Aussagen Jesu im Neuen Testament mit den kriegerischen Aspekten des Alten Testaments kontrastiert, was zu unterschiedlichen Interpretationen führt. Das Kapitel beleuchtet die pazifistische Position der frühen Christen, wie Tertullian und Lactanz, die jegliche militärische Beteiligung ablehnten. Die Entwicklung hin zu einer Legitimierung kriegerischen Handelns im Kontext des Mailänder Edikt von 313 und der zunehmenden Bedeutung von Christen im römischen Reich wird analysiert. Die Beiträge von Ambrosius und Augustinus zur theologischen Begründung von Krieg als legitimes staatliches Mittel, trotz des Gebots der Feindesliebe, werden im Detail erläutert. Augustinus rechtfertigt Krieg mit dem Bild des strafenden Vaters, wobei Krieg als Mittel Gottes zur Bestrafung der Bösen und Prüfung der Gerechten gesehen wird, wobei der Frieden als oberstes Ziel gilt.
Das islamische Konzept des „ğihād“: Dieses Kapitel befasst sich mit dem islamischen Konzept des „ğihād“ und seiner Entwicklung. Es wird zwischen der klassischen „ğihād“-Konzeption zu Lebzeiten Muhammads und der nach seinem Tod unterschieden. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des „ğihād“ als Kampf gegen Ungläubige und den damit verbundenen Verdienst und Lohn im Jenseits. Ein wichtiger Teil des Kapitels ist die Analyse des „ğihād“ im Kontext des Kolonialismus und die unterschiedlichen Reaktionen von Modernisten und Fundamentalisten auf die westliche Domination. Die Reaktionen der jeweiligen Gruppen auf den Kolonialismus werden mit ihren jeweiligen Motivationen und Strategien ausführlich erklärt. Dies wird mit historischen Beispielen untermauert.
Schlüsselwörter
Heiliger Krieg, ğihād, Christentum, Islam, Gewalt, Frieden, Bibel, Koran, Theologie, Konflikt, Kolonialismus, Fundamentalismus, Modernismus, Interpretation, Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Theologische Konzepte des „Heiligen Krieges“ und des „Ğihād“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die theologischen Konzepte des christlichen „Heiligen Krieges“ und des islamischen „Ğihād“, ihre historischen Entwicklungen und Veränderungen im Kontext politischer Realitäten. Sie analysiert die Interpretationsspielräume in Bibel und Koran bezüglich Gewalt und Frieden und vergleicht die unterschiedlichen Ausformulierungszeiten beider Konzepte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Konzepts des „Heiligen Krieges“ im Christentum, die Entwicklung des Konzepts des „Ğihād“ im Islam, die Interpretationsspielräume in Bibel und Koran bezüglich Gewalt und Frieden, den Einfluss politischer Realitäten auf die Konzepte und einen Vergleich der beiden Konzepte im historischen Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Die Idee des „heiligen Krieges“ im Christentum (mit Unterkapiteln zum Urchristentum, der Entwicklung vom gerechten zum „heiligen“ Krieg, Gratian, Thomas von Aquin und Martin Luther, sowie neuzeitlichen Konstruktionen wie den Befreiungskriegen und dem Ersten Weltkrieg), Das islamische Konzept des „ğihād“ (mit Unterkapiteln zur klassischen „ğihād“-Konzeption zu Lebzeiten und nach dem Tod Muhammads, zum Verdienst und Lohn beim Kampf gegen Ungläubige und zum „ğihād“ im Kontext des Kolonialismus mit den Reaktionen von Modernisten und Fundamentalisten), und Schlussbetrachtung.
Wie wird der „Heilige Krieg“ im Christentum dargestellt?
Das Kapitel zum „Heiligen Krieg“ im Christentum kontrastiert die scheinbar pazifistischen Aussagen Jesu mit kriegerischen Aspekten des Alten Testaments. Es beleuchtet die pazifistische Position früher Christen und analysiert die Entwicklung hin zu einer Legitimierung kriegerischen Handelns im römischen Reich. Die Beiträge von Ambrosius und Augustinus zur theologischen Begründung von Krieg werden detailliert erläutert, wobei Augustinus Krieg als Mittel Gottes zur Bestrafung der Bösen sieht.
Wie wird der „Ğihād“ im Islam dargestellt?
Das Kapitel zum „Ğihād“ unterscheidet zwischen der klassischen Konzeption zu Lebzeiten Muhammads und der danach. Es beleuchtet die Bedeutung des „Ğihād“ als Kampf gegen Ungläubige und den damit verbundenen Verdienst. Ein wichtiger Teil ist die Analyse des „Ğihād“ im Kontext des Kolonialismus und die unterschiedlichen Reaktionen von Modernisten und Fundamentalisten auf die westliche Domination.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heiliger Krieg, Ğihād, Christentum, Islam, Gewalt, Frieden, Bibel, Koran, Theologie, Konflikt, Kolonialismus, Fundamentalismus, Modernismus, Interpretation, Geschichte.
Welche Definition des „Heiligen Krieges“ wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Definition des „Heiligen Krieges“ nach C. Erdmann als Grundlage.
Was ist der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf den konzeptionellen Veränderungen und Brüchen beider Konzepte und betont die unterschiedlichen Ausformulierungszeiten: Der „Ğihād“ spielte im Islam von Anfang an eine wesentliche Rolle, während der „Heilige Krieg“ im Christentum später ausformuliert wurde.
- Quote paper
- Magister Thorsten Reuter (Author), 2006, Christlicher "heiliger Krieg" und "Jihad" im Islam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87711