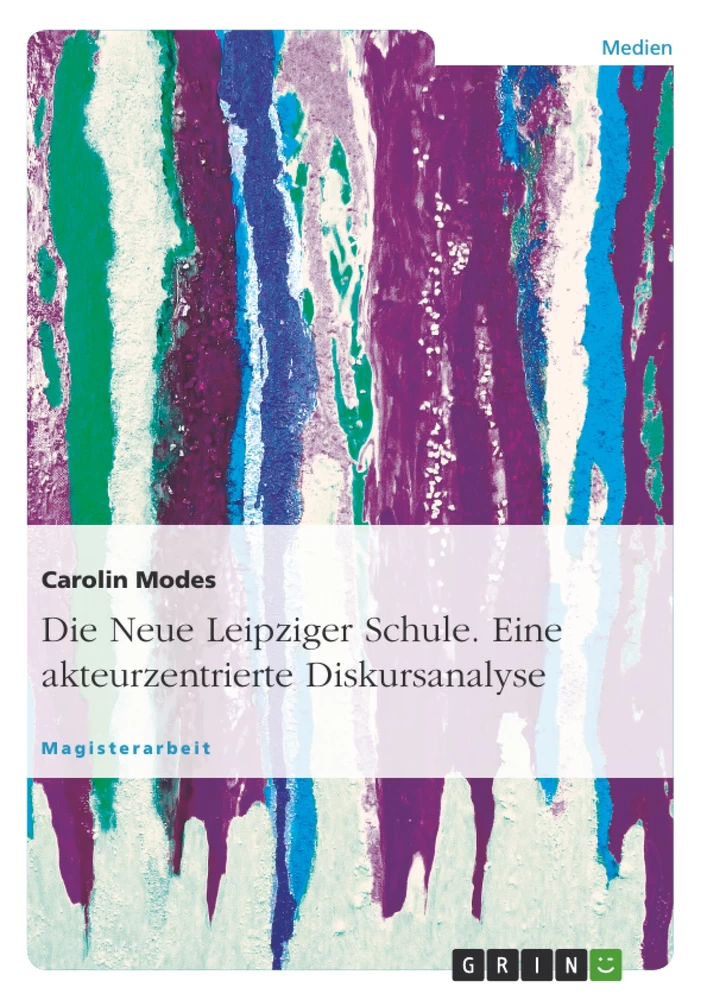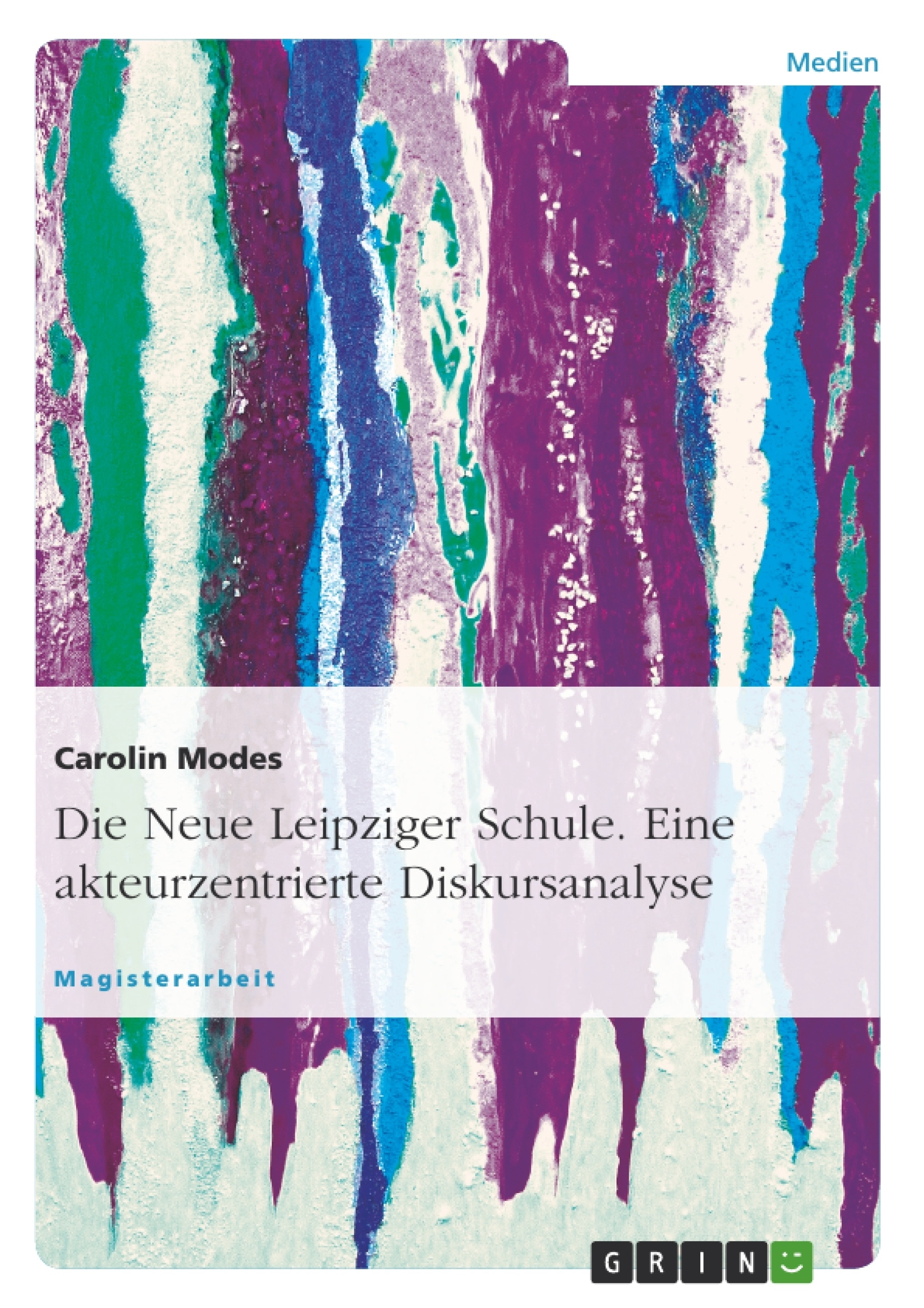In den letzten Jahren sind einige junge Maler wie Neo Rauch, Matthias Weischer, Christoph Ruckhäberle und Tim Eitel sehr erfolgreich geworden. Gleichzeitig zu den sich häufenden Berichten über spektakuläre Preise, die ihre Gemälde in Auktionen erzielten, sowie Teilnahmen an wichtigen Ausstellungen in den größten Museen und Galerien weltweit, wurden die Künstler in den Medien anhand unterschiedlicher Kriterien zu einer Gruppe mit dem Namen „Neue Leipziger Schule“ zusammengefasst. In anderen Veröffentlichungen hingegen wurde diskutiert, ob dieser gruppenkonstituierende Begriff seine Rechtmäßigkeit habe.
Ziel der folgenden Untersuchung ist es, die jeweiligen Akteure der verschiedenen Bereiche ausfindig zu machen, welche sich an der Entstehung, Formung und Verwirklichung der Konstruktion der NLS beteiligt haben, bzw. diesem Prozess entgegenstanden. Deshalb werden hier deren Positionen in Bezug auf die Konstruktion einer NLS anhand von Veröffentlichungen im Zeitraum von 1997 bis 2006 herausgearbeitet.
Darüber hinaus sollen die Gemeinsamkeiten, welche den Akteuren jeweils für eine Konstruktion der NLS dienen, aufgezeigt werden. Hierzu wird der zeitliche Verlauf ihrer jeweiligen Stellungsnahmen genauer beobachtet, um so Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben könnten, aufzudecken
Letztendlich soll die Frage beantwortet werden, ob sich bis zum Jahr 2006 ein allgemein gültiger Konsens, ein bestimmtes ‚Wissen’, welches mit dem Begriff der NLS verbunden wird, durchsetzen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Herleitung zur Diskursanalyse der Neuen Leipziger Schule
- 2.1 Theoretische Voraussetzungen für eine akteurzentrierte Diskursanalyse
- 2.1.1 Ferdinand de Saussure und die soziale Bedingtheit von Kommunikation
- 2.1.2 Michel Foucault und die Entstehung von „Wissen“
- 2.1.3 Pierre Bourdieu und die Bedeutung der Akteure
- 2.2 Die akteurzentrierte Diskursanalyse im Anschluss an Bourdieu
- 2.2.1 Verhältnis des kulturellen zum sozialen Feld
- 2.2.2 Das kulturelle Feld und seine Akteure
- 2.2.3 Die Analyse des NLS-Diskurses
- 2.1 Theoretische Voraussetzungen für eine akteurzentrierte Diskursanalyse
- 3 Diskursanalyse - Die Neue Leipziger Schule
- 3.1 Die Akteure und ihre Positionen im zeitlichen Verlauf von 1997 bis 2006
- 3.1.1 Die Künstler
- 3.1.2 Die Galeristen
- 3.1.3 Die Sammler
- 3.1.4 Die professionellen Kunstkritiker
- 3.1.5 Die professionellen Kunstexperten
- 3.2 Zusammenfassung – Konsensbildung?
- 3.1 Die Akteure und ihre Positionen im zeitlichen Verlauf von 1997 bis 2006
- 4 Diskussion und Ausblick: Die Bedeutung der amerikanischen Akteure
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Entstehung und den Diskurs um die „Neue Leipziger Schule“ (NLS) von 1997 bis 2006. Ziel ist es, die Rolle verschiedener Akteure (Künstler, Galeristen, Sammler, Kritiker etc.) bei der Konstruktion und Wahrnehmung dieses Kunstbegriffs zu analysieren und zu ergründen, ob sich ein Konsens über die NLS herausgebildet hat.
- Die soziale Konstruktion von Wissen und Wirklichkeit
- Die Rolle von Diskursen in der Kunstwelt
- Akteurzentrierte Diskursanalyse nach Bourdieu
- Analyse der Positionen verschiedener Akteure im NLS-Diskurs
- Die Frage nach Konsensbildung bezüglich der NLS
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Neuen Leipziger Schule ein und stellt die Forschungsfrage nach der sozialen Realität dieses Kunstbegriffs. Sie problematisiert die umstrittene Bezeichnung „Neue Leipziger Schule“ im Kontext der „Leipziger Schule“ der 1960er bis 1980er Jahre und benennt die Notwendigkeit einer akteurzentrierten Diskursanalyse zur Klärung der Frage, ob der Begriff NLS eine soziale Wirklichkeit repräsentiert. Die Arbeit kündigt die Heranziehung der Theorien von Saussure, Foucault und Bourdieu an, um die Entstehung von Wissen und Wirklichkeit zu analysieren.
2 Theoretische Herleitung zur Diskursanalyse der Neuen Leipziger Schule: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden die Theorien von Ferdinand de Saussure zur sozialen Bedingtheit von Kommunikation, Michel Foucaults zur Entstehung von Wissen durch Diskurse und Pierre Bourdieus zur Bedeutung von Akteuren und Macht in der Produktion von Diskursen und Wirklichkeit vorgestellt und für die anschließende Analyse der NLS fruchtbar gemacht. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Akteuren und ihrer Machtposition bei der Konstruktion sozialer Realitäten. Bourdieus Konzepte des kulturellen Feldes und der Akteure innerhalb dieses Feldes werden detailliert erläutert und als analytisches Werkzeug für die Untersuchung des NLS-Diskurses eingeführt.
3 Diskursanalyse - Die Neue Leipziger Schule: Dieses zentrale Kapitel analysiert den Diskurs um die NLS anhand der Positionen verschiedener Akteure (Künstler, Galeristen, Sammler, Kritiker, Kunstexperten) im Zeitraum von 1997 bis 2006. Es werden die jeweiligen Positionen und Strategien der Akteure im Umgang mit dem Begriff „Neue Leipziger Schule“ untersucht und die Interaktionen zwischen ihnen im Kontext des kulturellen Feldes analysiert. Die Analyse beleuchtet die Rolle von Medien, Ausstellungen und dem internationalen Kunstmarkt bei der Konstruktion und Verbreitung des Begriffs. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Positionen der Akteure und der Frage, ob sich ein Konsens über den Begriff der NLS herausgebildet hat.
Schlüsselwörter
Neue Leipziger Schule (NLS), Diskursanalyse, Akteurzentrierte Analyse, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Ferdinand de Saussure, Kunstmarkt, Kunstkritik, soziale Konstruktion von Wirklichkeit, Konsensbildung, Künstler, Galeristen, Sammler, Kunstexperten.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Diskursanalyse der Neuen Leipziger Schule
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Entstehung und den Diskurs um die „Neue Leipziger Schule“ (NLS) von 1997 bis 2006. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Rolle verschiedener Akteure (Künstler, Galeristen, Sammler, Kritiker etc.) bei der Konstruktion und Wahrnehmung dieses Kunstbegriffs und die Frage nach der Konsensbildung bezüglich der NLS.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Ferdinand de Saussure (soziale Bedingtheit von Kommunikation), Michel Foucault (Entstehung von Wissen durch Diskurse) und Pierre Bourdieu (Bedeutung von Akteuren und Macht in der Produktion von Diskursen und Wirklichkeit). Der Fokus liegt auf einer akteurzentrierten Diskursanalyse nach Bourdieu.
Welche Akteure werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse betrachtet die Positionen und Strategien verschiedener Akteure im NLS-Diskurs, darunter Künstler, Galeristen, Sammler, professionelle Kunstkritiker und professionelle Kunstexperten. Ihre Interaktionen und der Einfluss von Medien, Ausstellungen und dem internationalen Kunstmarkt werden untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur theoretischen Fundierung der Diskursanalyse, ein zentrales Kapitel zur Diskursanalyse der NLS selbst und abschließend eine Diskussion und einen Ausblick. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die methodischen Ansätze vor. Das zweite Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen von Saussure, Foucault und Bourdieu. Das dritte Kapitel analysiert den Diskurs um die NLS anhand der Positionen der verschiedenen Akteure. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick gegeben.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Hat sich im Zeitraum von 1997 bis 2006 ein Konsens über den Begriff „Neue Leipziger Schule“ herausgebildet? Die Arbeit untersucht, ob der Begriff NLS eine soziale Wirklichkeit repräsentiert und analysiert die verschiedenen Perspektiven der beteiligten Akteure.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Neue Leipziger Schule (NLS), Diskursanalyse, Akteurzentrierte Analyse, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Ferdinand de Saussure, Kunstmarkt, Kunstkritik, soziale Konstruktion von Wirklichkeit, Konsensbildung, Künstler, Galeristen, Sammler, Kunstexperten.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf den Zeitraum von 1997 bis 2006.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entstehung und den Diskurs um die Neue Leipziger Schule zu analysieren und zu verstehen, wie der Kunstbegriff sozial konstruiert wurde und welche Rolle die verschiedenen Akteure dabei gespielt haben.
Wie wird die Frage nach der Konsensbildung behandelt?
Die Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Positionen der Akteure und analysiert, ob sich trotz unterschiedlicher Perspektiven ein Konsens über den Begriff "Neue Leipziger Schule" herausgebildet hat. Die Analyse berücksichtigt die Dynamik des Diskurses im Laufe der untersuchten Zeitspanne.
- Arbeit zitieren
- Carolin Modes (Autor:in), 2007, Die Neue Leipziger Schule. Eine akteurzentrierte Diskursanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87671