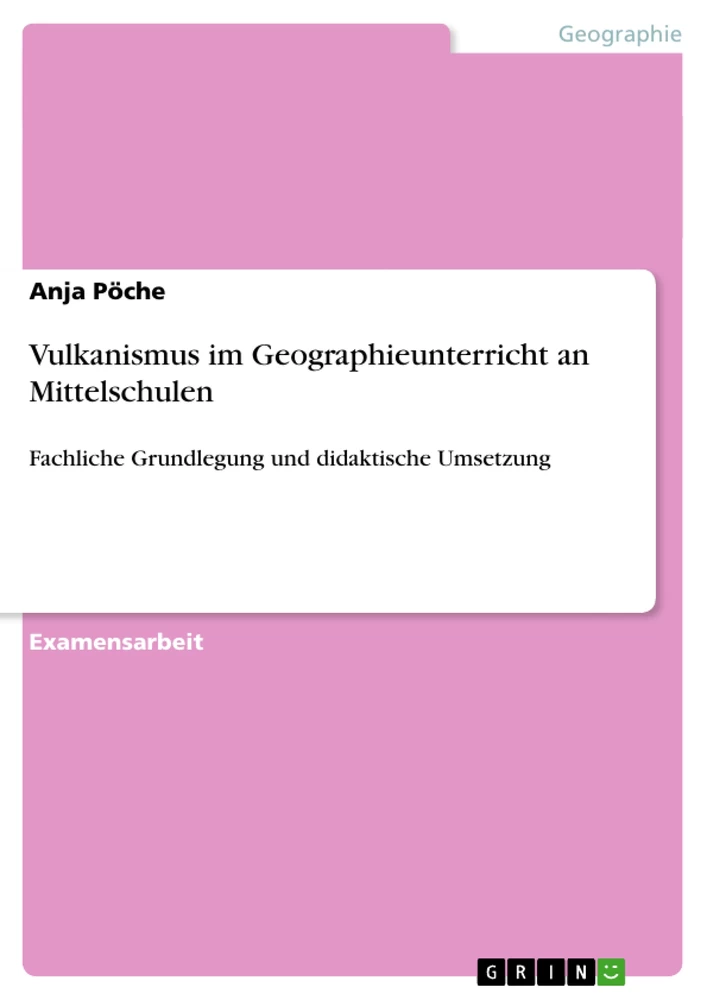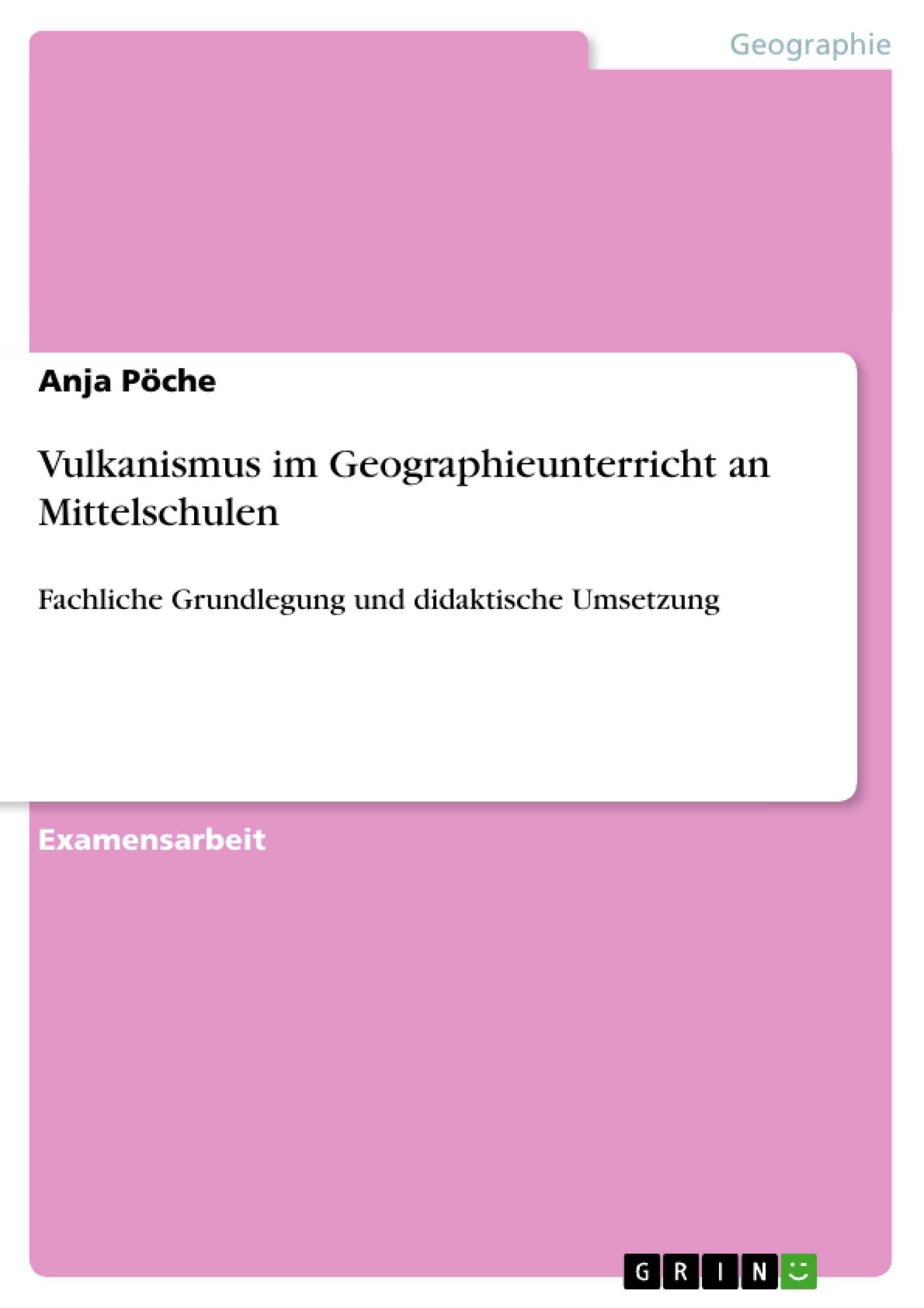In aktiven Vulkangebieten haben seit grauer Vorzeit Vulkaneruptionen den Menschen in Angst und Schrecken gesetzt und ihn deshalb immer wieder nach den Ursachen, den Wurzeln dieser Naturgewalten fragen lassen. Unzählige Mythen über Dämonen und Götter der Tiefe haben sich in vielen Ländern, vom pazifischen Siedlungsraum bis zu den Kulturen des abendländischen Altertums, entwickelt. Selbst in technisch hoch entwickelten Gesellschaften wie in Japan ist die religiöse Verehrung von Vulkanen weit verbreitet. Bis heute charakterisiert diese Ambivalenz unser Erkenntnisinteresse am Naturphänomen Vulkanismus (vgl. Schmincke 2000, 9). Dennoch gibt es im Gegensatz dazu moderne Wissenschaftler, die ebenfalls eine Erklärung zum Phänomen suchen. Sie sehen in der vulkanischen Tätigkeit ein Zeugnis für die innere Wärme der Erde (vgl. Press / Siever 1995, 88).
Wie sich aus den oben angeführten Aussagen erkennen lässt, ist, dass sich mit dem Phänomen Vulkanismus jede Kultur beziehungsweise Gesellschaft auf irgendeine Weise beschäftigt hat. Die vorliegende Arbeit setzt sich daher mit diesem unter ständiger Forschung stehendem Thema sowohl fachlich als auch didaktisch auseinander.
Im ersten Teil der Arbeit geschieht eine fachliche Analyse zum Vulkanismus. Vorerst werden die grundlegenden geologischen Gegebenheiten der Erde vorgestellt. Diese beziehen sich auf die Zusammenhänge der dynamischen Vorgänge in der Erdkruste und den tieferen Erdschichten sowie dem Erdaufbau. Im Anschluss daran erfolgt eine Darstellung der speziellen Aspekte. [...]
Es gibt allerdings nur sehr vereinzelte Dinge, welche für den Unterricht gedacht sind und welche sich dort verwenden lassen. Der überwiegende Teil der zu findenden schulischen Materialien ist schon sehr alt und überholungsbedürftig. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird daher analysiert, inwiefern sich das Thema Vulkanismus in den Geographieunterricht integrieren lässt. Zudem stellte ich eine Materialsammlung zusammen, die weitestgehend für den Unterricht in der Sekundarstufe I (vor allem an Mittelschulen) angedacht ist. Die Materialien sind weitestgehend so konzipiert, dass sie relativ unabhängig im Unterricht eingesetzt werden können. Den Schülern soll mit Hilfe dieser Materialien das komplexe Themenfeld näher gebracht werden, und sie sollen selbstständig Zusammenhänge im Prozess der Vulkanentstehung und deren Folgen erkennen und erklären können.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Fachliche Analyse
- 1. Auf dem Weg zur Theorie der Plattentektonik
- 2. Der innere Aufbau der Erde
- 3. Die Lithosphärenplatten
- 4. Internes Energiesystem der Erde – Motor des Vulkanismus
- 5. Erscheinungsformen des gegenwärtigen Vulkanismus an den Plattengrenzen
- 5.1. Vulkanismus an Riftzonen
- 5.1.1. Der Mittelozeanische Rücken
- 5.1.2. Kontinentaler Riftvulkanismus
- 5.2. Vulkanismus der Subduktionszonen
- 5.2.1. Inselbögen
- 5.2.2. Aktive Kontinentränder - Beispiel Anden
- 5.2.3. Kontinentale Plattenränder
- 5.3. Ozeanischer Intraplattenvulkanismus
- 5.3.1. Seamounts und Guyots
- 5.3.2. Hot Spot - Vulkanismus
- 6. Vulkanische Förderprodukte
- 6.1. Magma
- 6.2. Gase der Motor der Vulkane
- 6.3. Lavatypen
- 6.4. Vulkanische Lockerprodukte
- 6.5. Glutwolken
- 7. Vulkanbauten
- 7.1. Linearvulkane
- 7.2. Zentralvulkane
- 7.3. Lockerstoffvulkane
- 8. Postvulkanische Erscheinungen - Beispiel Geysire
- 9. Nutzen der Vulkane – Energiegewinnung aus vulkanischen Quellen
- Teil II: Unterrichtsmaterialien für den Geographieunterricht in der Sekundarstufe I
- 1. Didaktische Analyse
- 2. Sachanalyse
- 3. Unterrichtsmaterialien
- 3.1. Schalenbau der Erde I
- 3.2. Schalenbau der Erde II
- 3.3. Kontinente in Bewegung
- 3.4. Vorgänge an den Plattenrändern
- 3.5. Platten in Bewegung
- 3.6. Schicht- oder Schildvulkan
- 3.7. Vulkanbauten
- 3.8. Entstehung einer Caldera
- 3.9. Geysire
- 3.10. Hot Spots
- 3.11. Vulkanausbruch
- 3.12. Driftende Kontinente
- 3.13. Bewegung der Kontinente
- 3.14. Geysire
- 3.15. Schwimmender Stein
- 4. Das Thema im Netz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Vulkanismus, sowohl seine geologischen Grundlagen als auch seine didaktische Umsetzung im Geographieunterricht der Sekundarstufe I. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Vulkanismus zu vermitteln und geeignete Unterrichtsmaterialien zu entwickeln.
- Die Theorie der Plattentektonik und ihre Bedeutung für das Verständnis des Vulkanismus
- Die verschiedenen Erscheinungsformen des Vulkanismus und ihre Entstehung
- Vulkanische Förderprodukte und Vulkanbauten
- Didaktische Konzepte zur Vermittlung des Themas Vulkanismus im Unterricht
- Entwicklung und Evaluierung von Unterrichtsmaterialien für den Geographieunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I - Fachliche Analyse: Dieser Teil bietet eine umfassende fachliche Analyse des Vulkanismus, beginnend mit der Entwicklung der Theorie der Plattentektonik und der Beschreibung des inneren Aufbaus der Erde. Es werden die Lithosphärenplatten, das interne Energiesystem der Erde als Motor des Vulkanismus und verschiedene Erscheinungsformen an Plattengrenzen detailliert erklärt. Die Beschreibung der vulkanischen Förderprodukte, die verschiedenen Lavatypen und Vulkanbauten vervollständigen das geologische Verständnis. Schließlich werden auch postvulkanische Erscheinungen und der Nutzen vulkanischer Energiequellen beleuchtet. Der Teil dient als solide Grundlage für den didaktischen Teil der Arbeit.
1. Auf dem Weg zur Theorie der Plattentektonik: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung des Verständnisses von Kontinentalverschiebung, beginnend mit frühen Beobachtungen ähnlicher Küstenlinien und der Arbeit Alfred Wegeners. Es beleuchtet die Herausforderungen, denen Wegeners Theorie begegnete, und wie die Meeresgeologie und Geophysik in den 1960er Jahren mit dem Konzept des Sea-Floor-Spreadings und der Plattentektonik zu einem Paradigmenwechsel führten, Wegeners ursprüngliche Idee bestätigend und erweiternd. Die Entdeckung magnetischer Streifenmuster am Meeresboden wird als entscheidender Beweis für die Plattentektonik herausgestellt.
2. Der innere Aufbau der Erde: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Aufbau der Erde, beginnend mit der Erdkruste, dem Erdmantel und dem Erdkern. Die verschiedenen Schichten werden hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, ihres physikalischen Zustands und ihrer Bedeutung für geologische Prozesse wie Plattentektonik und Vulkanismus erläutert. Es wird ein umfassendes Bild des inneren Aufbaus vermittelt, das die Grundlage für das Verständnis der dynamischen Prozesse im Erdinneren legt.
3. Die Lithosphärenplatten: Dieses Kapitel befasst sich mit den Lithosphärenplatten, ihrer Zusammensetzung, ihren Grenzen und ihrer Bewegung. Es erklärt die verschiedenen Arten von Plattengrenzen (konvergente, divergente, transform) und ihre Auswirkungen auf die Erdkruste. Die Dynamik der Plattenbewegung und deren Einfluss auf geologische Formationen wie Gebirge und Ozeane werden detailliert beschrieben.
4. Internes Energiesystem der Erde – Motor des Vulkanismus: Dieses Kapitel untersucht das interne Energiesystem der Erde, das den Vulkanismus antreibt. Es erklärt die Konvektionsströme im Erdmantel, die Plattentektonik und die Entstehung von Magma. Die Rolle von Wärme und Druck bei der Bildung und Bewegung von Magma wird detailliert erläutert. Es verbindet die zuvor behandelten Themen und zeigt, wie diese Prozesse miteinander interagieren.
5. Erscheinungsformen des gegenwärtigen Vulkanismus an den Plattengrenzen: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von Vulkanismus, die an den verschiedenen Plattengrenzen auftreten. Es erklärt den Vulkanismus an Riftzonen (mittelozeanische Rücken und kontinentaler Riftvulkanismus), den Vulkanismus in Subduktionszonen (Inselbögen, aktive Kontinentränder, kontinentale Plattenränder) und ozeanischen Intraplattenvulkanismus (Seamounts, Guyots und Hotspots). Es wird die Vielfalt der vulkanischen Aktivität an verschiedenen tektonischen Umgebungen und die dazugehörigen Prozesse dargestellt.
6. Vulkanische Förderprodukte: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen vulkanischen Förderprodukten, darunter Magma, vulkanische Gase, verschiedene Lavatypen und vulkanische Lockerprodukte sowie Glutwolken. Es werden die chemische Zusammensetzung, die physikalischen Eigenschaften und die Auswirkungen dieser Produkte auf die Umgebung und die Landschaft beschrieben. Es vertieft das Verständnis der verschiedenen vulkanischen Ausbruchsformen.
7. Vulkanbauten: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Arten von Vulkanbauten, wie Linearvulkane, Zentralvulkane und Lockerstoffvulkane beschrieben. Es werden die Faktoren erklärt, die die Form und Größe eines Vulkans beeinflussen, wie die Art des Magmas, die Ausbruchsintensität und die tektonische Umgebung. Es werden die geomorphologischen Auswirkungen der vulkanischen Aktivität und die unterschiedliche Gestalt der Vulkane beleuchtet.
8. Postvulkanische Erscheinungen - Beispiel Geysire: Dieses Kapitel erläutert postvulkanische Erscheinungen, wobei Geysire als Beispiel dienen. Es wird erklärt, wie diese Phänomene durch die verbleibende Wärme im Untergrund entstehen und welche Prozesse dazu beitragen. Es bietet einen Einblick in die langfristigen Auswirkungen vulkanischer Aktivitäten.
9. Nutzen der Vulkane – Energiegewinnung aus vulkanischen Quellen: Dieses Kapitel erörtert den Nutzen von Vulkanen, insbesondere die Energiegewinnung aus vulkanischen Quellen. Es beschreibt verschiedene geothermische Energietechnologien und deren Bedeutung für die nachhaltige Energieversorgung. Es zeigt eine positive Seite der vulkanischen Aktivität und deren wirtschaftliche Nutzbarkeit.
Teil II - Unterrichtsmaterialien für den Geographieunterricht in der Sekundarstufe I: Dieser Teil präsentiert didaktische Konzepte und Unterrichtsmaterialien zur Vermittlung des Themas Vulkanismus an Mittelschulen. Es beinhaltet eine Sachanalyse und eine Auswahl an Materialien, die auf die Bedürfnisse der Sekundarstufe I abgestimmt sind, und zur selbstständigen Erarbeitung der Zusammenhänge im Prozess der Vulkanentstehung und deren Folgen dienen.
Schlüsselwörter
Vulkanismus, Plattentektonik, Magma, Lava, Vulkanbauten, Geysire, Erdbeben, Geothermie, Didaktik, Geographieunterricht, Sekundarstufe I, Unterrichtsmaterialien, Sea-floor spreading, Subduktionszonen, Riftzonen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Vulkanismus: Eine fachliche und didaktische Analyse"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Analyse des Vulkanismus, sowohl aus geologischer Sicht als auch im Hinblick auf seine didaktische Umsetzung im Geographieunterricht der Sekundarstufe I. Es beinhaltet eine detaillierte fachliche Einführung in die Plattentektonik, den inneren Aufbau der Erde, verschiedene Vulkanarten und ihre Entstehung, vulkanische Produkte und postvulkanische Erscheinungen. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien für den Schulunterricht, inklusive didaktischer Analysen und konkreter Beispiele.
Welche Themen werden im fachlichen Teil behandelt?
Der fachliche Teil umfasst die Entwicklung der Plattentektonik-Theorie, den Aufbau der Erde, die Lithosphärenplatten und ihre Bewegung, das interne Energiesystem der Erde als Motor des Vulkanismus, verschiedene Erscheinungsformen des Vulkanismus an Plattengrenzen (Riftzonen, Subduktionszonen, Intraplattenvulkanismus), vulkanische Förderprodukte (Magma, Gase, Lava, Lockerprodukte, Glutwolken), Vulkanbauten (Linear-, Zentral-, Lockerstoffvulkane) und postvulkanische Erscheinungen wie Geysire. Zusätzlich wird der Nutzen der Vulkane, insbesondere die Energiegewinnung, beleuchtet.
Welche didaktischen Aspekte werden im zweiten Teil behandelt?
Der didaktische Teil konzentriert sich auf die Vermittlung des Themas Vulkanismus im Geographieunterricht der Sekundarstufe I. Er beinhaltet eine didaktische Analyse, eine Sachanalyse und eine Sammlung von Unterrichtsmaterialien, die auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe zugeschnitten sind. Die Materialien sollen die Schüler*innen bei der selbstständigen Erarbeitung der Zusammenhänge rund um die Vulkanentstehung und deren Folgen unterstützen.
Welche Arten von Vulkanismus werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt den Vulkanismus an Riftzonen (mittelozeanische Rücken und kontinentaler Riftvulkanismus), den Vulkanismus in Subduktionszonen (Inselbögen, aktive Kontinentränder, kontinentale Plattenränder) und den ozeanischen Intraplattenvulkanismus (Seamounts, Guyots und Hotspots). Die Vielfalt der vulkanischen Aktivität in verschiedenen tektonischen Umgebungen wird detailliert dargestellt.
Welche Unterrichtsmaterialien werden angeboten?
Der zweite Teil enthält eine Reihe von Unterrichtsmaterialien, die verschiedene Aspekte des Vulkanismus behandeln, wie den Schalenbau der Erde, die Plattentektonik, die verschiedenen Vulkanarten, die Entstehung von Calderas und Geysiren sowie Hotspots und Vulkanausbrüche. Die Materialien sind für den Einsatz im Geographieunterricht der Sekundarstufe I konzipiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Dokument relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe umfassen: Vulkanismus, Plattentektonik, Magma, Lava, Vulkanbauten, Geysire, Erdbeben, Geothermie, Didaktik, Geographieunterricht, Sekundarstufe I, Unterrichtsmaterialien, Sea-floor spreading, Subduktionszonen, Riftzonen.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Lehrende im Geographieunterricht der Sekundarstufe I sowie an Studierende der Geographie und verwandter Fächer, die sich mit dem Thema Vulkanismus und dessen didaktischer Umsetzung auseinandersetzen möchten. Es dient sowohl der fachlichen Weiterbildung als auch der Bereitstellung von praktischem Unterrichtsmaterial.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in zwei Teile gegliedert: Teil I beinhaltet eine umfassende fachliche Analyse des Vulkanismus, während Teil II didaktische Konzepte und Unterrichtsmaterialien für den Geographieunterricht der Sekundarstufe I präsentiert. Innerhalb der Teile sind die Informationen in Kapitel und Unterkapitel gegliedert, um eine klare und übersichtliche Struktur zu gewährleisten.
- Quote paper
- Anja Pöche (Author), 2007, Vulkanismus im Geographieunterricht an Mittelschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87541