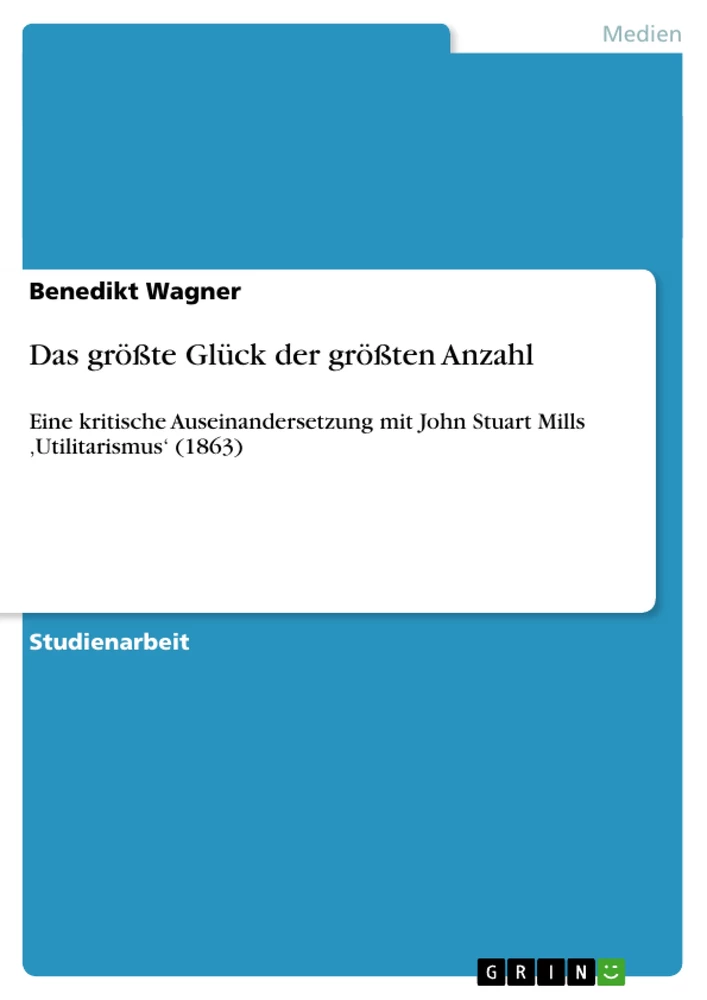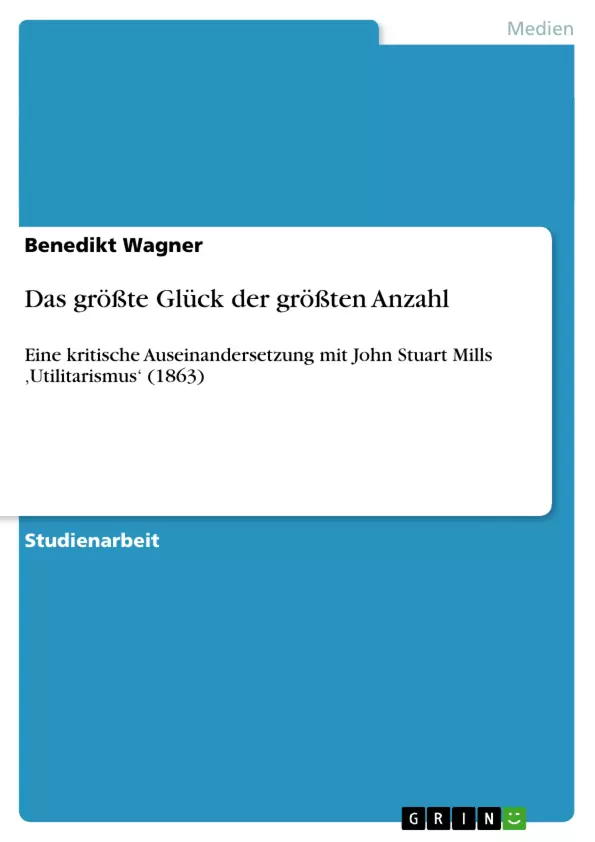Was unter dem Namen Utilitarismus von John Stuart Mill bekannt wurde und in der vorliegenden Ausarbeitung zum Gegenstand einer kritischen Betrachtung wird, entstammt einer konsequenten Tradition angelsächsischer Philosophie und Ethik. England hatte seine demokratische Revolution schon lange hinter sich, als in Frankreich, Deutschland und weiten Teilen Europas auf das bürgerliche Aufbegehren in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Phase der reaktionären Restauration folgte. Mit einer gewissen Stetigkeit wurde das Denken und Bestreben einer bürgerlichen Freiheit vom 18. im 19. Jahrhundert fortgeführt. Das revolutionäre Potential der Arbeiterklasse, ob der zunehmenden Industrialisierung, mündete in England nicht in eine weitere Revolution, sondern bedingte es eher, dass sich Moralphilosophen zunehmend auch mit der sozialen Verantwortung und dem gesamtgesellschaftlichen Allgemeinwohl auseinandersetzten und in ihre Konzeptionen der individuellen Freiheit miteinbezogen. Die Integration der Erfahrung in die Grundlagen von Erkenntnistheorie und Philosophie ist demnach schon seit Englands Ausgang aus dem Mittelalter über Locke und Humes eine Eigenart des angelsächsischen Denkens. So verwundert es auch nicht, dass die Nüchternheit des Comte‘schen Positivismus besonders hier mehr Beachtung fand, als in dessen Mutterland Frankreich. Die Geisteshaltung, nur das positiv wahrgenommene als Grundlage einer den Menschen definierenden Psychologie anzuerkennen, findet sich insbesondere in der Argumentation des Utilitarismus wieder. Diese ebenso nüchterne und praktische Verteidigung der Nützlichkeit als obersten Maßstab sittlichen Handels, begründete der Angelsachse Jeremy Bentham (1748 – 1832), dessen maßgeblicher Einfluss auf John Stuart Mill im nächsten Kapitel dargelegt wird.
Laut dem Utilitarismus beruht die Maxime menschlichen Handels auf der Lustmaximierung. Somit vollzieht er, vor allem seit Mill, einen Spagat zwischen der englischen liberalen Tradition der persönlichen Freiheit und dem zunehmenden Bewusstsein einer sozialen Verantwortung innerhalb der Gesellschaft, also sozialistischen Tendenzen. Unter dem Bestreben der klassischen Utilitaristen und weiteren demokratischen Aktivisten kam es im England des viktorianischen Zeitalters zu weitreichenden politischen Reformen.
Vor diesem Hintergrund wird auch dem Wirken John Stuart Mills das Propagieren eines „auf dem Boden des Liberalismus“ wurzelnder Sozialismus nachgesagt.
Inhaltsverzeichnis
- Lustmaximierung – Eine Einleitung zum Utilitarismus.
- reasoning machine - Die Erziehung und das Leben des John Stuart Mill
- Utilitarianism - Der Utilitarismus
- Erstes Kapitel - Allgemeine Bemerkungen
- Zweites Kapitel - Was heißt Utilitarismus?
- Drittes Kapitel - Von der fundamentalen Sanktion des Nützlichkeitsprinzips
- Viertes Kapitel – Welcherart Beweis sich für das Nützlichkeitsprinzip führen lässt
- Fünftes Kapitel - Über den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Nützlichkeit
- Das größte Glück der größten Anzahl - kritische Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit John Stuart Mills Werk „Utilitarianism“ (1863) und analysiert dessen Kernaussagen im Kontext des Utilitarismus. Der Fokus liegt dabei auf der kritischen Betrachtung der Idee der Lustmaximierung als Grundlage für sittliches Handeln und der damit verbundenen Frage nach der sozialen Verantwortung in der Gesellschaft.
- Die Entstehung des Utilitarismus und seine Wurzeln in der angelsächsischen Philosophie
- Die Erziehung und die philosophischen Einflüsse auf John Stuart Mill
- Das Nützlichkeitsprinzip als Grundlage für sittliches Handeln
- Die Verbindung von individueller Freiheit und sozialer Verantwortung im Utilitarismus
- Kritikpunkte und Einschränkungen des Utilitarismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Utilitarismus und dessen Bedeutung als politische und philosophische Bewegung. Es werden die wichtigsten Vertreter des Utilitarismus sowie deren Einfluss auf die Entwicklung des Denkens von John Stuart Mill vorgestellt.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Biographie von John Stuart Mill und beleuchtet dessen Erziehung und philosophische Prägung durch seinen Vater und Jeremy Bentham. Es wird die Entstehung seiner utilitaristischen Philosophie und seine Auseinandersetzung mit den Ideen von John Locke beschrieben.
- Das dritte Kapitel stellt die wichtigsten Kernaussagen von John Stuart Mills „Utilitarianism“ vor. Es werden die zentralen Definitionen des Utilitarismus und das Nützlichkeitsprinzip als Grundlage für sittliches Handeln erläutert.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage nach der Rechtfertigung des Nützlichkeitsprinzips und der Frage nach der Beweisführung für dessen Gültigkeit.
- Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen dem Nützlichkeitsprinzip und dem Konzept der Gerechtigkeit. Es werden die Argumentationslinien von John Stuart Mill zur Integration dieser beiden wichtigen Konzepte vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe des Utilitarismus, die Nützlichkeit als Grundlage für sittliches Handeln, die Lustmaximierung als Maxime menschlichen Handelns, die soziale Verantwortung und die Reformen im viktorianischen England. Weitere wichtige Themen sind die individuelle Freiheit, die Erziehung, die Verbindung von Philosophie und Praxis, sowie die Integration von empirischen Erkenntnissen in ethische Konzepte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptprinzip des Utilitarismus?
Das Prinzip lautet: „Das größte Glück der größten Anzahl.“ Handlungen werden danach beurteilt, wie viel Lust bzw. Glück sie im Vergleich zu Leid für alle Beteiligten erzeugen.
Wer waren die Begründer dieser Philosophie?
Jeremy Bentham gilt als Begründer des klassischen Utilitarismus, während John Stuart Mill die Theorie weiterentwickelte und qualitative Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Glück einführte.
Wie verbindet Mill Freiheit und soziale Verantwortung?
Mill argumentiert, dass individuelle Freiheit notwendig für den gesellschaftlichen Fortschritt ist, aber das Nützlichkeitsprinzip auch eine soziale Verantwortung für das Allgemeinwohl vorschreibt.
Was ist die „fundamentale Sanktion“ des Nützlichkeitsprinzips?
Mill sieht die Sanktion in den sozialen Gefühlen der Menschheit – dem Wunsch, in Harmonie mit anderen zu leben und das Wohlergehen der Gemeinschaft zu fördern.
Wie wird Gerechtigkeit im Utilitarismus definiert?
Gerechtigkeit wird als ein besonders wichtiger Teil der Nützlichkeit betrachtet. Regeln der Gerechtigkeit schützen fundamentale Interessen und tragen so maßgeblich zum allgemeinen Glück bei.
- Quote paper
- Benedikt Wagner (Author), 2007, Das größte Glück der größten Anzahl , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87501