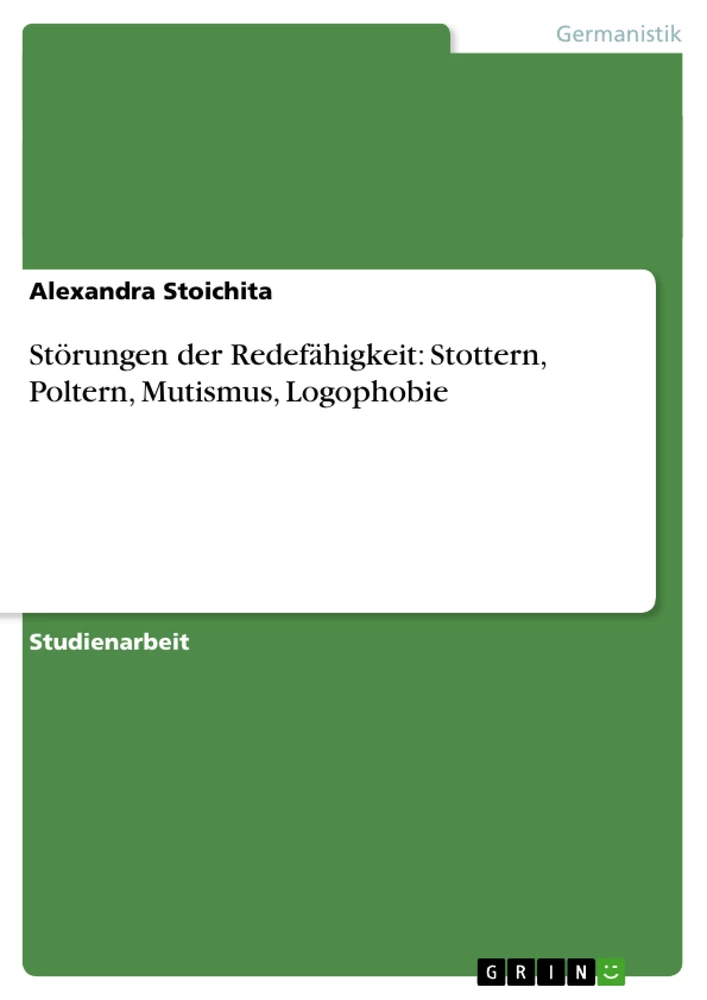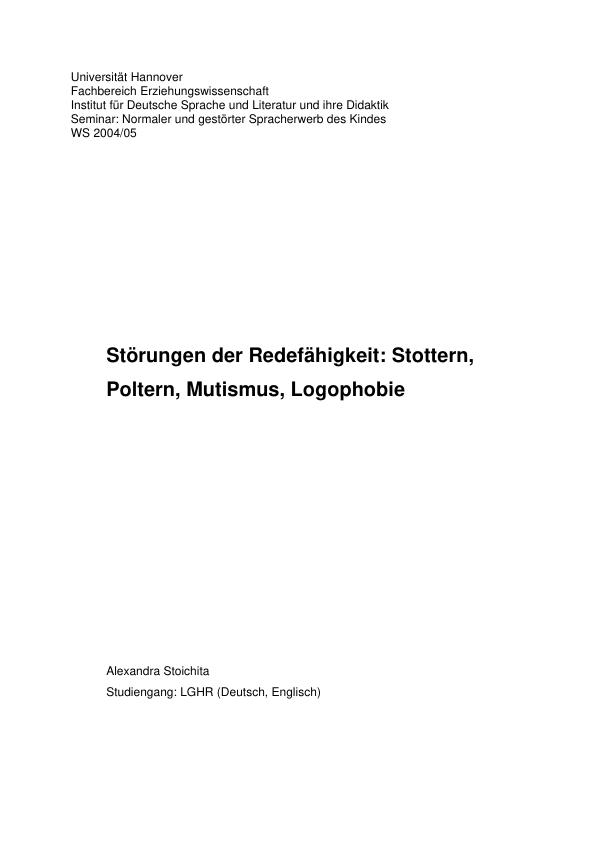Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Vorwort/ Problemstellung
3. Sprechflüssigkeit/ Sprechunflüssigkeit
3.1. Was ist Sprechflüssigkeit?
3.2. Normale Sprechunflüssigkeit beim Spracherwerb des Kindes
3.3. Normale Sprechunflüssigkeit vs Stottern
4. Stottern als Störung des Redeflusses
4.1. Definition/ Symptomatik des Stotterns
4.2. Verlauf/ Entwicklungsprozess des Stotterns
4.3. Zwiespalt: Eingreifen oder Abwarten
4.4. Therapiemöglichkeiten: Direkte vs Indirekte Methode
5. Poltern als Störung des Redeflusses
5.1. Definition/ Symptomatik
5.2. Auffälligkeiten im Rahmen der Sprachentwicklung
5.3. Therapiemöglichkeiten
6. Mutismus
6.1. Definition
6.2. Psychische Konstitution bei Mutisten
6.3. Therapiemöglichkeiten
7. Logophobie (Sprechangst)
7.1. Defintion
7.2. Abgrenzung der Sprechangst zu anderen Ängsten
8. Fazit
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Ich verfasse diese Hausarbeit im Rahmen des Seminars „Normaler und gestörter Spracherwerb des Kindes“ und werde im Folgenden das Thema „Störungen der Redefähigkeit/ des Redeflusses: Stottern, Poltern, Mutismus, Logophobie“ behandeln.
Ich habe mich für diese Thematik entschieden, da ich als angehende Grundschullehrerin möglicherweise öfters mit betroffenen Kindern zu tun haben werde und daher Hintergrundwissen über diese Problematik für wichtig halte.
Im Folgenden werde ich zunächst ein kurzes Vorwort bezüglich der Problemstellung auf diesem Gebiet schreiben, bevor ich dann ausführlich auf die einzelnen Redestörungen eingehe. Dem Phänomen Stottern soll dabei die meiste Aufmerksamkeit gewidmet werden, da es eine der bekanntesten und weit verbreitetsten Redestörungen darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorwort/ Problemstellung
- 3. Sprechflüssigkeit/ Sprechunflüssigkeit
- 3.1. Was ist Sprechflüssigkeit?
- 3.2. Normale Sprechunflüssigkeit beim Spracherwerb des Kindes
- 3.3. Normale Sprechunflüssigkeit vs Stottern
- 4. Stottern als Störung des Redeflusses
- 4.1. Definition/ Symptomatik des Stotterns
- 4.2. Verlauf/ Entwicklungsprozess des Stotterns
- 4.3. Zwiespalt: Eingreifen oder Abwarten
- 4.4. Therapiemöglichkeiten: Direkte vs Indirekte Methode
- 5. Poltern als Störung des Redeflusses
- 5.1. Definition/ Symptomatik
- 5.2. Auffälligkeiten im Rahmen der Sprachentwicklung
- 5.3. Therapiemöglichkeiten
- 6. Mutismus
- 6.1. Definition
- 6.2. Psychische Konstitution bei Mutisten
- 6.3. Therapiemöglichkeiten
- 7. Logophobie (Sprechangst)
- 7.1. Definition
- 7.2. Abgrenzung der Sprechangst zu anderen Ängsten
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht verschiedene Störungen der Redefähigkeit bei Kindern, mit dem Fokus auf Stottern, Poltern, Mutismus und Logophobie. Die Arbeit zielt darauf ab, angehende Grundschullehrerinnen und -lehrer mit dem notwendigen Hintergrundwissen auszustatten, um betroffene Kinder zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Die Abgrenzung zwischen normalen Sprechunflüssigkeiten im Spracherwerb und tatsächlichen Störungen spielt dabei eine zentrale Rolle.
- Abgrenzung normaler Sprechunflüssigkeiten von pathologischen Redeflussstörungen
- Charakterisierung und Symptomatik von Stottern, Poltern, Mutismus und Logophobie
- Entwicklungsverläufe und Einflussfaktoren bei Redeflussstörungen
- Therapiemöglichkeiten und deren jeweilige Ansätze
- Die Bedeutung des familiären und sozialen Umfelds für die Entstehung und Bewältigung von Redeflussstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erklärt die Motivation der Autorin, sich mit Störungen der Redefähigkeit im Kindesalter zu beschäftigen. Die Autorin unterstreicht die Relevanz des Themas für angehende Grundschullehrerinnen und -lehrer und kündigt den weiteren Aufbau der Arbeit an, wobei Stottern als besonders relevanter Aspekt hervorgehoben wird.
2. Vorwort/ Problemstellung: Dieses Kapitel definiert den Sammelbegriff „Redestörungen“ und hebt die Komplexität der Thematik hervor. Es betont die Vielfältigkeit der Erscheinungsformen und die Schwierigkeit der differentialdiagnostischen Abgrenzung zwischen verschiedenen Störungen sowie von „normalen“ Sprechunflüssigkeiten. Die interaktionale Natur von Redestörungen wird hervorgehoben, wobei der Einfluss von Familie, Umfeld und Gesellschaft auf die Ausprägung und Entstehung der Störung betont wird. Die Notwendigkeit individueller Diagnostik und Therapie wird unterstrichen, da falsche Diagnosen schwerwiegende Folgen haben können.
3. Sprechflüssigkeit/ Sprechunflüssigkeit: Kapitel 3 befasst sich mit dem Begriff der Sprechflüssigkeit und der Schwierigkeit, diesen präzise zu definieren, da verschiedene Komponenten wie Rhythmus, Intonation und Sprechgeschwindigkeit eine Rolle spielen. Es wird auf verschiedene Definitionen eingegangen und die Tatsache hervorgehoben, dass Unflüssigkeiten im Sprechen normal sind, auch bei Erwachsenen. Der Trend weg von dem Ziel „flüssiges Sprechen“ hin zu „flüssigem Stottern“ und der Akzeptanz des eigenen Störungsbildes wird diskutiert.
3.2. Normale Sprechunflüssigkeit beim Spracherwerb des Kindes: Dieses Unterkapitel beschreibt die normale Sprechunflüssigkeit, auch Entwicklungsstottern genannt, die im Alter zwischen 2,5 und 4 Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Es wird erklärt, dass diese Unflüssigkeiten ein normaler Bestandteil des Spracherwerbs sind und durch verschiedene Faktoren wie den allgemeinen Sprachentwicklungsverlauf und das Sprachlernangebot der Umwelt beeinflusst werden. Die typischen Kennzeichen dieser normalen Unflüssigkeiten wie Wiederholungen, Einschübe und Abbrüche werden aufgezeigt. Der hohe Anteil von Unflüssigkeiten in diesem Alter (bis zu 10%) wird im Kontext der aktiven Auseinandersetzung mit Sprache und der zunehmenden Komplexität der Sprachproduktion erklärt.
Schlüsselwörter
Stottern, Poltern, Mutismus, Logophobie, Redestörungen, Sprechflüssigkeit, Sprechunflüssigkeit, Sprachentwicklung, kindlicher Spracherwerb, Therapie, Diagnostik, Differentialdiagnose, Entwicklungsstottern, familiäres Umfeld, soziales Umfeld.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Störungen der Redefähigkeit bei Kindern
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Störungen der Redefähigkeit bei Kindern, mit besonderem Fokus auf Stottern, Poltern, Mutismus und Logophobie. Sie richtet sich an angehende Grundschullehrerinnen und -lehrer und vermittelt das nötige Wissen zum Erkennen und angemessenen Umgang mit betroffenen Kindern.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abgrenzung normaler Sprechunflüssigkeiten von pathologischen Redeflussstörungen, die Charakterisierung und Symptomatik der genannten Störungen, deren Entwicklungsverläufe und Einflussfaktoren, Therapiemöglichkeiten und deren Ansätze sowie die Bedeutung des familiären und sozialen Umfelds.
Welche Störungen werden im Detail betrachtet?
Die Hausarbeit analysiert detailliert Stottern, Poltern, Mutismus und Logophobie. Für jede Störung werden Definition, Symptomatik, Entwicklungsverlauf und Therapiemöglichkeiten beschrieben.
Wie wird die Abgrenzung zwischen normaler Sprechunflüssigkeit und Störung vorgenommen?
Die Arbeit legt großen Wert auf die Unterscheidung zwischen normalen Sprechunflüssigkeiten im Spracherwerb (Entwicklungsstottern) und tatsächlichen Störungen. Sie beschreibt die typischen Merkmale normaler Unflüssigkeiten im Kindesalter und deren Abgrenzung zu pathologischem Stottern.
Welche Therapiemöglichkeiten werden vorgestellt?
Für jede der behandelten Störungen werden verschiedene Therapiemöglichkeiten und deren Ansätze vorgestellt. Dabei wird beispielsweise bei Stottern die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Methoden erläutert.
Welche Rolle spielen familiäres und soziales Umfeld?
Die Hausarbeit betont die Bedeutung des familiären und sozialen Umfelds für die Entstehung und Bewältigung von Redeflussstörungen. Der interaktive Charakter der Störungen wird hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Problemstellung, Sprechflüssigkeit/Sprechunflüssigkeit (inkl. normaler Sprechunflüssigkeit im Spracherwerb), Stottern, Poltern, Mutismus, Logophobie und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Stottern, Poltern, Mutismus, Logophobie, Redestörungen, Sprechflüssigkeit, Sprechunflüssigkeit, Sprachentwicklung, kindlicher Spracherwerb, Therapie, Diagnostik, Differentialdiagnose, Entwicklungsstottern, familiäres Umfeld, soziales Umfeld.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Die Hausarbeit richtet sich in erster Linie an angehende Grundschullehrerinnen und -lehrer, um ihnen das notwendige Wissen zum Erkennen und Unterstützen von Kindern mit Redeflussstörungen zu vermitteln.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel befindet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der Hausarbeit.
- Quote paper
- Alexandra Stoichita (Author), 2004, Störungen der Redefähigkeit: Stottern, Poltern, Mutismus, Logophobie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87197