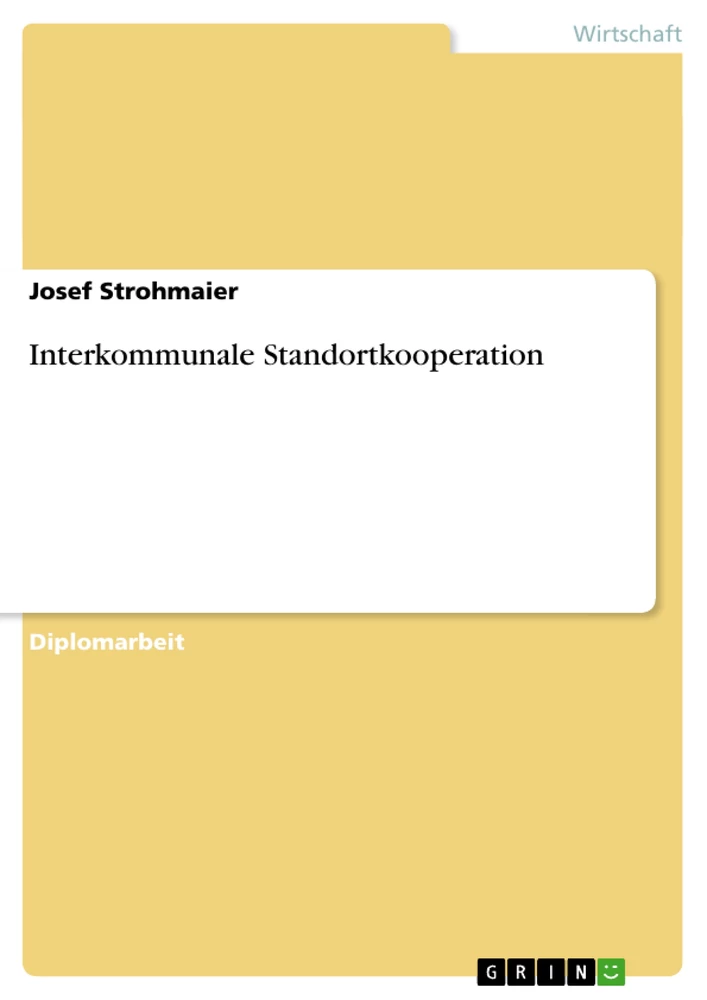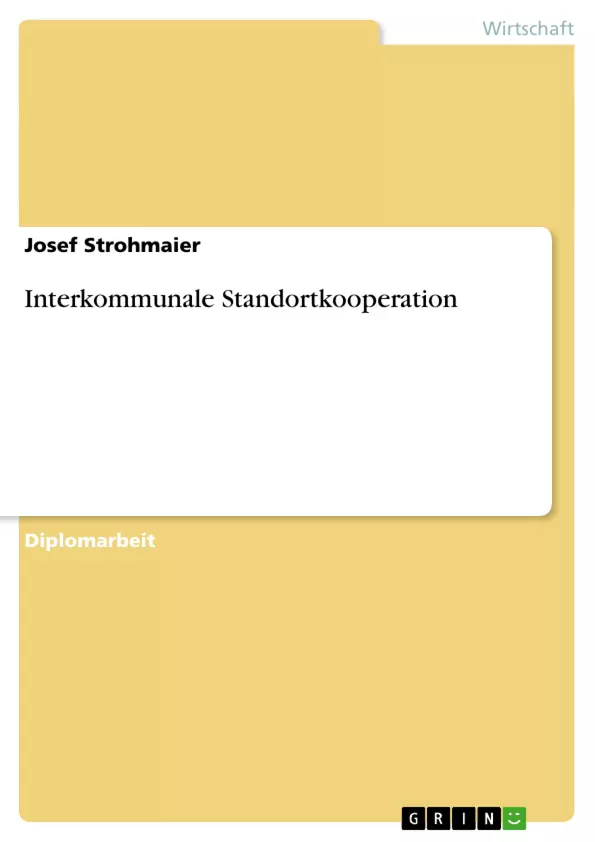Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Finanzierung der Gemeinden im Allgemeinen und der Steigerung der eigenen Einnahmen durch interkommunale Standortkooperation im Besonderen.
Durch die fortdauernden engen finanzpolitischen Spielräume sind die Gemeinden angehalten ihre eigenen Einnahmen durch Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen zu erhöhen um freie Finanzspitzen für Investitionen zu schaffen. Viele Gemeinden sind aber aus finanziellen, geographischen oder verkehrstechnischen Gründen dazu nicht in der Lage. Außerdem werden durch die Konstruktion und Zielsetzung des österreichischen Finanzausgleichs die Bruttomehrerträge aus steigenden eigenen Steuereinnahmen durch verminderte Zuweisungen und Umlagen wieder reduziert. Die Darstellung der gesamten Problematik mit Schwerpunkt auf den fiskalischen Auswirkungen bildet die Basis für die Suche nach Lösungsmöglichkeiten.
Darauf aufbauend wird die interkommunale Standortkooperation als eine Möglichkeit zur Vermeidung bzw. Reduzierung der genannten Probleme dargestellt. Schwerpunkt bilden die Wahl der Organisationsform sowie die Funktionsweise der Zusammenarbeit in den verschiedenen Problemfeldern unter besonderer Berücksichtigung des Ausgleichs fiskalischer Belastungen aus Betriebsansiedlungen auf die Kommunalhaushalte.
Zur quantitativen Darstellung der fiskalischen Auswirkungen wurde ein Beispiel aus der Steiermark untersucht und aufbereitet. Die Kooperationsproblematik wird darüber hinaus durch eine unzureichende Gesetzeslage verschärft, deren Lösung in Planung steht. Dazu wurde ein Umsetzungskonzept erarbeitet, um die Implementierung des Gesetzes in die kommunale Praxis zu erleichtern und einen Beitrag zum Begutachtungsprozess zu dieser Novelle des Finanzausgleichsgesetzes zu liefern.
Schlüsselwörter: Finanzausgleich, Interkommunale Zusammenarbeit, Kommunalsteuer, Standortkooperation, Kompensationseffekte, Betriebsansiedlung, Standortpolitik, Regional- und Standortentwicklung, Interkommunale Rechtsformen
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Zielsetzung und Ergebnisse
- Aims und Results
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangslage und Zugang
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4 Datengrundlage und Methodik
- 2. Finanzierung österreichischer Gemeinden
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Die Finanzverfassung
- 2.3 Der Finanzausgleich
- 2.3.1 Aufbau des Finanzausgleichs bzw. -gesetzes in Österreich
- 2.3.1.1 Primärer Finanzausgleich
- 2.3.1.2 Sekundärer Finanzausgleich
- 2.3.1.3 Tertiärer Finanzausgleich
- 2.3.2 Exkurs: Reform des Finanzausgleichs
- 2.3.1 Aufbau des Finanzausgleichs bzw. -gesetzes in Österreich
- 2.4 Steigerung der Steuereinnahmen
- 2.4.1 Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich
- 2.4.2 Ausschließliche Gemeindeabgaben
- 2.4.2.1 Die Grundsteuer
- 2.4.2.2 Die Kommunalsteuer
- 2.5 Problematik bei Betriebsansiedlungen
- 2.5.1 Konkurrenz und Standortmarketing
- 2.5.2 Flächenvorsorge
- 2.5.3 Infrastruktur- und Erschließungskosten
- 2.5.4 Kompensationseffekte
- 2.5.4.1 Kompensationseffekte im primären Finanzausgleich
- 2.5.4.2 Kompensationseffekte im sekundären Finanzausgleich
- 2.5.4.2.1 Landesumlage
- 2.5.4.2.2 Finanzzuweisung
- 2.5.4.3 Kompensationseffekte im tertiären Finanzausgleich
- 2.6 Zusammenfassung
- 3. Interkommunale Zusammenarbeit als Lösung
- 3.1 Definition interkommunale Zusammenarbeit
- 3.2 Motive für eine Kooperation
- 3.3 Anwendungsbereiche der IKZ
- 3.4 Organisationsformen der Zusammenarbeit
- 3.4.1 Öffentlich-rechtliche Organisationsformen
- 3.4.1.1 Verwaltungsgemeinschaft
- 3.4.1.2 Gemeindeverband
- 3.4.2 Gesellschaftsrechtliche Organisationsformen
- 3.4.2.1 Personengesellschaften
- 3.4.2.2 Kapitalgesellschaften
- 3.4.2.2.1 Aktiengesellschaft
- 3.4.2.2.2 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- 3.4.1 Öffentlich-rechtliche Organisationsformen
- 3.5 Funktionsweise der Zusammenarbeit
- 3.5.1 Gemeinsames Standortmarketing versus Konkurrenz
- 3.5.2 Flächenvorsorge
- 3.5.3 Infrastruktur- und Erschließungskosten
- 3.5.4 Reduzierung von Kompensationseffekten
- 3.5.5 Ausgleich von Lasten und Nutzen
- 3.6 Zusammenfassung
- 4. Fallbeispiel
- 4.1 Zweck und Methodik
- 4.2 Ausgangslage des Projekts
- 4.2.1 Projektgemeinden
- 4.2.1.1 Marktgemeinde Frauental an der Lassnitz
- 4.2.1.2 Stadtgemeinde Deutschlandsberg
- 4.2.2 Projektbeschreibung
- 4.2.3 Projektkosten
- 4.2.4 Geplante Projektumsetzung
- 4.2.5 Die Novelle zum FAG 2001
- 4.2.5.1 Fiskalische Standorteignung Frauental
- 4.2.5.2 Verluste durch Kompensationseffekte
- 4.2.6 Alternativstandort Deutschlandsberg
- 4.2.1 Projektgemeinden
- 4.3 Ausgangslage im Gesetz
- 4.3.1 Problem Grundsteuer
- 4.3.1.2 Problem Finanzkraftberücksichtigung
- 4.3.2 Konzept der Novelle
- 4.3.3 Umsetzung der Novelle in der kommunalen Praxis
- 4.4 Zusammenfassung
- 5. Resümee
- 5.1 Ergebnisse
- 5.2 Schlussfolgerungen
- 5.2.1 Schlussfolgerung 1
- 5.2.2 Schlussfolgerung 2
- 5.2.3 Schlussfolgerung 3
- 5.2.4 Schlussfolgerung 4
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik der interkommunalen Standortkooperation und untersucht die Möglichkeiten und Auswirkungen dieser Form der Zusammenarbeit für die Ansiedlung von Unternehmen. Die Arbeit soll einen praxisnahen Einblick in die Problematik von Kompensationseffekten im österreichischen Finanzausgleichssystem und deren Auswirkungen auf die finanzielle Situation von Gemeinden bei Betriebsansiedlungen liefern.
- Finanzierung österreichischer Gemeinden und der Finanzausgleich
- Problematik von Kompensationseffekten bei Betriebsansiedlungen
- Interkommunale Zusammenarbeit als Lösung für die Bewältigung dieser Problematik
- Organisationsformen und Funktionsweise interkommunaler Kooperationen
- Fallbeispiel einer interkommunalen Standortkooperation
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Diplomarbeit, definiert die Zielsetzung und erläutert den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Finanzierung österreichischer Gemeinden: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Finanzierungsquellen österreichischer Gemeinden, insbesondere dem Finanzausgleichssystem. Es beleuchtet die verschiedenen Ebenen des Finanzausgleichs und analysiert die Problematik der Kompensationseffekte, die bei Betriebsansiedlungen auftreten können.
- Kapitel 3: Interkommunale Zusammenarbeit als Lösung: Dieses Kapitel stellt die interkommunale Zusammenarbeit als eine Lösung für die Herausforderungen der Betriebsansiedlung dar. Es definiert den Begriff der IKZ, beleuchtet die Motive und Anwendungsbereiche sowie die verschiedenen Organisationsformen der Zusammenarbeit.
- Kapitel 4: Fallbeispiel: In diesem Kapitel wird ein konkretes Fallbeispiel einer interkommunalen Standortkooperation analysiert und die Auswirkungen auf die finanzielle Situation der beteiligten Gemeinden untersucht.
Schlüsselwörter
Interkommunale Standortkooperation, Finanzausgleich, Kompensationseffekte, Betriebsansiedlung, Gemeinden, Finanzverfassung, Organisationsformen, Fallbeispiel, Standortmarketing, Flächenvorsorge, Infrastruktur, Gemeindeverband, Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
- Quote paper
- Mag.(FH), MPA Josef Strohmaier (Author), 2004, Interkommunale Standortkooperation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87123