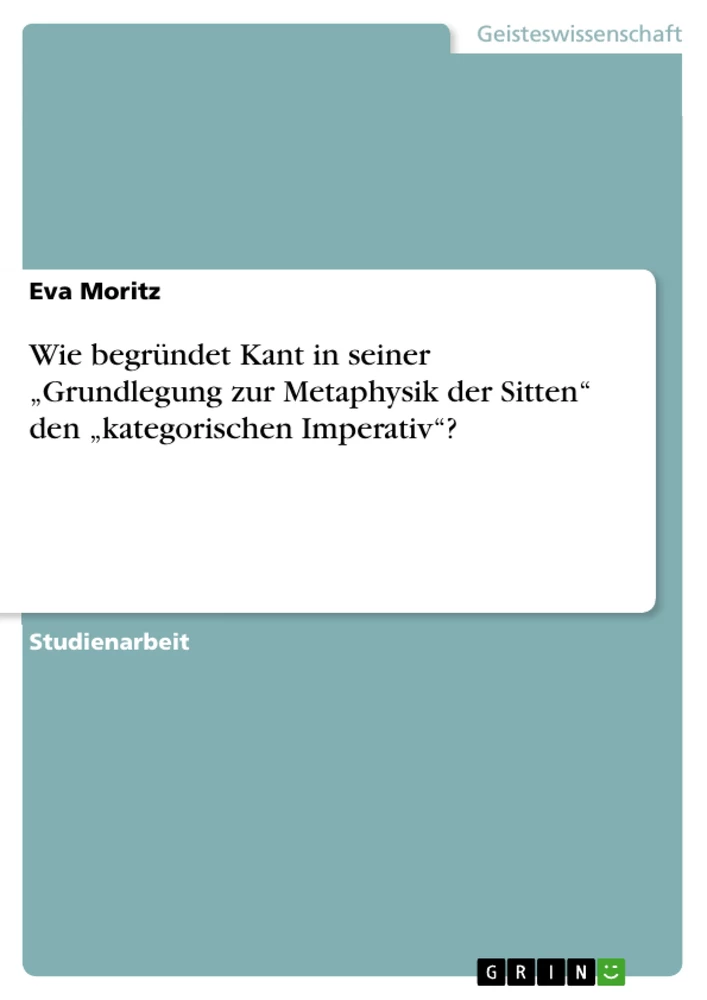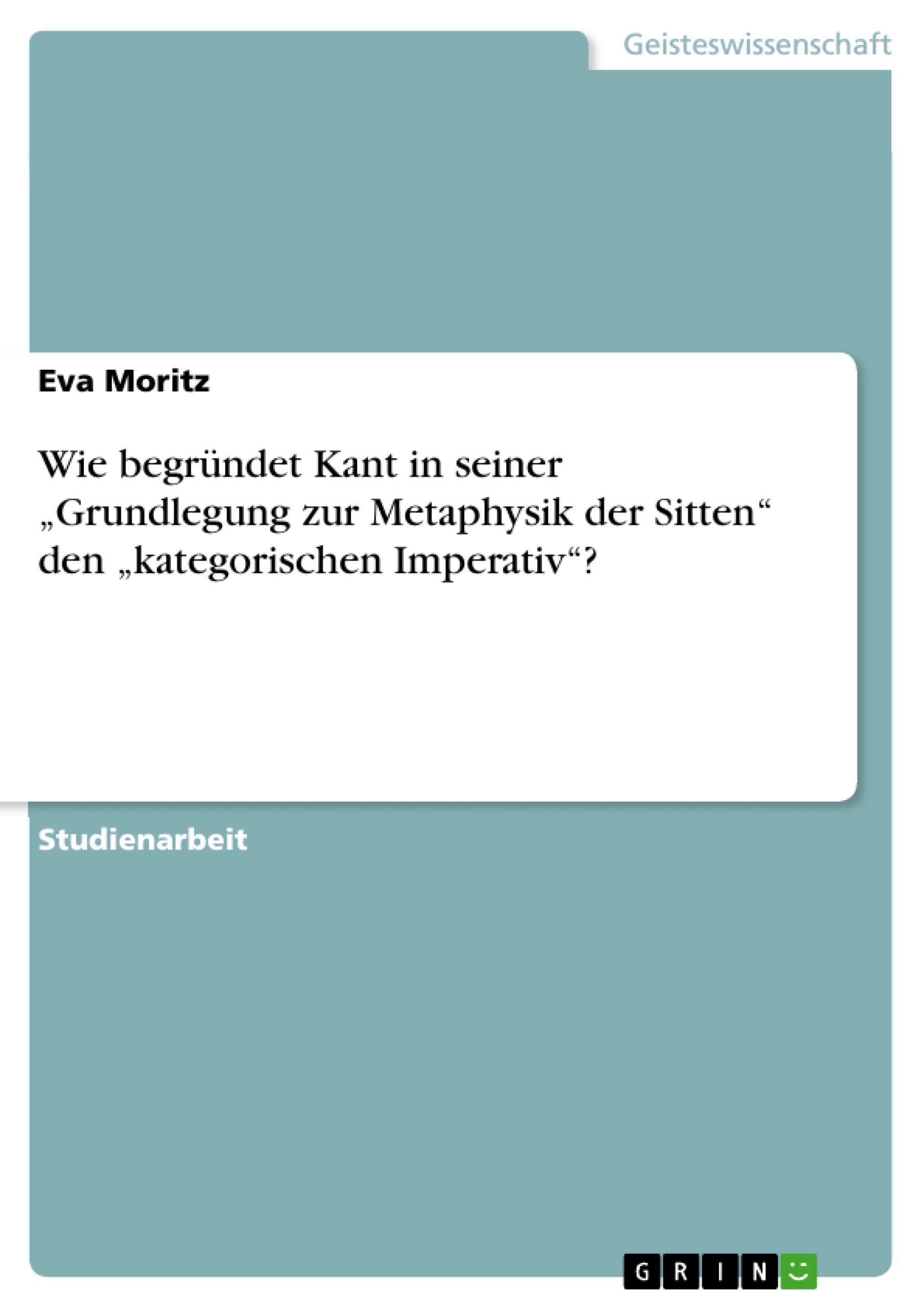Wir alle entscheiden uns jeden Tag zwischen mehreren Handlungen. Dabei fällt uns die eine oder andere Wahl besonders leicht und läuft völlig unbewusst ab, andere bedürfen eingehender Betrachtung und die „richtige“ Entscheidung scheint uns doch unmöglich aufzufinden. Letztere beschäftigen sich oftmals mit moralischen Problemen und begegnen uns in nur geringem Maße. Ein aktuelles, wenn auch nicht alltägliches Beispiel für ein solches Dilemma ist die Frage, ob man ein Passagierflugzeug abschießen darf, um dadurch einen Terroranschlag zu vereiteln. Eine Situation, die jedem von uns passieren kann, ist folgende: Stellen Sie sich vor, Sie seien seit Monaten mit einem Pärchen befreundet; sowohl mit der Frau Claudia als auch mit dem Mann Frank verstehen Sie sich ausgezeichnet. An einem Abend in der Disco geht Frank fremd und bittet Sie, es Claudia nicht zu erzählen. Diese wittert aber Verdacht und fragt Sie, ob sie etwas wüssten. Wie sollen Sie sich nun verhalten? Ist es überhaupt möglich, das Richtige zu tun, geschweige denn zu wissen, was das Richtige ist? Besonders zur Zeit der Aufklärung war das eine zentrale Fragestellung: Kann der Mensch aus eigenen Mitteln das logisch richtige erkennen?
Wäre es nicht praktisch, wenn man eine Formel hätte, in die man seine Variablen (seine Situation) einsetzen könnte und die „richtige“ Entscheidung als Ergebnis herauskäme?
Kant hat genau das versucht - die Erstellung einer „Handlungs - Findungs - Formel“ für moralische Fragestellungen. In dieser Arbeit soll diese Formel vorgestellt und deren Begründung untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des kategorischen Imperativs
- Formen des kategorischen Imperativs im zweiten Abschnitt
- Naturgesetz - Formel
- Zweck - an sich - Formel
- Autonomie - Formel
- Reich der - Zwecke - Formel
- Argumentationsverlauf in der ersten Hälfte des dritten Abschnitts
- Reflektion der Argumentation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Begründung des „kategorischen Imperativs“ in Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“. Ziel ist es, die Formel des kategorischen Imperativs vorzustellen und deren Begründung zu untersuchen.
- Der kategorische Imperativ als oberste Prinzip der Moralität
- Die verschiedenen Formen des kategorischen Imperativs
- Die Anwendung des kategorischen Imperativs auf konkrete Handlungssituationen
- Die Bedeutung des Autonomiebegriffs in Kants Moralphilosophie
- Das Ideal eines „Reiches der Zwecke“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Der Text beginnt mit einer Einführung in die Problematik des moralischen Handelns und die Frage nach der Möglichkeit, das Richtige zu erkennen. Es wird ein aktuelles Beispiel für ein moralisches Dilemma vorgestellt und die zentrale Frage der Aufklärung aufgeworfen: Kann der Mensch aus eigenen Mitteln das logisch richtige erkennen?
2. Definition des kategorischen Imperativs
In diesem Kapitel wird der kategorische Imperativ (KI) als „Handlungs-Findungs-Formel“ für moralische Fragestellungen vorgestellt. Die Formel lautet: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
3. Formen des kategorischen Imperativs im zweiten Abschnitt
Der Text erläutert verschiedene Formen des KI's, die im zweiten Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ auftreten. Dazu gehören die Naturgesetz-Formel, die Zweck-an-sich-Formel, die Autonomie-Formel und die Reich der Zwecke-Formel.
3.1. Naturgesetz - Formel
Diese Formel ist eine Umformulierung des allgemeinen Prinzips des KI's und betont die Allgemeingültigkeit eines moralischen Gesetzes.
3.2. Zweck - an sich - Formel
Hier wird die Menschheit als Zweck an sich betrachtet, der nicht bloß als Mittel für einen beliebigen Zweck gebraucht werden darf.
3.3. Autonomie - Formel
Diese Formel betont die Selbstgesetzgebung des Willens eines Vernunftwesens.
3.4. Reich der Zwecke - Formel
Dieses Kapitel beschreibt das Idealbild eines „Reiches der Zwecke“, in dem vernünftige Wesen durch gemeinschaftliche objektive Gesetze verbunden sind.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, Moralität, Vernunft, Autonomie, Selbstgesetzgebung, Reich der Zwecke, Maxime, Naturgesetz, Zweck an sich, Handlung, Entscheidung,
- Quote paper
- Eva Moritz (Author), 2007, Wie begründet Kant in seiner „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ den „kategorischen Imperativ“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/87111