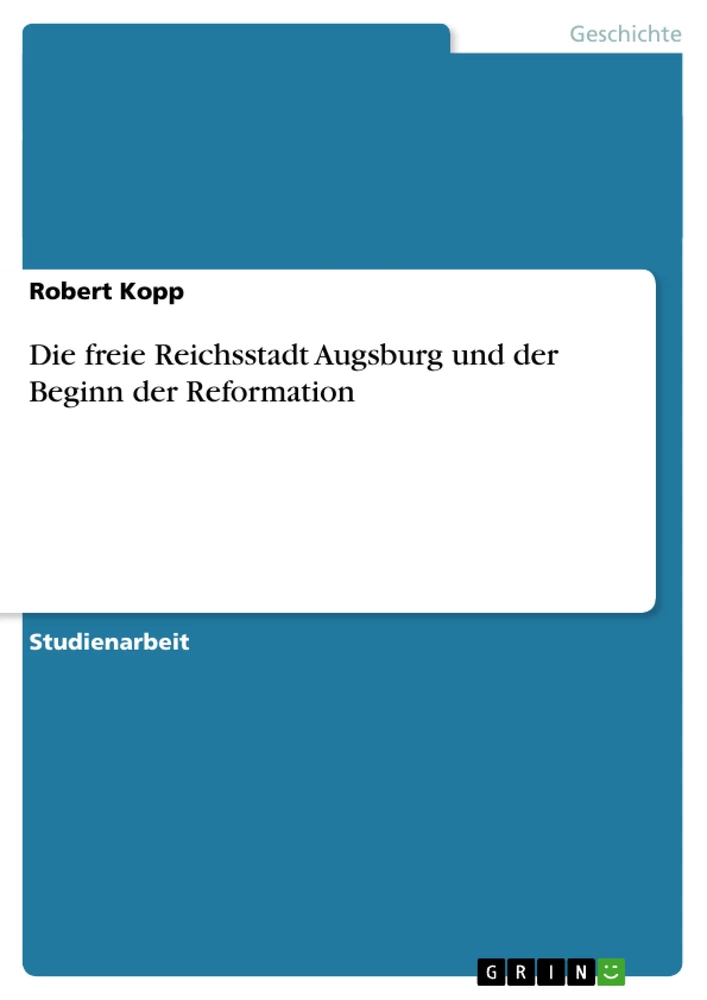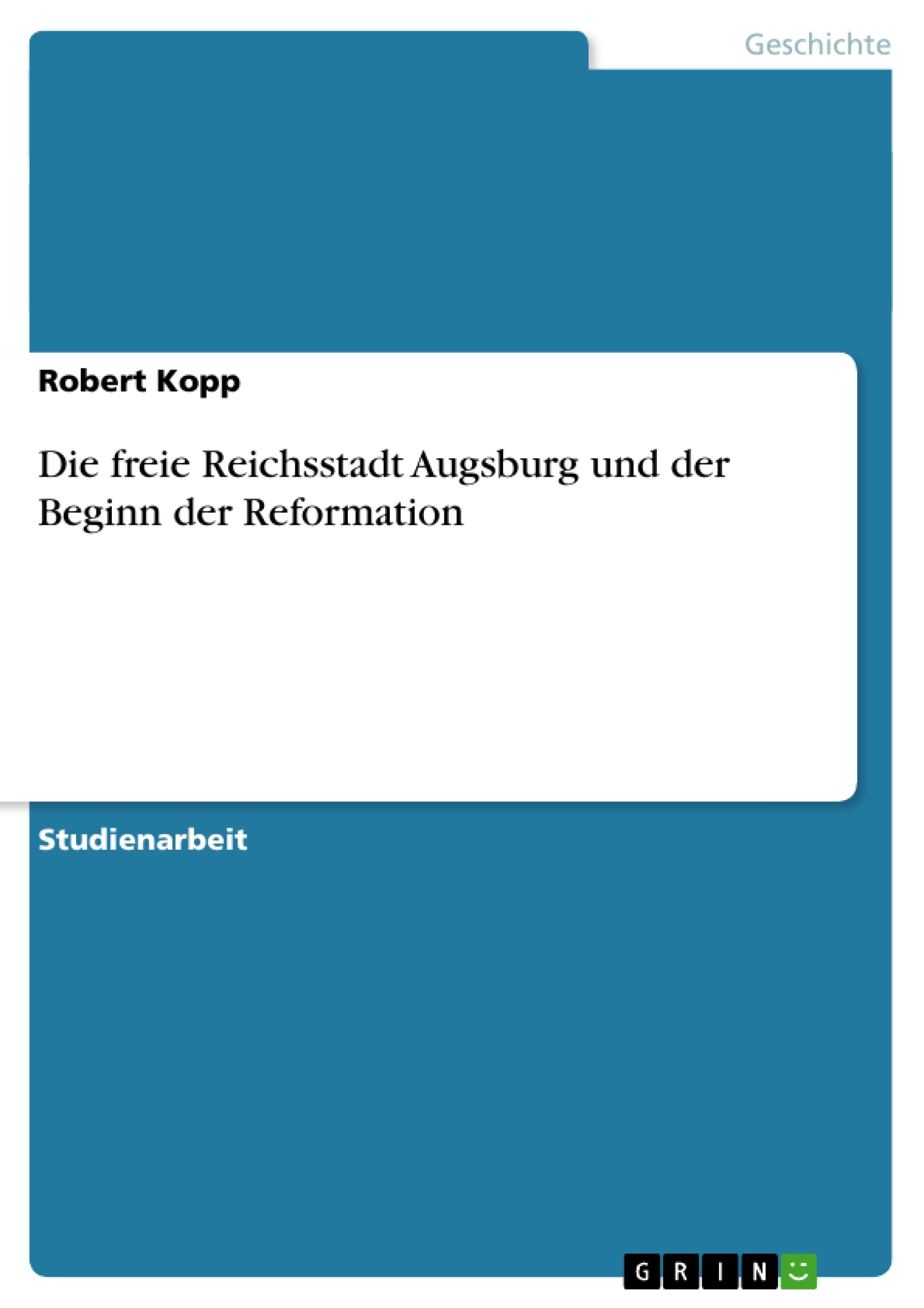"Weß´ Brot ich eß´, des Lied ich sing" bezeichnet Walther von der Vogelsweide treffend das im Mittelalter übliche, durch materielle Bedürfnisse induzierte Unterordnungsverhältnis des Volkes unter den Willen der adeligen Besitz- und Herrschaftsschicht. Im Mittelalter war ökonomische Macht eng gekoppelt an adligen Territorialbesitz; Handwerk und Handel waren dem primären Sektor der Landwirtschaft gegenüber relativ unbedeutend, und Arbeitskräfte gab es gegen Kost und Logie zuhauf; nicht selten waren die auch noch Leibeigene, also Eigentum des Herrschers. Nennenswerter Grundbesitz aber ist - neben der Kirche - dem vom Kaiser damit zu belehnenden Adel vorbehalten.
Ein interessantes Licht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse wirft die Beziehung zwischen Territorialadel und der quasi das Glaubensmonopol innehabenden katholischen Kirche: Um nicht den Besitz durch die damals noch übliche Realteilung zu schmälern oder Zwistigkeiten innerhalb der Familie aufkommen zu lassen, war es beim Adel übliche Praxis, Nachgeborene entweder auszuheiraten oder in den Dienst der Kirche treten zu lassen. Diese wollten i. d. R., zu Nonnen oder Priestern geweiht, einerseits die materiellen Annehmlichkeiten ihrer bisherigen weltlichen Stellung damit aber nicht aufgeben, andererseits ihr Gesicht als Adelige nicht verlieren, und finanzierten so nur allzuoft ihr eigenes herrschaftliches Leben auf Kosten der Stifte und Bistümer und- des Glaubens. Die weltlichen Interessen des Klerus - man denke nur an den jahrhundertelang immer wieder aufflammenden Investiturstreit- waren so oft größer als sein Interesse an einem wahrhaftigen und regen Glaubensleben. Die zu Kirchenoberen aufgestiegenen Adligen wiederum wollten ihresgleichen um sich sehen und unterstützten den adligen Nepotismus innerhalb der Kirche. So verwundert es nicht, daß die überwiegende Zahl der hohen kirchlichen Würdenträger im Reich adlige Namen trugen.
Daß sich durch die Praxis, kirchliche Posten als Verschiebebahnhof für die Machtinteressen des Adels zu nutzen alsbald mehr Saulusse denn Paulusse unter den mitrabehüteten und rotbekleideten Excelllenzen befanden, nimmt wohl kaum wunder.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Gründe der Reformation
- Verfassungsschein und Verfassungswirklichkeit: Oligarchen führen den Geist der Zunftverfassung ad absurdum.
- die wirtschaftlichen Verhältnisse: in einer Zeit der Teuerung werden die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher.
- Umgang der Gesellschaft mit „Sündern“ und Schwachen: Ausgeliefertsein gegenüber Schicksalsschlägen und Unsicherheit der Person.
- Die Amtskirche in Augsburg: Unterwanderung des geistlichen Lebens durch wirtschaftliche und politische Interessen des Klerus.
- Ursachen der Reformation
- Der neuerfundene Buchdruck erlaubt jedermann den Zugang zur neuen Lehre und ihre schnelle Verbreitung.
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Einführung der Reformation in Augsburg. Ziel ist es, die Gründe und Ursachen für das Einsetzen der Reformation in Augsburg zu beleuchten und die damaligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, die die Reformation begünstigten, zu analysieren.
- Die Rolle des städtischen Patriziats und die Auswirkungen des Oligarchenregimes
- Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die Gesellschaft
- Der Umgang der Gesellschaft mit „Sündern“ und Schwachen
- Die Rolle der Amtskirche und der Einfluss weltlicher Interessen
- Die Bedeutung des Buchdrucks für die Verbreitung der neuen Lehre
Zusammenfassung der Kapitel
Im Vorwort wird zunächst ein Überblick über die gesellschaftlichen Verhältnisse im Mittelalter gegeben. Dabei wird die Bedeutung der Kirche, die Rolle des Adels und die enge Verbindung von ökonomischer Macht und Territorialbesitz hervorgehoben. Die Entwicklung der Reichsstädte, insbesondere Augsburgs, als Ausdruck des wachsenden Bedürfnisses nach persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit wird im Anschluss beleuchtet. Die Kapitel über die Gründe und Ursachen der Reformation setzen sich dann mit der politischen und wirtschaftlichen Situation in Augsburg auseinander. Dabei werden die Auswirkungen des Oligarchenregimes auf die Gesellschaft, die Armut der Bevölkerung und die Unterwanderung des geistlichen Lebens durch die Kirche analysiert. Die Bedeutung des Buchdrucks für die Verbreitung der neuen Lehre wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die freie Reichsstadt Augsburg, Reformation, Oligarchen, Zunftverfassung, wirtschaftliche Verhältnisse, Teuerung, Armut, Kirche, Klerus, Buchdruck, neue Lehre, Ständekämpfe
- Arbeit zitieren
- Robert Kopp (Autor:in), 1998, Die freie Reichsstadt Augsburg und der Beginn der Reformation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8691