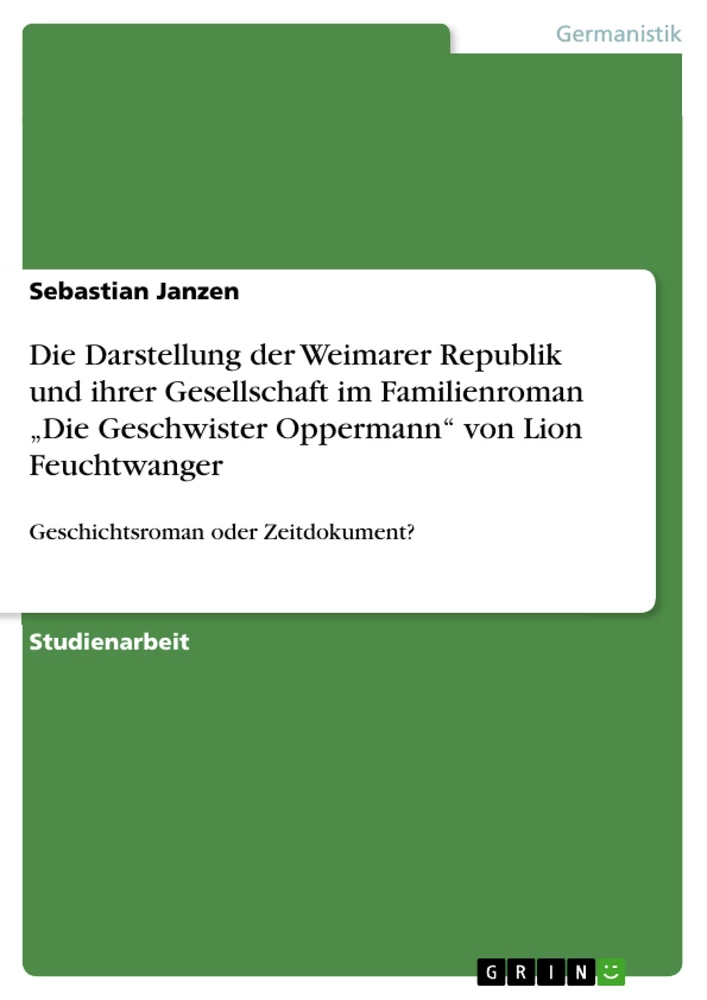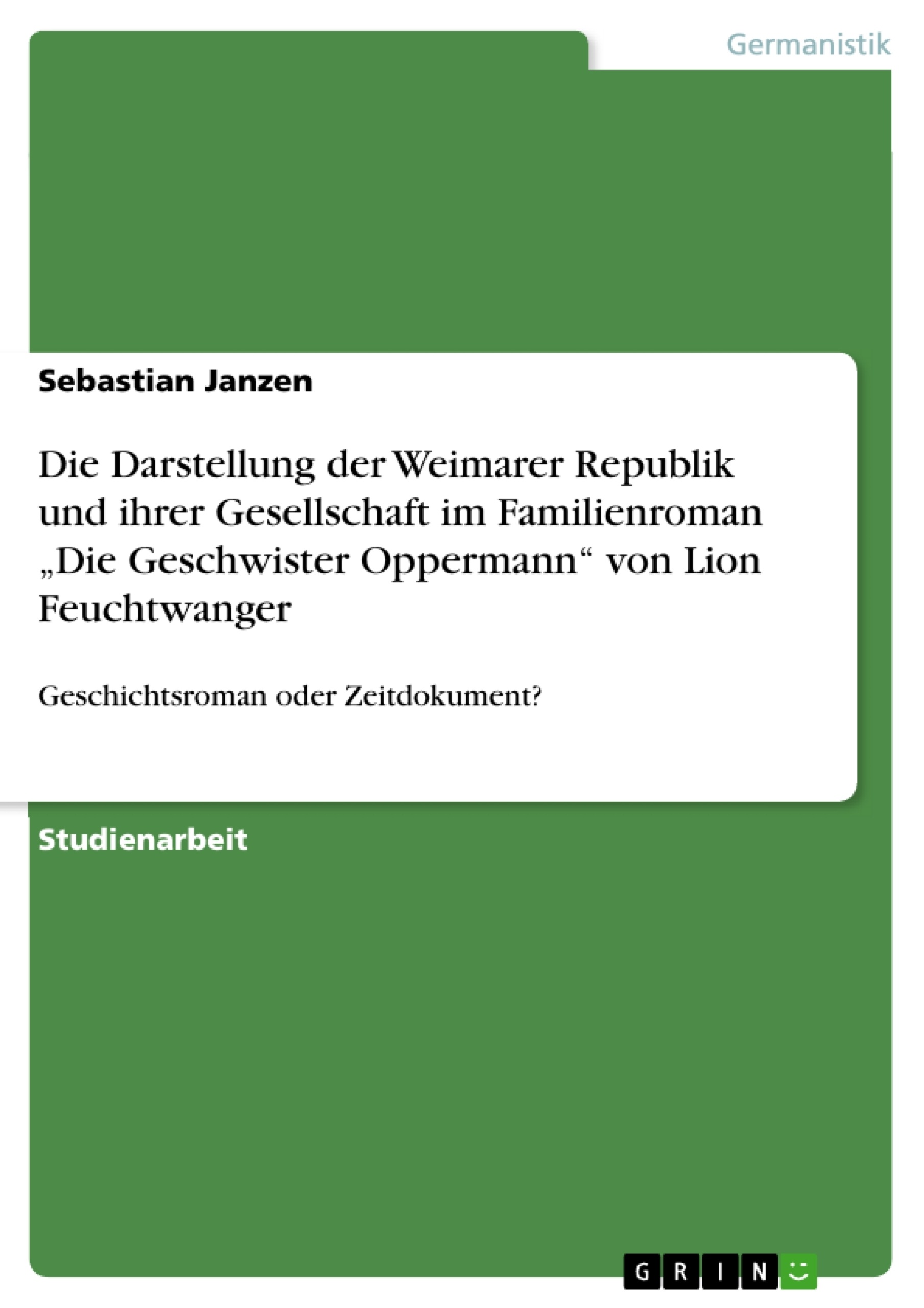In Sanary-sur-mer, einem kleinen Fischerdorf in Südfrankreich, welches während der Herrschaft der Nationalsozialisten vielen vom Regime verfolgten Schriftstellern als Wohnsitz diente, begann Lion Feuchtwanger im April 1933 mit den Arbeiten an seinem ersten Prosawerk im Exil: „Die Geschwister Oppermann“. War er vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten vor allem als Autor historischer Romane bekannt geworden, so wählte Feuchtwanger für „Die Geschwister Oppermann“ als geschichtlichen Hintergrund die Ereignisse in Deutschland zwischen November 1932 und Sommer 1933. Er befasste sich also mit der unmittelbaren Wirklichkeit des Zusammenbruchs der Weimarer Republik und der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Der Roman erzählt die Geschichte des Niedergangs einer altberlinisch-jüdischen Familie, welche den aufkommenden Nationalsozialismus anfangs nicht ernst nimmt und mit fortschreitender Zeit erkennen muss, dass für sie ein Verweilen in Deutschland unmöglich und lebensbedrohlich ist.
Es können zwei Themenbereiche des Romans festgestellt werden: Er befasst sich mit „der Geschichte der Vertreibung und Auseinandersprengung der Familie Oppermann durch den Antisemitismus sowie mit der Thematik der Selbsttäuschungen, denen das Bildungsbürgertum, insbesondere das deutsch-jüdische, in den Jahren 1932 und 1933 erlag. Kritisiert wird bis heute am häufigsten, dass das Motiv des Rassenwahns zu sehr im Mittelpunkt der Fabel steht, als dass das Geschehen ein Panorama der deutschen Vorgänge sein könnte. Ebenso häufig wird die Beschränkung der Darstellung auf die soziale Schicht des Bürgertums als Schwachpunkt herausgestellt und angemerkt, dass der Roman nur den Angriff des Kleinbürgers auf die großbürgerlichen Positionen im jüdischen Bereich darstellt, andere Gesellschaftsschichten jedoch nicht oder nur am Rande eine Rolle spielen, so dass zu einer gesellschaftlichen Repräsentanz wesentliche Elemente fehlen. Zu zeigen, dass der Roman trotzdem, oder vielleicht sogar gerade aufgrund der Konzentration auf verschiedene Teilschichten des Bürgertums dem heutigen Leser einen Einblick in die Lebensumstände der Jahre 1932 und 1933 gibt, ist Ziel dieser Arbeit. Hierbei soll von vornherein deutlich herausgestellt werden, dass es nicht die Absicht Feuchtwangers war, eine umfangreiche Faschismusanalyse in den Roman zu integrieren. Vielmehr war es Feuchtwangers Intention, Zeugnis abzulegen von der neuen Situation in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Darstellung der Weimarer Republik und ihrer Gesellschaft in Feuchtwangers Familienroman
- Historische Grundlagen (Zusammenbruch der Weimarer Republik, Aufkommen des Nationalsozialismus)
- Die Gestaltung politisch-gesellschaftlicher Sujets im Roman
- Repräsentanten des „unpolitischen“ Bürgertums
- Repräsentanten der „unpolitischen“ bürgerlichen Intelligenz
- Repräsentanten des „unpolitischen“ Kleinbürgertums
- Politisch motivierte Gegner des Nationalsozialismus
- „Die Geschwister Oppermann“ als Absage an das Modell des Familienromans zur literarischen Darstellung von Geschichte
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit Lion Feuchtwangers Roman „Die Geschwister Oppermann“ und dessen Darstellung der Weimarer Republik und ihrer Gesellschaft. Ziel ist es, die gesellschaftlichen Veränderungen in der Endphase der Weimarer Republik und die Machtübernahme der Nationalsozialisten anhand der fiktiven Figuren und ihrer Lebensgeschichten zu analysieren. Dabei soll gezeigt werden, wie der Roman den Zusammenbruch der Weimarer Republik und den Aufstieg des Nationalsozialismus aus der Sicht der Bürgerlichen und insbesondere der jüdischen Bevölkerung darstellt.
- Der Zusammenbruch der Weimarer Republik und die Machtübernahme der Nationalsozialisten
- Die Darstellung verschiedener gesellschaftlicher Schichten in der Endphase der Weimarer Republik
- Die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus und der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung
- Die Rolle der Familie und des Familienromans in der Darstellung von Geschichte
- Die Kritik am „unpolitischen“ Bürgertum und der Rolle der Intelligenz in der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Romans beginnt mit dem 50. Geburtstag von Gustav Oppermann am 16. November 1932. Der Roman schildert die Geschichte der Familie Oppermann in den Monaten zwischen November 1932 und Sommer 1933. Dabei wird die politische und gesellschaftliche Entwicklung der Weimarer Republik und der Aufstieg der Nationalsozialisten aus der Sicht dieser Familie dargestellt. Der Roman zeichnet ein Bild der Spaltung der Gesellschaft durch den zunehmenden Antisemitismus und zeigt die Verzweiflung der Familie Oppermann, die sich mit den neuen Machtverhältnissen nicht abfinden kann.
Das erste Kapitel „Historische Grundlagen“ gibt einen Überblick über die historischen Ereignisse, die zum Zusammenbruch der Weimarer Republik und zur Machtübernahme der Nationalsozialisten geführt haben. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten der Weimarer Republik und ihre Repräsentanten im Roman vorgestellt. Dabei werden die „unpolitischen“ Bürgerlichen, die bürgerliche Intelligenz, das Kleinbürgertum sowie politisch motivierte Gegner des Nationalsozialismus beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Romans sind der Niedergang der Weimarer Republik, der Aufstieg des Nationalsozialismus, der Antisemitismus, die Verfolgung der Juden, die Rolle des Familienromans in der Darstellung von Geschichte sowie die Kritik am „unpolitischen“ Bürgertum.
- Quote paper
- Sebastian Janzen (Author), 2005, Die Darstellung der Weimarer Republik und ihrer Gesellschaft im Familienroman „Die Geschwister Oppermann“ von Lion Feuchtwanger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86890