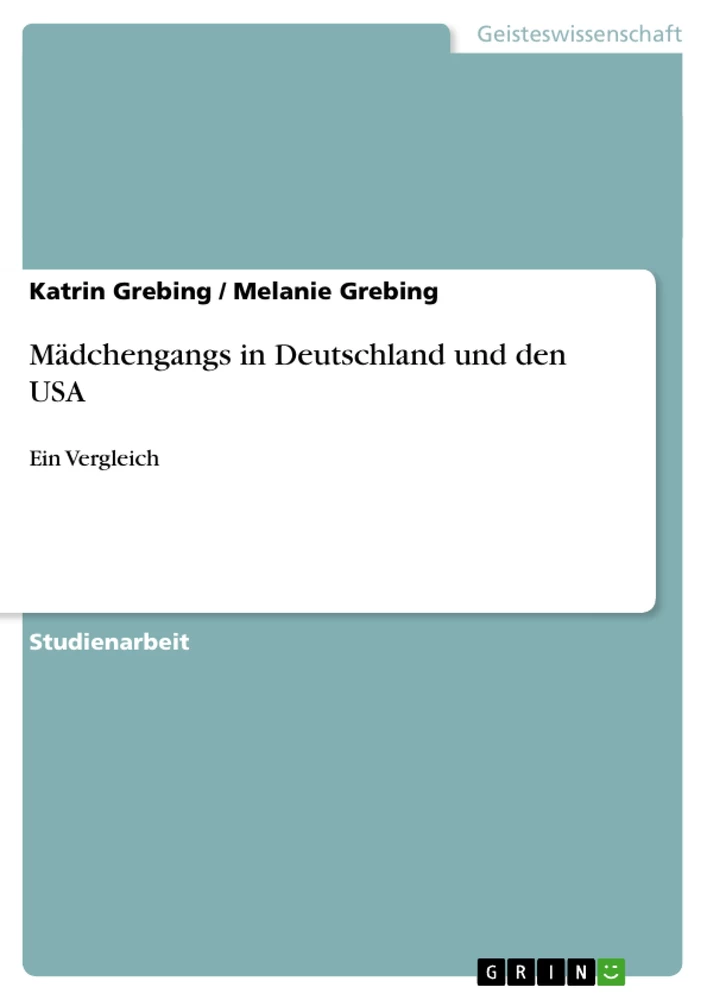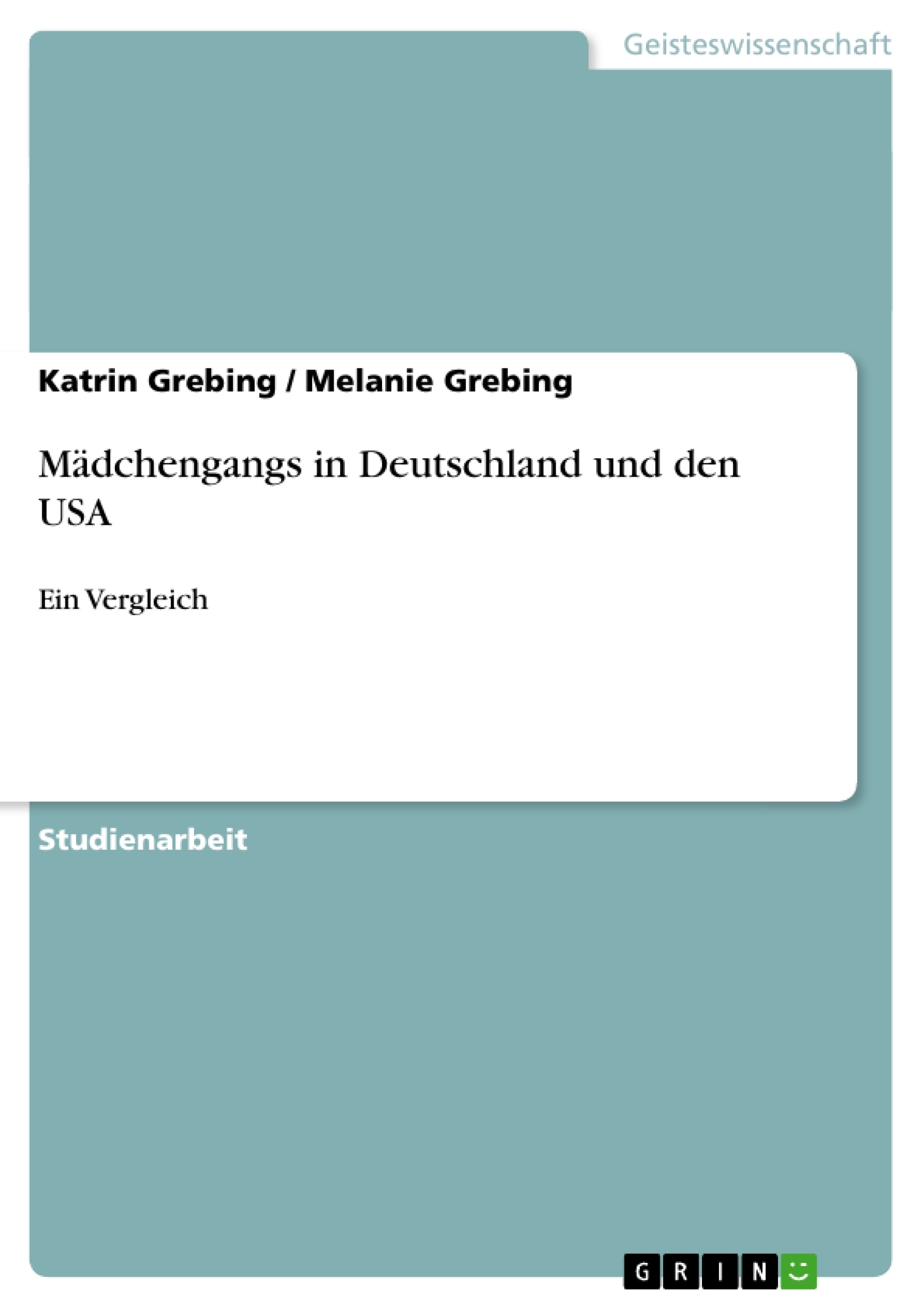Den Begriff "Gang" verbinden die meisten Menschen automatisch mit kriminellen, farbigen Jugendlichen, die sich in den USA Straßenschlachten liefern und mit Drogen dealen. In diesem Szenario spielen Mädchen eine untergeordnete Rolle. In letzter Zeit haben amerikanische Medien gewalttätige Gangmädchen für sich entdeckt und mit reißerischen Berichten die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt. Doch wie sieht es in der Realität mit diesen Mädchen wirklich aus? Weil das Hauptaugenmerk der Forschung noch immer auf männlichen Bandenmitgliedern liegt, gibt es über die Mädchen nur wenige Erkenntnisse. Besonders über den Bereich der rein weiblichen Gangs ist kaum etwas bekannt.
Noch weniger Forschungsergebnisse über dieses Thema gibt es in Deutschland. Das liegt wahrscheinlich daran, dass kriminelle Mädchengangs hierzulande kein gesellschaftliches Problem darstellen. Dennoch gibt es sie und die Forschung beginnt, diese Gruppen zu analysieren. Uns interessierten vor allem die Gründe für die Gewaltbereitschaft der Mädchen. Außerdem wollten wir wissen, welche Unterschiede im Gruppenleben in Bezug auf deren Entstehung, Aktivitäten und ihre Bedeutung für die Mitglieder zwischen den USA und Deutschland bestehen. Dabei gehen wir auch auf das Bild, das die Mädchen von sich selbst haben, vergleichend ein.
Bei diesem Vergleich benutzten wir in Bezug auf Deutschland, uns an der Forschung orientierend, die Bezeichnungen "gewaltbereite Jugendclique" oder "Jugendgruppe". Im Teil über die USA sprechen wir weiterhin von "Gangs" und "Banden". In den USA wird schon seit Anfang des Jahrhunderts soziologische Bandenforschung betrieben. Doch von Anfang an hatten die gewählten Erklärungsansätze gemein, dass sie sich hauptsächlich mit männlichen Banden beschäftigen. Frauen und Mädchen treten nur als Randerscheinungen auf. Das kann unter anderem daran liegen, dass es insgesamt weniger Mädchen als Jungen in Banden gibt, und noch viel weniger Banden, die nur aus Mädchen bestehen. So waren 1975 in New York nur sechs Prozent aller Bandenmitglieder weiblich. Außerdem gab es nur 6 reine Mädchenbanden. Diese Betrachtungsweise, in der „roles were described by male gang members to male researchers and interpreted by male academics“, hat zu einem recht einseitigen Bild von weiblichen Bandenmitgliedern geführt. Ob in Cohens subkulturtheoretischen Ansätzen oder auf Mertons Anomietheorie basierenden Studien von Cloward und Ohlin , der Fokus lag lange Zeit auf männlichen Bandenmitgliedern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Banden in den USA
- 2.1. Banden in sozialen Zusammenhängen
- 2.1.1. Das soziale Umfeld
- 2.1.2. Der Theorieansatz der Lebenssituation
- 2.2. Entstehung und Aufbau
- 2.3. Aspekte des Bandenlebens
- 2.3.1. Gründe für den Beitritt
- 2.3.2. Leben in der Bande
- 2.3.3. Kriminalität
- 3. Banden in Deutschland
- 3.1. Banden in sozialen Zusammenhängen
- 3.1.1. Das soziale Umfeld
- 3.2. Entstehung und Aufbau
- 3.3. Aspekte des Cliquenlebens
- 3.3.1. Die Bedeutung der Clique für die Mädchen
- 3.3.2. Funktionen der Gewalt
- 3.3.3. Die Aktionsmacht
- 3.3.4. Kriminalität
- 4. Vergleich der Banden
- 4.1. Das soziale Umfeld
- 4.2. Entstehung und Aufbau
- 4.3. Aspekte des Bandenlebens
- 4.4. Kriminalität
- 4.5. Die Bedeutung der Gruppe
- 5. Die Veränderung des Weiblichkeitsbildes
- 5.1. Neupositionierung im Geschlechterverhältnis in Deutschland?
- 5.2. Überlegungen zu möglichen Verschiebungen des Weiblichkeitsbildes in den USA
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht gewaltbereite Mädchengangs in den USA und Deutschland im Vergleich. Ziel ist es, die Gründe für die Gewaltbereitschaft der Mädchen zu erforschen und Unterschiede im Gruppenleben beider Länder hinsichtlich Entstehung, Aktivitäten und Bedeutung für die Mitglieder aufzuzeigen. Der Vergleich umfasst auch die Selbstwahrnehmung der Mädchen.
- Soziale Faktoren und Ursachen für die Entstehung von Mädchengangs
- Vergleich der sozialen Strukturen und des Umfelds in den USA und Deutschland
- Analyse der Gewaltbereitschaft und ihrer Funktionen innerhalb der Gruppen
- Unterschiede im Gruppenleben (Entstehung, Aktivitäten, Bedeutung für die Mitglieder)
- Die Rolle des Weiblichkeitsbildes im Kontext von Mädchengangs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die gängige Vorstellung von „Gangs“ als kriminelle, vorwiegend männliche Jugendgruppen in den USA vor und hebt den Mangel an Forschung zu weiblichen Gangs, besonders in Deutschland, hervor. Sie benennt die Forschungsfragen: die Ursachen für Gewaltbereitschaft bei Mädchen und die Unterschiede im Gruppenleben zwischen den USA und Deutschland. Der Fokus liegt auf dem Vergleich und der Analyse der Selbstwahrnehmung der beteiligten Mädchen.
2. Banden in den USA: Dieses Kapitel beleuchtet die soziologische Bandenforschung in den USA, die sich historisch hauptsächlich auf männliche Banden konzentriert hat. Es zeigt den Mangel an Forschung zu weiblichen Banden auf und diskutiert die Gründe dafür (geringe Anzahl weiblicher Mitglieder und reiner Mädchengangs). Das Kapitel kritisiert die einseitige Perspektive der Forschung und die Ausblendung weiblicher Perspektiven in bestehenden Theorien.
2.1. Banden in sozialen Zusammenhängen: Dieser Abschnitt analysiert den Zusammenhang zwischen sozialen Strukturen und der Entstehung von Gangs. Es werden Theorien sozialer Desorganisation für instabile Gegenden und Subkulturtheorien bzw. Theorien ökonomischer Marginalisierung für sozial stabilere Gebiete vorgestellt.
2.1.1. Das soziale Umfeld: Hier wird das soziale Umfeld von Gangs in den USA detailliert beschrieben: Armut, Arbeitslosigkeit, ethnische Minderheiten, mangelnde Bildung, fehlende Freizeitangebote, Gewalt und zerrüttete Familienstrukturen. Es wird verdeutlicht, wie diese Faktoren zur Gangbildung beitragen und einen Teufelskreis aus Armut und mangelnder Bildung aufrechterhalten.
2.1.2. Der Theorieansatz der Lebenssituation: Dieser Unterabschnitt präsentiert die Theorie der Lebenssituation als Erklärung für die Beteiligung von Mädchen an Gangs. Die multiple Marginalität (Diskriminierung aufgrund von Klasse, Ethnie und Geschlecht) wird als entscheidender Faktor hervorgehoben. Die eingeschränkten Möglichkeiten für Mädchen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen und die traditionellen Weiblichkeitsbilder ihrer Ethnien werden als wichtige Einflussfaktoren betrachtet.
3. Banden in Deutschland: Dieses Kapitel widmet sich dem Phänomen von Mädchengangs in Deutschland, wobei die Bezeichnung „gewaltbereite Jugendclique oder Jugendgruppe“ verwendet wird. Im Gegensatz zu den USA stellen kriminelle Mädchengangs in Deutschland kein so großes gesellschaftliches Problem dar, dennoch existieren sie und werden zunehmend von der Forschung untersucht.
3.1. Banden in sozialen Zusammenhängen: Ähnlich wie im US-amerikanischen Kontext werden hier die sozialen Zusammenhänge und das Umfeld, in denen gewaltbereite Jugendcliquen entstehen, analysiert. Die Parallelen und Unterschiede im Vergleich zu den USA werden implizit angesprochen, da die Beschreibung des sozialen Umfelds den Vergleich der beiden Länder vorbereitet.
3.2. Entstehung und Aufbau: Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung und den Aufbau von gewaltbereiten Jugendcliquen in Deutschland. Es wird auf die Besonderheiten eingegangen, die sich von den in den USA beschriebenen Gangs unterscheiden könnten, um den Vergleich im späteren Kapitel vorzubereiten.
3.3. Aspekte des Cliquenlebens: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Aspekte des Lebens in gewaltbereiten Jugendcliquen in Deutschland. Die Bedeutung der Clique für die Mädchen, die Funktionen der Gewalt, die Aktionsmacht und die Kriminalität werden beleuchtet und analysiert. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zum Leben in US-amerikanischen Gangs.
4. Vergleich der Banden: Dieses Kapitel vergleicht die Mädchengangs in den USA und Deutschland anhand ihrer sozialen Umgebung, Entstehung, Aufbau, Aspekte des Bandenlebens und Kriminalität. Die Bedeutung der Gruppe für die Mitglieder in beiden Ländern wird ebenfalls untersucht. Hier werden die vorherigen Kapitel zusammengeführt und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet.
5. Die Veränderung des Weiblichkeitsbildes: Das Kapitel analysiert die möglichen Veränderungen des Weiblichkeitsbildes im Kontext der Mädchengangs in Deutschland und den USA und beleuchtet die Neupositionierung der Mädchen im Geschlechterverhältnis. Der Fokus liegt auf den impliziten und expliziten Auswirkungen des Bandenlebens auf die Geschlechterrollen und Selbstwahrnehmung der Mädchen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewaltbereite Mädchengangs in den USA und Deutschland
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht gewaltbereite Mädchengangs in den USA und Deutschland im Vergleich. Ziel ist es, die Gründe für die Gewaltbereitschaft der Mädchen zu erforschen und Unterschiede im Gruppenleben beider Länder hinsichtlich Entstehung, Aktivitäten und Bedeutung für die Mitglieder aufzuzeigen. Der Vergleich umfasst auch die Selbstwahrnehmung der Mädchen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf soziale Faktoren und Ursachen für die Entstehung von Mädchengangs, vergleicht die sozialen Strukturen und das Umfeld in den USA und Deutschland, analysiert die Gewaltbereitschaft und ihre Funktionen innerhalb der Gruppen, untersucht Unterschiede im Gruppenleben (Entstehung, Aktivitäten, Bedeutung für die Mitglieder) und beleuchtet die Rolle des Weiblichkeitsbildes im Kontext von Mädchengangs.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Banden in den USA, Banden in Deutschland, Vergleich der Banden, Die Veränderung des Weiblichkeitsbildes und Resümee. Innerhalb der Kapitel werden verschiedene Aspekte wie das soziale Umfeld, Entstehung und Aufbau der Gruppen, Aspekte des Banden-/Cliquenlebens und Kriminalität detailliert analysiert.
Was wird in Kapitel 2 ("Banden in den USA") behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die soziologische Bandenforschung in den USA, kritisiert den Mangel an Forschung zu weiblichen Banden und diskutiert die Gründe dafür. Es analysiert den Zusammenhang zwischen sozialen Strukturen und der Entstehung von Gangs, beschreibt das soziale Umfeld (Armut, Arbeitslosigkeit etc.) und stellt Theorien wie die Theorie der Lebenssituation vor, um die Beteiligung von Mädchen an Gangs zu erklären.
Was wird in Kapitel 3 ("Banden in Deutschland") behandelt?
Kapitel 3 widmet sich dem Phänomen von Mädchengangs (bzw. gewaltbereiten Jugendcliquen) in Deutschland. Es analysiert die sozialen Zusammenhänge und das Umfeld, in denen diese Gruppen entstehen, beschreibt deren Entstehung und Aufbau und untersucht Aspekte des Cliquenlebens wie die Bedeutung der Clique für die Mädchen, die Funktionen der Gewalt, die Aktionsmacht und die Kriminalität.
Wie werden die Banden in den USA und Deutschland verglichen?
Kapitel 4 vergleicht die Mädchengangs in den USA und Deutschland anhand ihrer sozialen Umgebung, Entstehung, Aufbau, Aspekte des Bandenlebens und Kriminalität. Die Bedeutung der Gruppe für die Mitglieder in beiden Ländern wird ebenfalls untersucht. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgearbeitet.
Welche Rolle spielt das Weiblichkeitsbild?
Kapitel 5 analysiert die möglichen Veränderungen des Weiblichkeitsbildes im Kontext der Mädchengangs in Deutschland und den USA und beleuchtet die Neupositionierung der Mädchen im Geschlechterverhältnis. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen des Bandenlebens auf die Geschlechterrollen und Selbstwahrnehmung der Mädchen.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentralen Forschungsfragen betreffen die Ursachen für Gewaltbereitschaft bei Mädchen und die Unterschiede im Gruppenleben zwischen den USA und Deutschland. Die Selbstwahrnehmung der beteiligten Mädchen steht dabei im Fokus.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit greift auf verschiedene soziologische Theorien zurück, darunter Theorien sozialer Desorganisation, Subkulturtheorien, Theorien ökonomischer Marginalisierung und die Theorie der Lebenssituation, um die Entstehung und die Beteiligung von Mädchen an Gangs zu erklären.
Gibt es einen Resümee?
Ja, Kapitel 6 fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen aus dem Vergleich von Mädchengangs in den USA und Deutschland.
- Quote paper
- Katrin Grebing (Author), Melanie Grebing (Author), 2004, Mädchengangs in Deutschland und den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86880