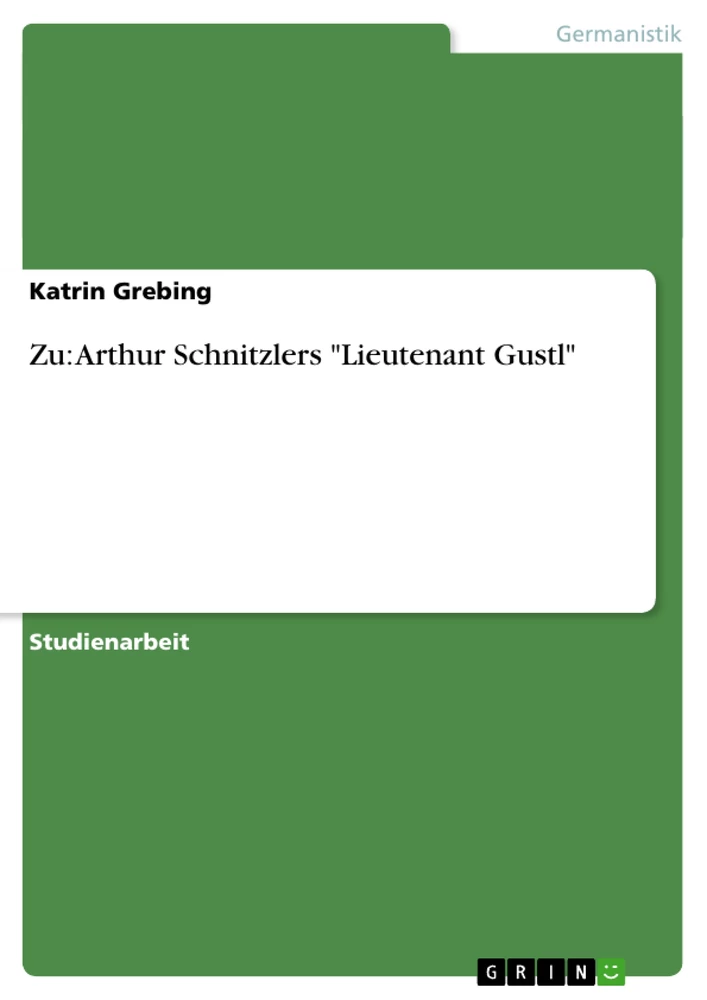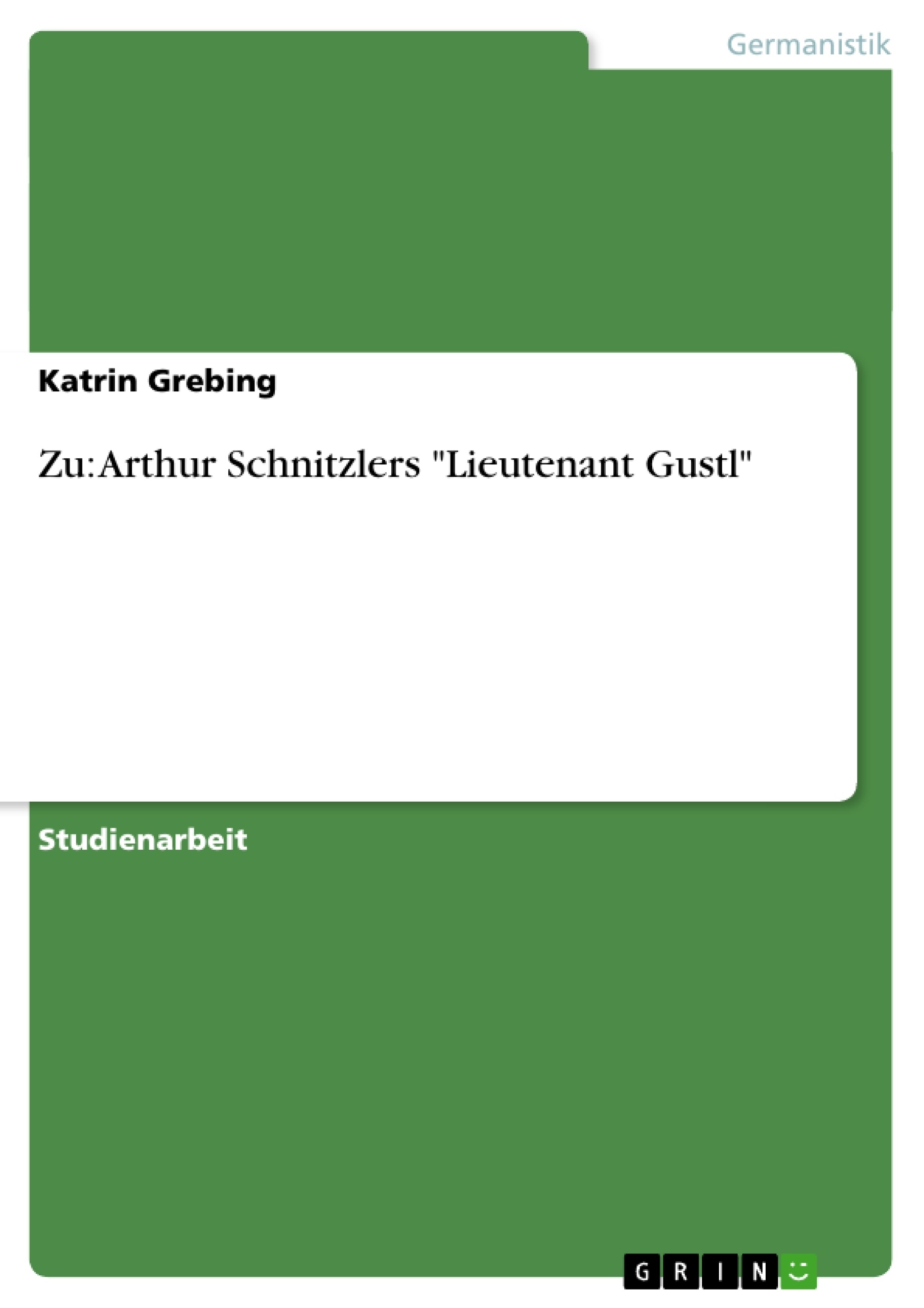In der Zeit vom 13. bis zum 17. Juli schrieb Arthur Schnitzler während eines Urlaubs im Kurhaus von Reichenau die Novelle „Lieutenant Gustl“. Nach einem Konzert wird Leutnant Gustl von dem Bäcker Habetswallner beleidigt. Da dieser satisfaktionsunfähig ist, bleibt Gustl nach dem Ehrenkodex des Militärs nur die Wahl mit Schimpf und Schande seinen Dienst zu quittieren oder sich umzubringen. Er beschließt sich am nächsten Morgen zu erschießen. Bis dahin wandert er durch die Straßen Wiens und denkt über sein Leben, seine Situation und mögliche Auswege nach. Als er morgens vor dem Selbstmord etwas frühstücken will, erfährt er im Kaffeehaus, dass den Bäcker der Schlag getroffen hat. Da niemand etwas von der Beleidigung mitbekommen hat, wirft Gustl den Ehrenkodex erleichtert über den Haufen und beschließt weiterzuleben, als sei nichts geschehen.
Die Novelle erschien am 25.12.1900 als Beilage in der Weihnachtsausgabe der „Neuen freien Presse“. Sie war zu dieser Zeit hochaktuell und hatte großen Erfolg. Aber ihre Inhalte führten zu starken Kontroversen und kosteten ihren Autor das Offizierspatent. Weshalb war die Empörung über diesen Text so groß, dass noch 1962 ein böser Artikel deswegen über Arthur Schnitzler im „“Nachrichtenblatt Alt-Österreichs“ erschien? Und welches Nachspiel hatte die Veröffentlichung der Novelle für ihren Autor?
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Der Charakter des Leutnant Gustl
- B.1. Die Möglichkeiten des Inneren Monologs
- B.2. Der Charakter Leutnant Gustls
- B.3. Das soziale Umfeld: Gustls Verhältnis zu Familie und Militär
- B.4. Leutnant Gustl und die Frauen
- C. Der Ehrenkodex und die Duelle
- C.1. Der Ehrenkodex
- C.2. Das Duell mit dem Doktor
- C.3. Die Beleidigung des Bäckers und ihre Auswirkungen
- D. Die Auswirkungen der Novelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers Novelle „Lieutenant Gustl“ und untersucht den Charakter des Protagonisten, seine soziale Einbettung und die Auseinandersetzung mit dem militärischen Ehrenkodex. Die Arbeit beleuchtet die innovative Verwendung des inneren Monologs und die damit verbundene Darstellung der Psyche des Leutnants.
- Der innere Monolog als literarisches Stilmittel
- Die Charakterisierung Leutnant Gustls und seine psychologischen Konflikte
- Die Rolle des militärischen Ehrenkodex und dessen Auswirkungen
- Gustls soziale Beziehungen und seine Vorurteile
- Die gesellschaftliche Relevanz und die Kontroversen um die Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung präsentiert den Entstehungskontext der Novelle „Lieutenant Gustl“, die während eines Urlaubs im Juli 1900 entstand. Sie beschreibt den zentralen Konflikt – die Beleidigung Gustls durch einen Bäcker und die daraus resultierende existenzielle Krise. Die Einleitung skizziert zudem den großen Erfolg und die heftigen Kontroversen, die die Novelle hervorrief, bis hin zu negativen Artikeln über Schnitzler Jahrzehnte später. Sie etabliert die zentrale Frage nach den Gründen für die vehemente Reaktion auf das Werk.
B. Der Charakter des Leutnant Gustl: Dieses Kapitel analysiert die Figur des Leutnant Gustl und seine Handlungsweise im Kontext der Beleidigung durch den Bäcker. Es unterstreicht die Darstellung von Gustls innerem Erleben mittels des inneren Monologs, der seine Gedanken, Ängste und Vorurteile ungefiltert offenbart. Gustls Orientierung an der Meinung seines Umfelds und seine Tendenz, die Schuld für sein Handeln stets anderen zuzuschieben, werden detailliert beleuchtet. Seine oberflächlichen und vorurteilsbeladenen Beziehungen zu anderen, insbesondere seine Ansichten über Sozialisten und Juden, werden als zentrale Aspekte seines Charakters herausgestellt.
B.1. Die Möglichkeiten des Inneren Monologs: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die literarische Technik des inneren Monologs in Schnitzlers Novelle. Er hebt dessen Innovation in der deutschen Literatur hervor und erläutert, wie dieser Stil die unmittelbare Darstellung des Bewusstseinsstroms des Leutnants ermöglicht. Die Verwendung unvollständiger Sätze, assoziativer Denkstrukturen und die Offenlegung unbewusster Gedanken werden als kennzeichnende Merkmale dieser Technik dargestellt und im Kontext der psychoanalytischen Interessen Schnitzlers interpretiert. Das "scheinbare Denkchaos" wird als genau kalkulierte literarische Strategie zur Charakterisierung Gustls gewertet.
B.2. Der Charakter Leutnant Gustls: Dieser Teil geht detaillierter auf Gustls Charakter ein. Sein Alter, sein orientierungsloses Verhalten und seine Abhängigkeit von der Meinung seiner Umwelt, insbesondere die des Obersts, werden analysiert. Der Text betont Gustls Tendenz zur Selbstrechtfertigung durch die Heranziehung von externen Faktoren und seine unreflektierte Anpassung an die Masse. Seine Schuldzuweisungen an andere Personen und die simplifizierenden, oft abwertenden Kategorisierungen von Menschen in Gruppen (z.B. Sozialisten, Juden) werden als zentrale Charakterzüge herausgearbeitet.
C. Der Ehrenkodex und die Duelle: Das Kapitel thematisiert den militärischen Ehrenkodex und dessen Bedeutung für das Handeln des Leutnants. Es analysiert die verschiedenen Konfliktsituationen, in denen Gustl sich befindet, und wie er sich im Rahmen des Ehrenkodex verhält oder – wie im Fall der Beleidigung durch den Bäcker – zu verhalten glaubt. Die Bedeutung des Duells wird im Kontext der gesellschaftlichen Normen der damaligen Zeit beleuchtet. Die spezifischen Fälle der Konfrontationen mit dem Doktor und dem Bäcker dienen als Beispiele für Gustls Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex und dessen gesellschaftlichen Auswirkungen.
D. Die Auswirkungen der Novelle: Dieser Abschnitt behandelt die Wirkung der Novelle auf die Öffentlichkeit und die Folgen für den Autor. Es wird die große öffentliche Aufmerksamkeit, die sowohl positive als auch negative Reaktionen hervorrief, besprochen. Der Text analysiert die Kontroversen und die daraus resultierenden Konsequenzen für Schnitzler, inklusive des Verlusts seines Offizierspatents. Der anhaltende Diskurs um das Werk, der bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts reichte, wird als Ausdruck der nachhaltigen Wirkung der Novelle auf die Gesellschaft hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Lieutenant Gustl, innerer Monolog, Ehrenkodex, Duell, Militär, Gesellschaft, Vorurteile, Antisemitismus, Psychoanalyse, fin de siècle, Wiener Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zu Arthur Schnitzlers "Leutnant Gustl"
Was ist der Inhalt der vorliegenden Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers Novelle "Leutnant Gustl". Sie untersucht den Charakter des Protagonisten, seine soziale Einbettung und seine Auseinandersetzung mit dem militärischen Ehrenkodex. Ein besonderer Fokus liegt auf der innovativen Verwendung des inneren Monologs und der damit verbundenen Darstellung der Psyche des Leutnants.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den inneren Monolog als literarisches Stilmittel, die Charakterisierung Leutnant Gustls und seine psychologischen Konflikte, die Rolle des militärischen Ehrenkodex und dessen Auswirkungen, Gustls soziale Beziehungen und seine Vorurteile sowie die gesellschaftliche Relevanz und die Kontroversen um die Novelle.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in die Kapitel: Einleitung (Entstehungskontext, zentraler Konflikt, Erfolg und Kontroversen), Der Charakter des Leutnant Gustl (Analyse seiner Handlungsweise, inneres Erleben, soziale Beziehungen und Vorurteile), Der Ehrenkodex und die Duelle (militärischer Ehrenkodex, Konfliktsituationen, Bedeutung des Duells), und Die Auswirkungen der Novelle (öffentliche Wirkung, Kontroversen und Konsequenzen für Schnitzler).
Wie wird der innere Monolog in der Analyse behandelt?
Der Abschnitt "Die Möglichkeiten des Inneren Monologs" konzentriert sich auf die literarische Technik des inneren Monologs in Schnitzlers Novelle. Es wird dessen Innovation in der deutschen Literatur hervorgehoben und erläutert, wie dieser Stil die unmittelbare Darstellung des Bewusstseinsstroms des Leutnants ermöglicht. Die Verwendung unvollständiger Sätze, assoziativer Denkstrukturen und die Offenlegung unbewusster Gedanken werden als kennzeichnende Merkmale dargestellt und im Kontext der psychoanalytischen Interessen Schnitzlers interpretiert.
Wie wird Leutnant Gustl charakterisiert?
Leutnant Gustl wird als orientierungslos, abhängig von der Meinung seines Umfelds, zur Selbstrechtfertigung neigend und mit simplifizierenden, oft abwertenden Kategorisierungen von Menschen (z.B. Sozialisten, Juden) charakterisiert. Seine Schuldzuweisungen an andere und seine oberflächlichen, vorurteilsbeladenen Beziehungen werden als zentrale Aspekte seines Charakters herausgestellt.
Welche Rolle spielt der Ehrenkodex?
Der militärische Ehrenkodex spielt eine zentrale Rolle in Gustls Handeln. Die Analyse untersucht verschiedene Konfliktsituationen, in denen Gustl sich befindet und wie er sich im Rahmen dieses Kodex verhält oder zu verhalten glaubt. Die Bedeutung des Duells wird im Kontext der gesellschaftlichen Normen der damaligen Zeit beleuchtet.
Welche Auswirkungen hatte die Novelle?
Die Novelle erregte große öffentliche Aufmerksamkeit, sowohl positive als auch negative Reaktionen. Die Analyse bespricht die Kontroversen und die daraus resultierenden Konsequenzen für Schnitzler, einschließlich des Verlusts seines Offizierspatents. Der anhaltende Diskurs um das Werk wird als Ausdruck seiner nachhaltigen Wirkung hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arthur Schnitzler, Leutnant Gustl, innerer Monolog, Ehrenkodex, Duell, Militär, Gesellschaft, Vorurteile, Antisemitismus, Psychoanalyse, fin de siècle, Wiener Gesellschaft.
- Quote paper
- Katrin Grebing (Author), 2005, Zu: Arthur Schnitzlers "Lieutenant Gustl", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86788