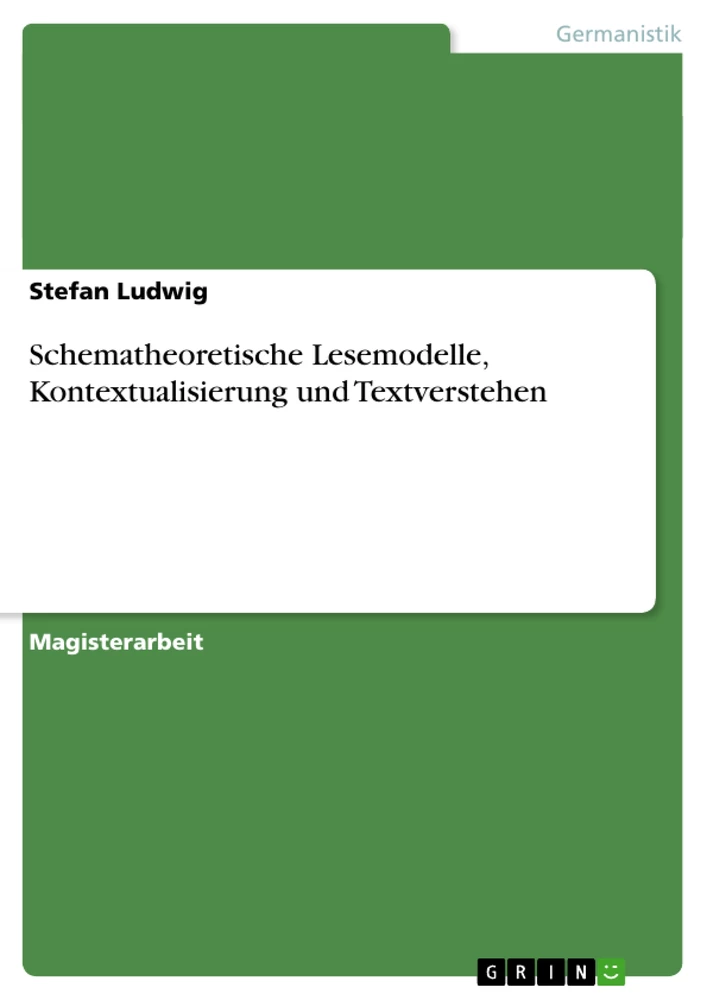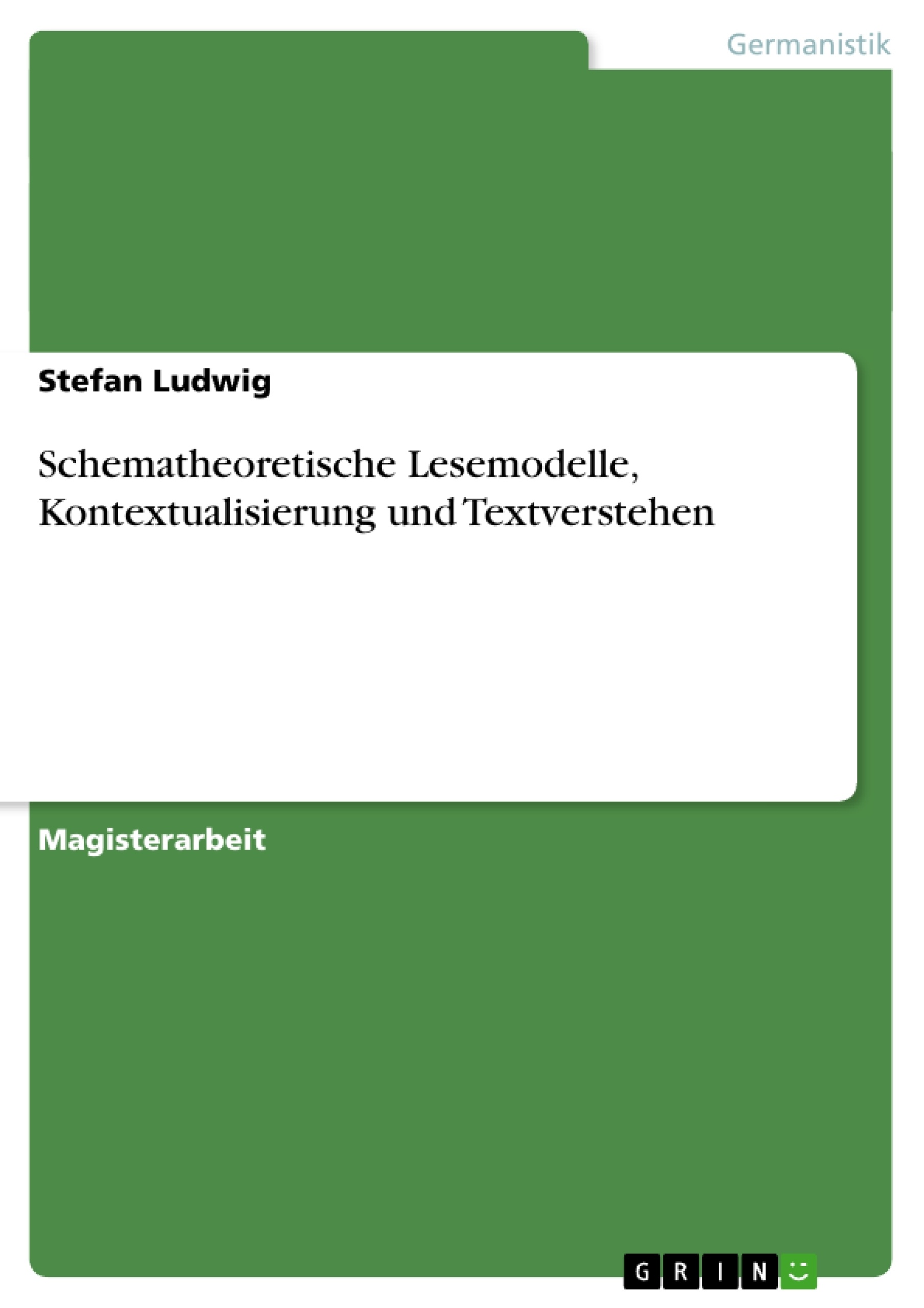Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, auf welche Weise Wissenspakete in den Leseprozess eingehen und damit Textverstehen überhaupt erst ermöglichen. Im folgenden Kapitel wird der Leseprozess und wie Schemata daran beteiligt sind zunächst anhand den Ausführungen Ballstaedts et al. (1981) dargestellt. Da deren Ausführungen allerdings in einigen Punkten zu kurz greifen, werden in Kapitel 3 die Begriffe Schema, Frame und Script einander genauer gegenübergestellt und versucht, Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszustellen. In Kapitel 4 wird versucht herauszufinden, welche Struktur kognitive Schemata haben bzw. auf welche Weise sie im Gedächtnis gespeichert werden und wie sie wirksam sind. In diesem Zusammenhang wird auch darauf eingegangen, wie Schemata überhaupt erworben werden. In Kapitel 5 werden die kognitiven Operationen beschrieben, die für das Erkennen eines Wortes im Satz notwendig sind – und damit, wie Schemata aktiviert werden könnten. In Kapitel 6 schließlich wird die Wortebene verlassen und anhand des zyklischen Modells der Textverarbeitung nach van Dijk & Kintsch (1983) erörtert, auf welche Weise globalere Schemata, wie etwa Wissen um kulturelle Kontexte, das Verständnis von Einheiten auf der Satzebene beeinflussen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ballstaedts Konzeption – Texte verstehen, Texte gestalten
- 2.1 Resümee
- 3. Schema-Begriff: Schema, Frame und Script
- 3.1 Bartletts Schemata
- 3.2 Schank und Abelsons Scripts
- 3.3 Minskys Frames
- 3.4 Frames bei Goffman und bei der Kontextualisierungstheorie
- 3.4.1 Goffmans Rahmen
- 3.4.2 Kontextualisierung
- 3.5 Resümee
- 4. Schemata – Erwerb, Struktur, Lernen
- 4.1 Erwerb von Schemata
- 4.2 Struktur von Schemata
- 4.2.1 Repräsentation von Begriffsrelationen im LZG
- 4.2.1.1 Der Teachable Language Comprehender
- 4.2.1.2 Das Aktivationsausbreitungsmodell
- 4.2.1.3 Das PDP-Modell
- 4.2.2 Konzepte
- 4.2.2.1 Repräsentation von Konzepten im LZG
- 4.2.2.2 Konzepte als Schemata
- 4.2.3 Schemata als konnektionistische Netzwerke
- 4.2.3.1 Wissenserwerb
- 4.2.3.2 Lernen in neuronalen Netzwerken
- 4.2.1 Repräsentation von Begriffsrelationen im LZG
- 4.3 Funktionen von Schemata für den Wissenserwerb
- 4.3.1 Aufmerksamkeitssteuerung
- 4.3.2 Integrationsfunktion
- 4.3.3 Modalität der gespeicherten Informationen
- 4.4 Resümee
- 5. Bedeutungskonstitution
- 5.1 Der Prozess der Bedeutungskonstitution
- 5.2 Ein interaktives Aktivierungsmodell der Worterkennung
- 5.2.1 PDP-Modelle und Worterkennung: Der CID-Mechanismus
- 5.3 Die Satzebene
- 5.3.1 PABLO (Programmable Blackboard Model)
- 5.3.2 Semantische Analyse bei PDP-Modellen
- 5.4 Die Beziehung lexikalischer Einheiten zu konzeptuellen Strukturen
- 5.5 Resümee
- 6. Ein schematheoretisches Lesemodell: Das zyklische Modell der Textverarbeitung
- 6.1 Das Modell von Kintsch & van Dijk (1978)
- 6.1.1 Die Struktur des semantischen Gedächtnisses
- 6.1.2 Die Textbasis
- 6.1.3 Inferenzen
- 6.1.4 Zyklische Textverarbeitung
- 6.1.5 Die Makrostruktur
- 6.1.6 Die Rolle von Schemata bei der Erstellung von Makrostrukturen
- 6.1.7 Kritik
- 6.2 Die Top-down-Variante des zyklischen Modells
- 6.2.1 Strategiegeleitete Textverarbeitung
- 6.2.1.1 Kontextuelle Strategien
- 6.2.1.2 Sprachliche Strategien
- 6.2.2 Lokale und globale Kohärenz
- 6.2.3 Kontextuelle und textuelle Makrostrategien
- 6.2.4 Schematische Strategien: Superstrukturen
- 6.2.5 Das Situationsmodell
- 6.2.1 Strategiegeleitete Textverarbeitung
- 6.3 Resümee
- 6.1 Das Modell von Kintsch & van Dijk (1978)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Rolle von Schemata beim Textverstehen. Ziel ist es, verschiedene schematheoretische Lesemodelle zu präsentieren und deren Bedeutung für die Konstitution von Bedeutung zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Interaktion von lexikalischem, semantischen und weltwissenbasierten Informationen im Prozess des Lesens.
- Schematheoretische Ansätze zum Textverstehen
- Die Bedeutung von Kontextwissen für die Textinterpretation
- Modelle der Worterkennung und Satzverarbeitung
- Der Einfluss von Schemata auf die Konstruktion von Bedeutung
- Zyklische Modelle der Textverarbeitung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und verdeutlicht die Notwendigkeit, über rein semantisch-lexikalisches Wissen hinausgehendes Hintergrundwissen für das Textverstehen zu berücksichtigen. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie Ambiguitäten durch die Aktivierung von Schemata und Kontextwissen aufgelöst werden können. Die Bedeutung von Kontextwissen, sowohl linguistischem als auch situativem, wird hervorgehoben, um die Lücken im explizit gegebenen Text zu füllen und ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.
2. Ballstaedts Konzeption – Texte verstehen, Texte gestalten: Dieses Kapitel präsentiert Ballstaedts Konzeption des Textverstehens und -gestaltens. Es wird detailliert erläutert, wie Leser aktiv am Konstruktionsprozess von Bedeutung beteiligt sind und wie schematisches Wissen dabei eine zentrale Rolle spielt. Die verschiedenen Ebenen der Textverarbeitung und die Interaktion zwischen dem Leser und dem Text werden beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf der aktiven Rolle des Lesers beim Erschließen von impliziten Informationen und der Integration dieser in ein kohärentes Verständnis des Textes. Der Abschnitt schließt mit einem Resümee, das die zentralen Punkte von Ballstaedts Theorie zusammenfasst und ihre Relevanz für das weitere Vorgehen der Arbeit herausstellt.
3. Schema-Begriff: Schema, Frame und Script: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Konzepten von Schemata, Frames und Scripts, beginnend mit Bartletts frühen Arbeiten zu Schemata und ihren Eigenschaften. Es wird vertieft auf die Scripts von Schank und Abelson sowie die Frames von Minsky eingegangen, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Ansätze herausgearbeitet werden. Der Zusammenhang zwischen Frames im Kontext der Goffmanschen Rahmenanalyse und der Kontextualisierungstheorie wird analysiert. Die Zusammenfassung fasst die verschiedenen Schemakonzepte zusammen und stellt ihren Beitrag zum Verständnis der kognitiven Prozesse beim Textverstehen dar.
4. Schemata – Erwerb, Struktur, Lernen: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Erwerb, der Struktur und den Lernprozessen im Zusammenhang mit Schemata. Es werden verschiedene Modelle der Wissensrepräsentation im Langzeitgedächtnis (LZG) vorgestellt und miteinander verglichen, darunter der Teachable Language Comprehender, das Aktivationsausbreitungsmodell und das PDP-Modell. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Begriffsrelationen und Konzepten als konnektionistische Netzwerke. Des Weiteren werden die Funktionen von Schemata für den Wissenserwerb, insbesondere die Aufmerksamkeitssteuerung und die Integrationsfunktion, eingehend erläutert. Das Kapitel schließt mit einem Resümee, das die wichtigsten Aspekte des Erwerbs, der Struktur und der Funktionen von Schemata für den Lernprozess zusammenfasst.
5. Bedeutungskonstitution: Dieses Kapitel widmet sich dem Prozess der Bedeutungskonstitution beim Lesen. Es wird ein interaktives Aktivierungsmodell der Worterkennung vorgestellt und im Detail erläutert, mit besonderem Fokus auf PDP-Modellen und dem CID-Mechanismus. Die Analyse erstreckt sich auf die Satzebene, wobei das PABLO-Modell und die semantische Analyse bei PDP-Modellen im Mittelpunkt stehen. Schließlich wird die Beziehung zwischen lexikalischen Einheiten und konzeptuellen Strukturen untersucht. Das Kapitel endet mit einem Resümee, welches die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse zum Prozess der Bedeutungskonstitution zusammenfasst.
6. Ein schematheoretisches Lesemodell: Das zyklische Modell der Textverarbeitung: Dieses Kapitel präsentiert das zyklische Modell der Textverarbeitung von Kintsch & van Dijk (1978) sowie dessen Top-down-Variante. Es wird detailliert auf die Struktur des semantischen Gedächtnisses, die Textbasis, Inferenzen, die zyklische Textverarbeitung, die Makrostruktur und die Rolle von Schemata bei der Erstellung von Makrostrukturen eingegangen. Kritische Auseinandersetzungen mit dem Modell werden ebenso berücksichtigt wie die Betrachtung strategischer Aspekte der Textverarbeitung, inklusive kontextueller und sprachlicher Strategien, lokaler und globaler Kohärenz, sowie die Rolle von Situationsmodellen. Das Resümee des Kapitels fasst die Vor- und Nachteile der vorgestellten Modelle zusammen und betont deren Bedeutung für das Verständnis von Leseprozessen.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Schematheoretische Ansätze zum Textverstehen
Was ist der Hauptfokus dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Rolle von Schemata beim Textverstehen. Sie präsentiert verschiedene schematheoretische Lesemodelle und analysiert deren Bedeutung für die Konstitution von Bedeutung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Interaktion von lexikalischem, semantischen und weltwissenbasierten Informationen beim Lesen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt schematheoretische Ansätze zum Textverstehen, die Bedeutung von Kontextwissen für die Textinterpretation, Modelle der Worterkennung und Satzverarbeitung, den Einfluss von Schemata auf die Bedeutungskonstitution und zyklische Modelle der Textverarbeitung. Konkret werden Konzepte wie Schemata, Frames und Scripts von verschiedenen Autoren (Bartlett, Schank & Abelson, Minsky, Goffman) diskutiert und in Bezug zum Textverstehen gesetzt.
Welche Modelle der Wissensrepräsentation werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert und vergleicht verschiedene Modelle der Wissensrepräsentation im Langzeitgedächtnis (LZG), darunter der Teachable Language Comprehender, das Aktivationsausbreitungsmodell und das PDP-Modell. Diese Modelle werden im Kontext des Schemas und der Repräsentation von Begriffsrelationen und Konzepten als konnektionistische Netzwerke erläutert.
Wie wird der Prozess der Bedeutungskonstitution beschrieben?
Der Prozess der Bedeutungskonstitution wird anhand eines interaktiven Aktivierungsmodells der Worterkennung beschrieben, wobei PDP-Modelle und der CID-Mechanismus im Detail erläutert werden. Die Analyse umfasst die Satzebene mit dem PABLO-Modell und der semantischen Analyse bei PDP-Modellen. Die Beziehung zwischen lexikalischen Einheiten und konzeptuellen Strukturen wird ebenfalls untersucht.
Welches Lesemodell steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Das zyklische Modell der Textverarbeitung von Kintsch & van Dijk (1978) und dessen Top-down-Variante stehen im Mittelpunkt. Die Arbeit analysiert die Struktur des semantischen Gedächtnisses, die Textbasis, Inferenzen, die zyklische Textverarbeitung, die Makrostruktur, die Rolle von Schemata bei der Erstellung von Makrostrukturen und kritische Auseinandersetzungen mit dem Modell. Strategische Aspekte der Textverarbeitung, inklusive kontextueller und sprachlicher Strategien, lokaler und globaler Kohärenz und die Rolle von Situationsmodellen werden ebenfalls betrachtet.
Welche Rolle spielt Ballstaedts Konzeption im Kontext der Arbeit?
Die Arbeit präsentiert Ballstaedts Konzeption des Textverstehens und -gestaltens. Es wird erläutert, wie Leser aktiv am Konstruktionsprozess von Bedeutung beteiligt sind und wie schematisches Wissen dabei eine zentrale Rolle spielt. Die verschiedenen Ebenen der Textverarbeitung und die Interaktion zwischen Leser und Text werden beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln: Einleitung (Einleitung in die Thematik und Bedeutung von Kontextwissen), Ballstaedts Konzeption (Detaillierte Erläuterung von Ballstaedts Theorie), Schema-Begriff (verschiedene Konzepte von Schemata, Frames und Scripts), Schemata – Erwerb, Struktur, Lernen (Erwerb, Struktur und Lernprozesse im Zusammenhang mit Schemata), Bedeutungskonstitution (Prozess der Bedeutungskonstitution beim Lesen) und ein schematheoretisches Lesemodell (Das zyklische Modell der Textverarbeitung von Kintsch & van Dijk).
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit Textverstehen, Kognitionspsychologie und Schematheorie beschäftigt. Sie ist besonders relevant für Studierende und Wissenschaftler im Bereich der Linguistik, Kognitionswissenschaften und der Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- M. A. Stefan Ludwig (Author), 2007, Schematheoretische Lesemodelle, Kontextualisierung und Textverstehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86775