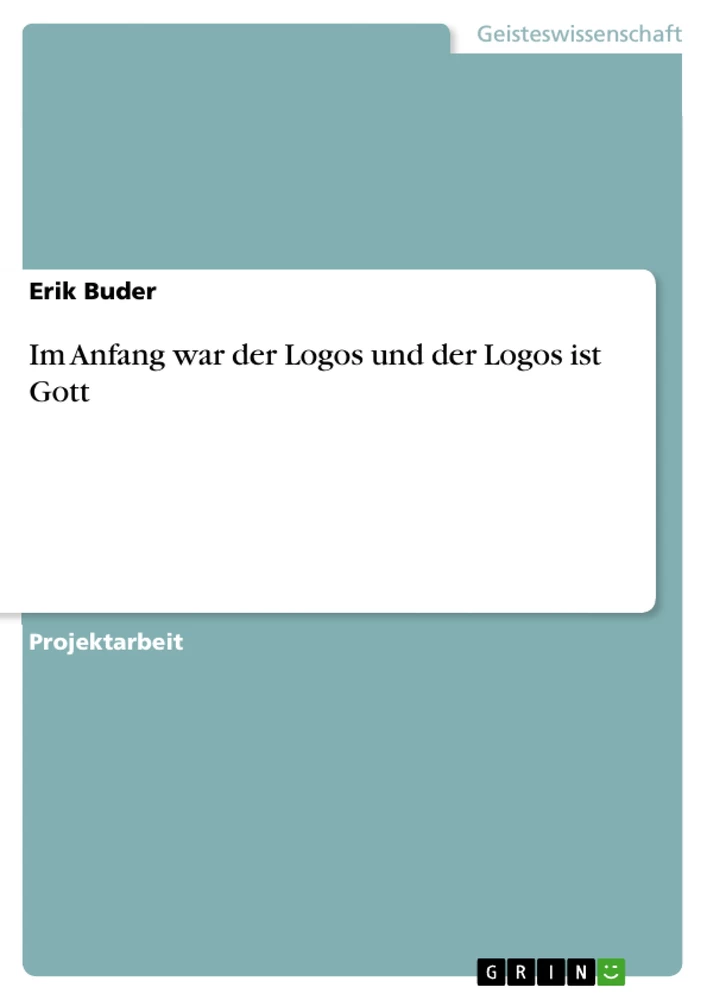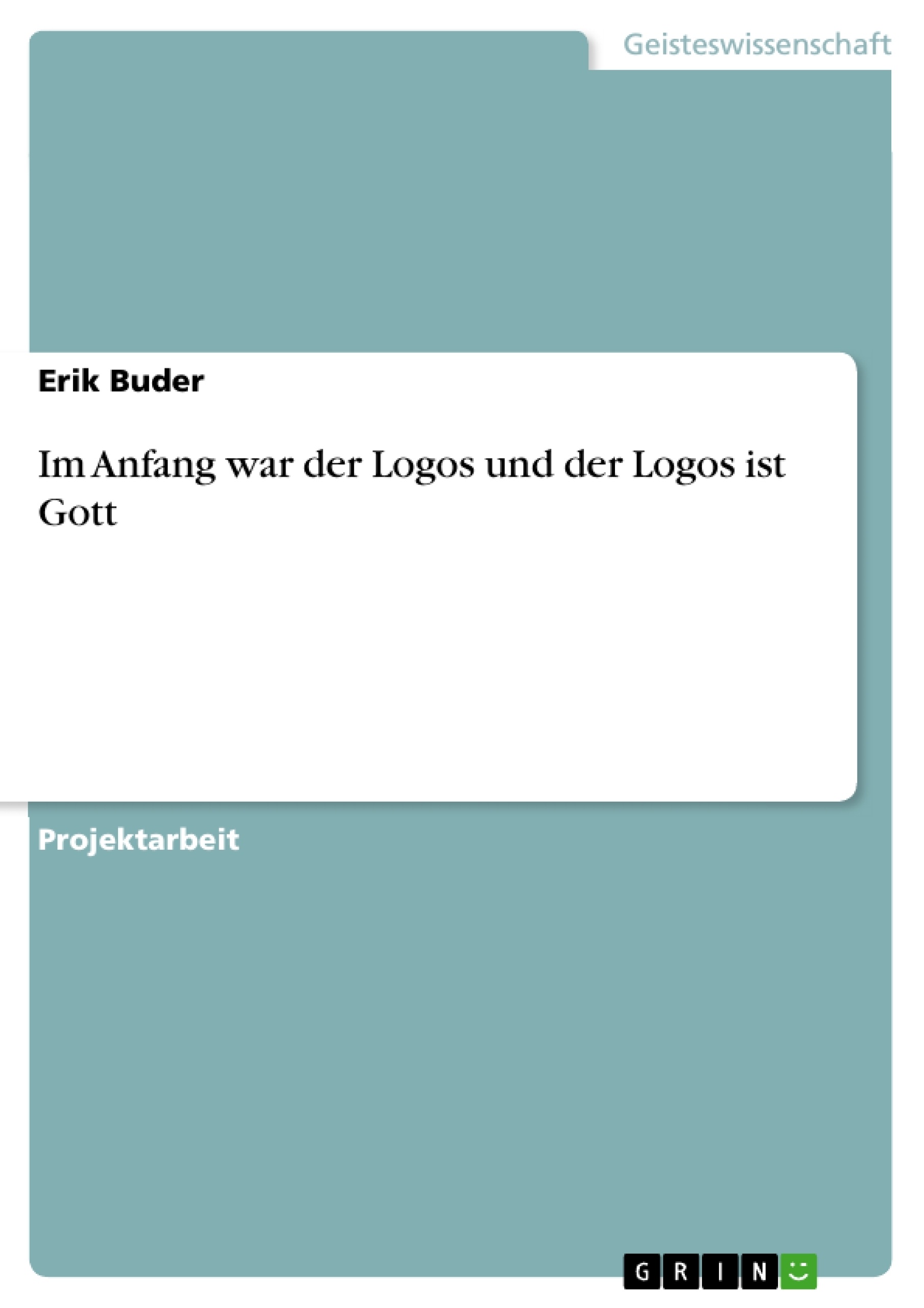„Im Anfang war der Logos, und der Logos ist Gott.“ Dieses Zitat Bennedikts des XVI. aus seiner Vorlesung in Regensburg im September des Jahres 2006, soll diesem Aufsatz als Titel und Einleitung dienen um dem Leser zu Beginn direkt mit dem Gegenstand der Untersuchung zu konfrontieren. Der Logosbegriff als jahrtausende alter Begleiter des philosophischen- und theologischen Denkens rückt hierbei in den Mittelpunkt der Analyse. Demnach versteht sich dieser Beitrag als eine Reise. Eine Reise durch die historischen Dimensionen „des Wortes“ von den „Ursprüngen des abendländischen Philosophierens im alten Hellas“ , bis zu seiner Fleischwerdung als Inkarnation in der historischen Persönlichkeit Jesus von Nazareth im Evangelium des Johannes . Somit könnte die zentrale Frage, auf welche ich am Schluss den Versuch einer Antwort unternehmen möchte, lauten: „Inwiefern hat der griechische Geist auf das Christentum eingewirkt und kann man von einer Hellenisierung dieser Religion am Beispiel des Logosbegriff sprechen?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Im Anfang war der Mythos?
- Heraklit von Ephesos
- Die Stoiker
- Philon von Alexandria
- Paulus von Tarsus
- Das Evangelium nach Johannes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Entwicklung des Logosbegriffs von der griechischen Philosophie bis zum Johannesevangelium. Die zentrale Frage ist, inwiefern der griechische Geist das Christentum beeinflusst hat und ob man von einer Hellenisierung des Christentums am Beispiel des Logosbegriffs sprechen kann. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Denker und Autoren, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Entwicklungen im Verständnis des Logos aufzuzeigen.
- Der Logosbegriff in der griechischen Philosophie
- Der Vergleich zwischen philosophischem und theologischem Logosverständnis
- Die Entwicklung des Logosbegriffs im Laufe der Geschichte
- Der Einfluss des griechischen Denkens auf das Christentum
- Die Rolle des Logos im Johannesevangelium
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Aufsatz untersucht den Logosbegriff, ausgehend vom Zitat Benedikts XVI. "Im Anfang war der Logos, und der Logos ist Gott." Es wird eine Reise durch die historische Entwicklung des Logosbegriffs unternommen, von der griechischen Philosophie bis zum Johannesevangelium. Die zentrale Frage ist der Einfluss des griechischen Geistes auf das Christentum, speziell im Hinblick auf den Logosbegriff. Der Autor fokussiert auf ausgewählte Denker, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis des Logos zu beleuchten und verwendet hierfür die Werke von Max Heinze, Ragnar Asting und Wilhelm Kelber als Hauptquellen. Die Einleitung reflektiert auch die Relevanz des Themas für die Religionssoziologie und die Bedeutung der historischen Betrachtungsweise für das Verständnis moderner Gesellschaften.
Im Anfang war der Mythos?: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung und Entwicklung des Logosbegriffs im Vergleich zum Mythos. Es wird die Frage gestellt, ob der Logos oder der Mythos am Anfang stand. Die Autoren Herbert Kummer und Wilhelm Nestle werden herangezogen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen mythologischem und rationalem Denken zu verdeutlichen. Kummer präsentiert den Mythos als vorwissenschaftlichen Glauben, der durch die Logik abgelöst wurde, während Nestle eine allmähliche Entwicklung und Ersetzung des mythologischen Denkens durch Rationalität beschreibt. Der Autor argumentiert jedoch, dass die Begriffe Logos und Mythos in Abhängigkeit von der jeweiligen Zeitperspektive zu verstehen sind und eine gewisse Deckungsgleichheit aufweisen können. Das Beispiel der Entstehung der Insel Rhodos wird verwendet, um die unterschiedlichen Interpretationsweisen zu illustrieren, die jedoch letztlich auf dieselbe Kernaussage hinauslaufen.
Schlüsselwörter
Logos, Mythos, griechische Philosophie, Christentum, Hellenisierung, Johannesevangelium, Religionssoziologie, Heraklit, Stoa, Philon von Alexandria, Paulus von Tarsus, Max Heinze, Ragnar Asting, Wilhelm Kelber.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Aufsatz: Der Logosbegriff von der griechischen Philosophie bis zum Johannesevangelium
Was ist der Gegenstand des Aufsatzes?
Der Aufsatz untersucht die Entwicklung des Logosbegriffs von der griechischen Philosophie bis zum Johannesevangelium. Die zentrale Frage ist der Einfluss des griechischen Denkens auf das Christentum, insbesondere im Hinblick auf das Verständnis des Logos. Der Aufsatz analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis des Logos bei verschiedenen Denkern und Autoren.
Welche Autoren und Denker werden im Aufsatz behandelt?
Der Aufsatz konzentriert sich auf ausgewählte Denker und Autoren, darunter Heraklit von Ephesos, die Stoiker, Philon von Alexandria, Paulus von Tarsus und die Autoren des Johannesevangeliums. Als Sekundärliteratur werden Max Heinze, Ragnar Asting und Wilhelm Kelber herangezogen. Zusätzlich werden Herbert Kummer und Wilhelm Nestle im Kapitel über Mythos und Logos erwähnt.
Welche Hauptthemen werden im Aufsatz behandelt?
Die Hauptthemen umfassen den Logosbegriff in der griechischen Philosophie, einen Vergleich zwischen philosophischem und theologischem Logosverständnis, die Entwicklung des Logosbegriffs im Laufe der Geschichte, den Einfluss des griechischen Denkens auf das Christentum und die Rolle des Logos im Johannesevangelium. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Vergleich von Logos und Mythos und deren jeweilige Bedeutung in verschiedenen historischen Kontexten.
Wie ist der Aufsatz strukturiert?
Der Aufsatz ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage, Methodik und die Relevanz des Themas für die Religionssoziologie darlegt. Es folgen Kapitel zu einzelnen Denkern und philosophischen Strömungen, die den Logosbegriff geprägt haben, bevor der Aufsatz mit einem Fazit abschließt. Die Kapitel beinhalten jeweils eine Zusammenfassung der behandelten Thematik und deren Bedeutung im Kontext der Gesamtargumentation.
Welche Quellen werden verwendet?
Als Hauptquellen werden die Werke von Max Heinze, Ragnar Asting und Wilhelm Kelber genannt. Zusätzlich werden Herbert Kummer und Wilhelm Nestle im Kapitel zum Vergleich von Mythos und Logos herangezogen. Der Aufsatz basiert auf einer Analyse der Schriften der behandelten Denker und Autoren sowie auf der Sekundärliteratur.
Welche Frage steht im Zentrum der Untersuchung?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern hat der griechische Geist das Christentum beeinflusst, und kann man von einer Hellenisierung des Christentums am Beispiel des Logosbegriffs sprechen?
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Aufsatz?
Schlüsselwörter sind: Logos, Mythos, griechische Philosophie, Christentum, Hellenisierung, Johannesevangelium, Religionssoziologie, Heraklit, Stoa, Philon von Alexandria, Paulus von Tarsus, Max Heinze, Ragnar Asting, Wilhelm Kelber.
Wie wird der Begriff "Logos" im Aufsatz definiert und behandelt?
Der Aufsatz verfolgt die Entwicklung des Logosbegriffs diachron, von seinen Anfängen in der griechischen Philosophie bis zu seiner Verwendung im Johannesevangelium. Es wird untersucht, wie sich das Verständnis von "Logos" im Laufe der Zeit verändert hat und wie verschiedene Denker und Autoren diesen Begriff interpretiert haben. Der Vergleich zwischen philosophischen und theologischen Logosverständnissen spielt eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielt der Mythos im Aufsatz?
Das Kapitel "Im Anfang war der Mythos?" untersucht die Beziehung zwischen Logos und Mythos. Es wird die Frage nach dem Primat von Logos oder Mythos gestellt und die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten analysiert. Dabei wird die Entwicklung vom mythologischen zum rationalen Denken betrachtet.
Welche Bedeutung hat der Aufsatz für die Religionssoziologie?
Die Einleitung des Aufsatzes hebt die Relevanz des Themas für die Religionssoziologie hervor. Die historische Untersuchung des Logosbegriffs trägt zum Verständnis der Entwicklung des Christentums und seiner Beziehung zur griechischen Philosophie bei und liefert Einblicke in die Entstehung und Entwicklung religiöser Ideen und deren Einfluss auf die Gesellschaft.
- Quote paper
- Erik Buder (Author), 2007, Im Anfang war der Logos und der Logos ist Gott, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86721