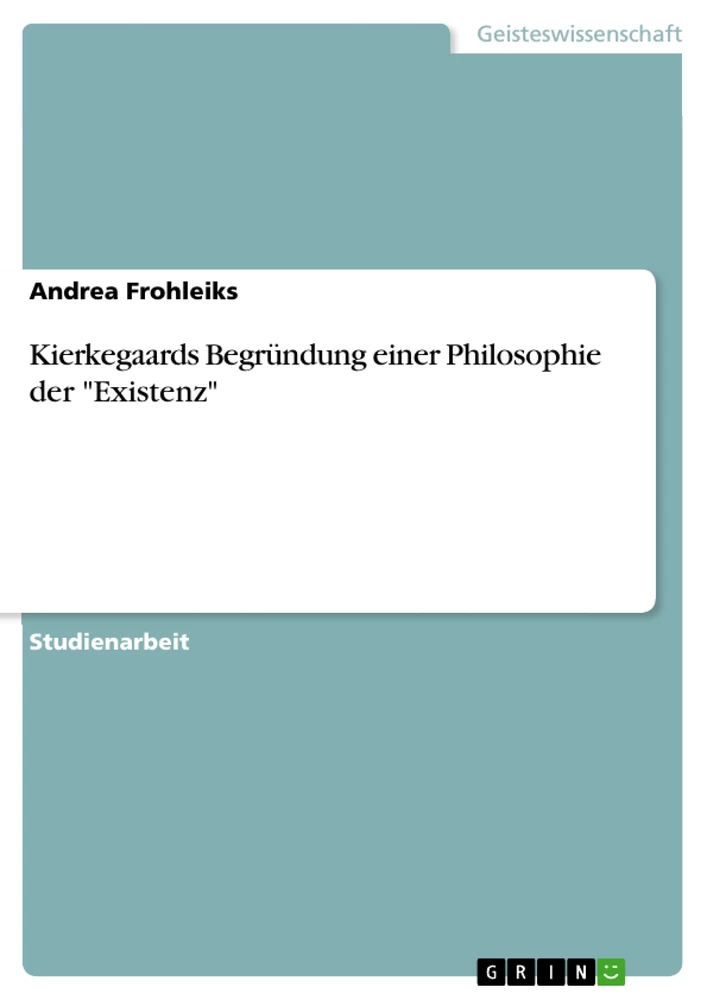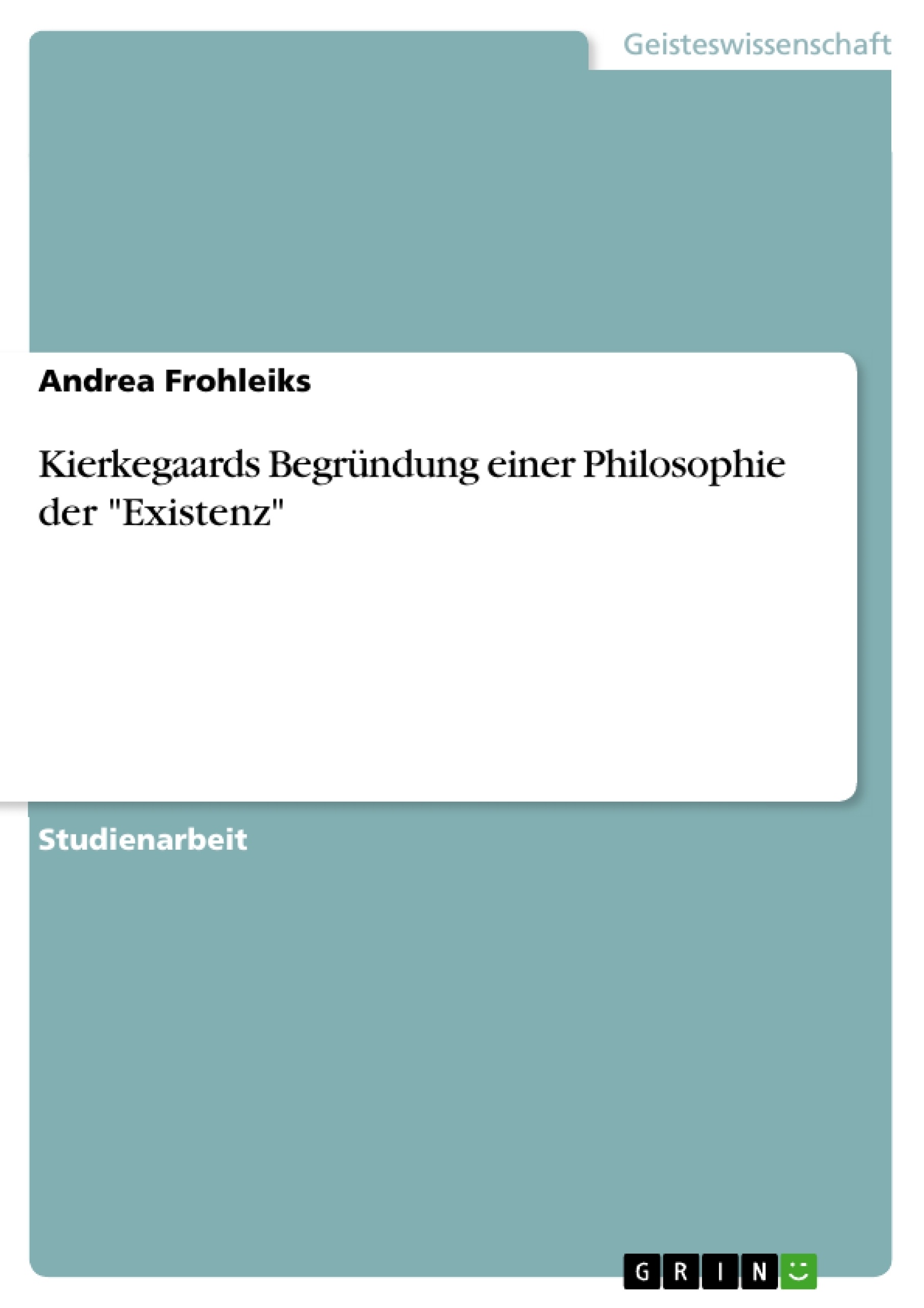Sören Kierkegaard (1813–1855) – einer der größten Philosophen des 19. Jahrhunderts kann sicherlich mit Recht als Begründer der Existenzphilosophie bezeichnet werden. Innerlich ein zerrissener Mensch – zerrissen zwischen der Sehnsucht nach einer persönlichen Beziehung und der Einsicht der eigenen Unfähigkeit eine solche Beziehung zu führen – hat er in der kurzen Zeit seines Lebens ein Werk geschaffen, dass von genialem Denken und dichterischer Schaffenskraft geprägt ist. Kierkegaard hat das grundsätzliche Problem des 19. und 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt seiner philosophischen Bemühungen gestellt: die Frage nach der Wirklichkeit des Menschen und seiner Freiheit. Mit der Ablehnung der traditionellen Metaphysik, in deren Zentrum eine theoretisch abstrakte Auffassung des Menschen und die Betonung von Sein und Wesen steht, sowie seiner eigenen Akzentuierung der menschlichen Sub-jektivität ist Kierkegaard zum Vorreiter großer Existenzphilosophen des 20. geworden.
Kierkegaards Anthropologie umfasst das Verhältnis des Menschen zu seiner eigenen Existenz sowie sein Verhältnis zu Gott. Dabei geht es ihm nicht um die Vermittlung einer speziellen Wahrheit, sondern um einen Dialog zu seinen Lesern aufzubauen. Thema dieser Arbeit ist Kierkegaards Begründung einer Philosophie der Existenz. Hierbei steht die Untersuchung des Zweiten Teils der Abschließenden Unwissenschaftlichen Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (1846) im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Begriffsbestimmungen
- Existenz und Existieren
- Existenzphilosophie allgemein
- Der Mensch
- Die Situation des Menschen
- Probleme des Menschen als existierender Mensch
- Kritik an traditioneller Metaphysik
- Kritik an der Basis des neuzeitlichen Denkens
- Denken versus Sein – Möglichkeit versus Wirklichkeit
- Kritik an Descartes' „cogito ergo sum“
- Vernachlässigung der Probleme der Existenz durch die traditionelle Metaphysik
- Kritik an Aufhebung des Satzes vom Widerspruch
- Aufhebung der Existenz
- Abstrakter Denker versus Existierender
- Kritik an der Basis des neuzeitlichen Denkens
- Kierkegaards Existenzphilosophie
- Aufgaben des Menschen als Existierender
- Leidenschaftliches Existieren
- Forderung des Ethischen
- Beispiele für Existierende
- Verschiedene Arten von Existierenden
- Der Subjektive Denker
- Sokrates
- Religiosität
- Die Paradoxie in Glauben und Religion
- Der subjektive Denker im Glauben
- Problematik Christ zu werden
- Aufgaben des Menschen als Existierender
- Abschließender Kommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kierkegaards Begründung einer Philosophie der Existenz, fokussiert auf den zweiten Teil seiner „Abschließenden Unwissenschaftlichen Nachschrift“. Das Hauptziel ist die Analyse von Kierkegaards Kritik an der traditionellen Metaphysik und die Darstellung seiner existenzphilosophischen Konzeption. Die Arbeit beleuchtet, wie Kierkegaard philosophisches Systemdenken als inadäquat für die Erfassung der menschlichen Seinsweise zurückweist.
- Kierkegaards Kritik an der traditionellen Metaphysik und deren Verständnis von Sein und Wesen.
- Die Konzeption von Existenz und Existieren bei Kierkegaard und deren Abgrenzung von der Essenzphilosophie.
- Die Rolle der menschlichen Subjektivität und Freiheit in Kierkegaards Philosophie.
- Die Bedeutung von Leidenschaft und ethischer Forderung im existentiellen Dasein.
- Die Auseinandersetzung mit der Religiosität und dem Problem des christlichen Glaubens.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt Kierkegaard als Begründer der Existenzphilosophie vor. Es hebt die zentrale Frage nach der Wirklichkeit des Menschen und seiner Freiheit hervor und beschreibt Kierkegaards Abwendung von der traditionellen Metaphysik zugunsten einer Akzentuierung der menschlichen Subjektivität. Die Arbeit fokussiert sich auf den zweiten Teil der „Abschließenden Unwissenschaftlichen Nachschrift“ und weist auf die enge Verknüpfung der verschiedenen Abschnitte hin, betont aber auch die Grenzen der Arbeit, insbesondere bezüglich einer umfassenden Darstellung der von Kierkegaard untersuchten Lebensstadien. Die Verwendung des Pseudonyms Johannes Climacus wird kurz erläutert.
Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Existenz“ und „Existieren“. Es unterscheidet zwischen der allgemeinen Bedeutung von Existenz als bloßes Dasein und der existenzphilosophischen Bedeutung als inhaltliche Bestimmung des Daseins, der bewussten menschlichen Lebensgestaltung. Die Abgrenzung zur rationalistischen Wesensphilosophie wird deutlich herausgestellt, und die spezifische, individuelle Seinsweise des Menschen als freiheitliches Verhalten zum Sein wird betont. Der Unterschied zwischen Existenz und Existieren wird ebenfalls beleuchtet, wobei Existenz als die einzige Wirklichkeit für Kierkegaard hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Existenzphilosophie, Kierkegaard, traditionelle Metaphysik, Existenz, Existieren, menschliche Subjektivität, Freiheit, Leidenschaft, Ethik, Religiosität, Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift, Wesen, Essenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Kierkegaards Existenzphilosophie
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Kierkegaards Existenzphilosophie, insbesondere seinen zweiten Teil der „Abschließenden Unwissenschaftlichen Nachschrift“. Sie untersucht seine Kritik an der traditionellen Metaphysik und beleuchtet seine Konzeption von Existenz und Existieren. Die Arbeit umfasst ein Vorwort, Begriffsbestimmungen, eine Betrachtung des Menschen und seiner Probleme, Kritik an der traditionellen Metaphysik, eine detaillierte Analyse von Kierkegaards Existenzphilosophie, und einen abschließenden Kommentar. Sie beinhaltet auch eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Kierkegaards Kritik an der traditionellen Metaphysik und deren Verständnis von Sein und Wesen, die Konzeption von Existenz und Existieren bei Kierkegaard im Vergleich zur Essenzphilosophie, die Rolle der menschlichen Subjektivität und Freiheit, die Bedeutung von Leidenschaft und ethischer Forderung im existentiellen Dasein, sowie die Auseinandersetzung mit Religiosität und dem Problem des christlichen Glaubens. Die spezifischen Probleme des existierenden Menschen werden ebenso thematisiert wie die Paradoxie im Glauben und die Problematik, Christ zu werden.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist die Analyse von Kierkegaards Kritik an der traditionellen Metaphysik und die Darstellung seiner existenzphilosophischen Konzeption. Es wird untersucht, wie Kierkegaard philosophisches Systemdenken als inadäquat für die Erfassung der menschlichen Seinsweise zurückweist. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage nach der Wirklichkeit des Menschen und seiner Freiheit.
Welche Schlüsselbegriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie „Existenz“ und „Existieren“, unterscheidet zwischen bloßem Dasein und der existenzphilosophischen Bedeutung als bewusste Lebensgestaltung und betont den Unterschied zwischen Existenz und Existieren, wobei Existenz als die einzige Wirklichkeit für Kierkegaard gilt. Die Abgrenzung zur rationalistischen Wesensphilosophie wird deutlich herausgestellt.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Vorwort, Begriffsbestimmungen (inkl. Existenz und Existieren, Existenzphilosophie allgemein), Der Mensch (inkl. Situation des Menschen und dessen Probleme), Kritik an traditioneller Metaphysik (inkl. Kritik an Descartes' „cogito ergo sum“ und Vernachlässigung der Existenzprobleme), Kierkegaards Existenzphilosophie (inkl. Aufgaben des Menschen, Beispiele für Existierende und Religiosität), und einen Abschließenden Kommentar.
Welche Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit nennt Beispiele für Existierende, unterscheidet verschiedene Arten von Existierenden und analysiert den „subjektiven Denker“, sowie die Figur Sokrates. Die Paradoxie im Glauben und die Problematik, Christ zu werden, werden ebenfalls als Beispiele behandelt.
Wie wird Kierkegaards Kritik an der traditionellen Metaphysik dargestellt?
Die Arbeit zeigt, wie Kierkegaard philosophisches Systemdenken als ungeeignet für das Verständnis der menschlichen Existenz zurückweist. Seine Kritik umfasst die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Denken und Sein, Möglichkeit und Wirklichkeit, sowie die Kritik an der Aufhebung des Satzes vom Widerspruch und der Vernachlässigung der Existenzprobleme durch die traditionelle Metaphysik.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Existenzphilosophie, Kierkegaard, traditionelle Metaphysik, Existenz, Existieren, menschliche Subjektivität, Freiheit, Leidenschaft, Ethik, Religiosität, Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift, Wesen, Essenz.
- Citar trabajo
- M.A. Andrea Frohleiks (Autor), 2004, Kierkegaards Begründung einer Philosophie der "Existenz", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86709