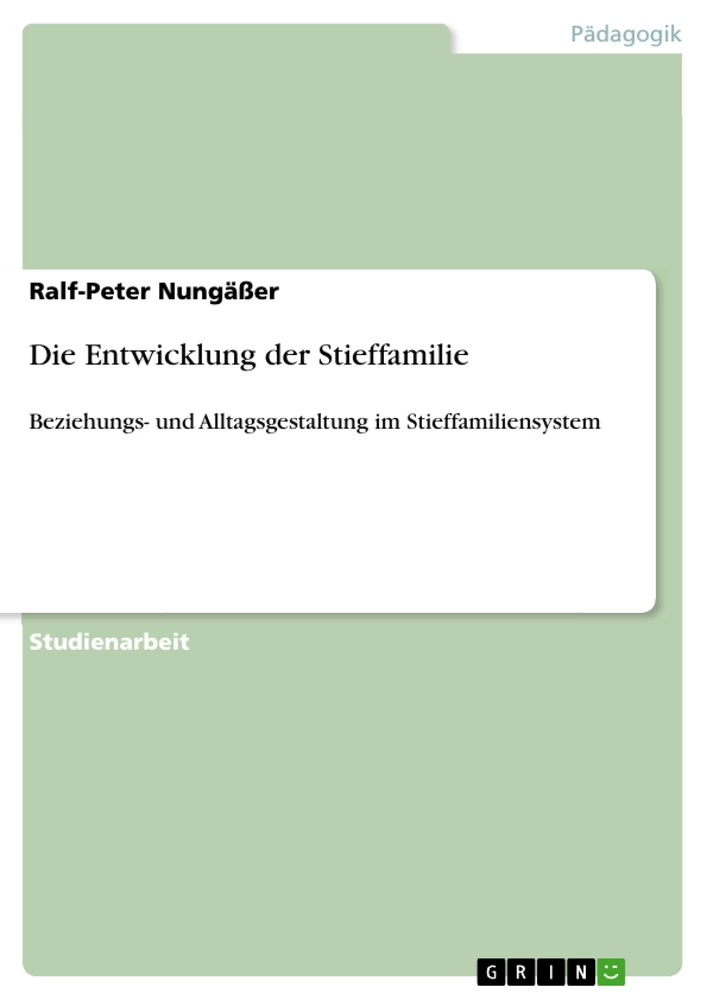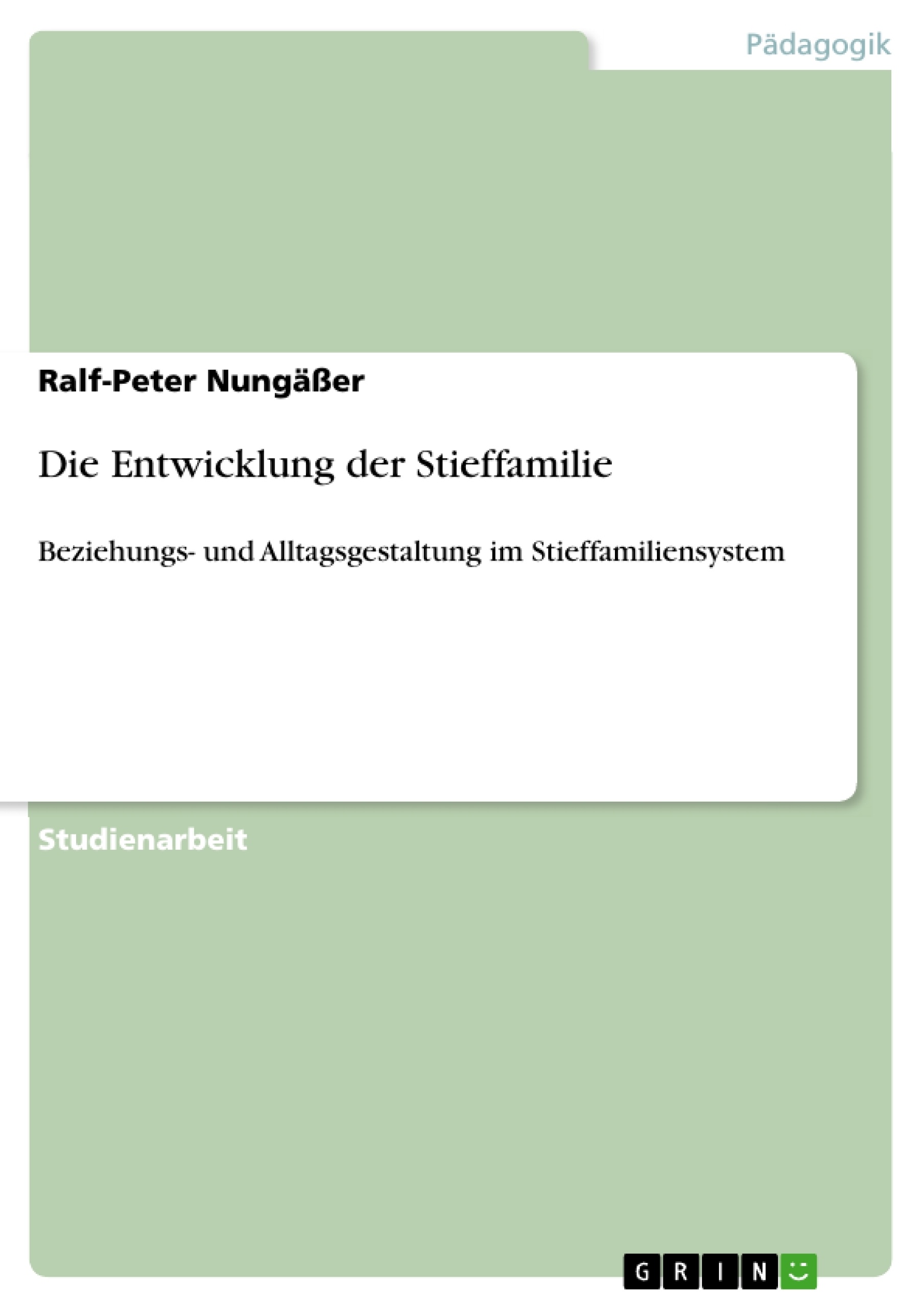Wer kennt sie nicht, all die Mythen, die sich um die Stiefmütter in Märchen ranken? Die Böse Mutter, die ihren Mann unterjocht und die Kinder des Vaters ablehnt, misshandelt und unterdrückt. Hänsel & Gretel der Gebrüder Grimm ist hierbei nur ein Paradebeispiel. Über all die Jahrhunderte hat sich das Bild der „Bösen Stiefmutter“ etabliert. Erst heute, mit dem Aufkommen von Gleichberechtigung, Emanzipation, Liberalismus und einer sich zunehmend verändernden Familiensoziologie innerhalb der Gesellschaft bröckelt das Bild der einseitig beschriebenen Stiefmutter, zumindest in der Professions- und Fachöffentlichkeit. Und diese ist seit jüngster Zeit auf universitärer Ebene redlich bemüht, mittels empirischen Forschungsergebnissen auch der Öffentlichkeit ein neues Stiefmutterbild, aber auch ein modernes Stiefvaterbild, zu vermitteln.
Sucht man in der pädagogischen Lexikaliteratur nach den Begriffen ‚Stieffamilie’ oder ‚Stiefkind‘, so sucht man dort vergeblich. Erst seit Beginn der 80er Jahre wird das Phänomen ‚Stieffamilie‘ als sozialwissenschaftlicher Forschungsgegenstand empirisch erfasst und findet allmählich Einzug ins gesellschafts- bzw. sozial- und erziehungswissenschaftliche Bewusstsein.
Das Thema des Seminars beschäftigt sich mit der Entwicklungshistorie, den Strukturen und Interaktionsformen von Stieffamilien. Insofern soll mit dieser Hausarbeit der aktuelle Stand der Forschung zum Thema skizziert werden. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt neben den Strukturen der Elterlichen Subsysteme vor allem in der Beschreibung der Kinder innerhalb von Stieffamilien sowie ihrer Beziehungen zu den Geschwistersystemen.
Um dieses Thema bearbeiten zu können sollen in den ersten beiden Abschnitten die Begriffe Familie bzw. Stieffamilie und Stiefkinder geklärt werden um an späterer Stelle die Stellung der Kinder im Familiensystem aufzeigen zu können. Im dritten Kapitel wird sich eingehender mit der Rollenbildung innerhalb eines Stieffamiliensystems beschäftigt, um die Kommunikations- und Interaktionsmuster als Rahmenbedingungen aufzeigen zu können. Im Anschluß daran zeige ich auf, wie Kinder den Verlust eines Elternteils erleben und welchen Loyalitätskonflikten sie ausgesetzt sein können. Danach stelle ich die verschiedenartigen Möglichkeiten der Geschwisterbindungen zu leiblichen und Stief- oder Halbgeschwistern mitsamt ihren Erscheinungen auf.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Grundannahmen/Definition
- Die Familie als System
- Die Entwicklung der Stieffamilie
- Stieffamilienformen und -strukturen
- Rollenbildung im Stieffamiliensystem
- Biographie der Partner
- Entwicklungsaufgaben für die Stieffamilie
- Alltagsorganisation
- Die Gestaltung der Mutterrolle in Stieffamilien
- Situation der Mütter in Stiefvaterfamilien
- Situation der Stiefmütter in Vaterfamilien
- Die Gestaltung der Vaterrolle in Stieffamilien
- Die Situation der Väter in Stiefmutterfamilien
- Situation der Stiefväter in Mutterfamilien
- Beziehungsgestaltung der Kinder
- Auswirkungen der Trennung und Bewältigung des Verlusterlebnisses
- Loyalitätskonflikte und die Zugehörigkeit zu zwei Familien
- Beziehungen zu den Geschwistern
- Die Rolle der Kinder, Beziehungsgestaltung und der Umgang mit der Mehrelternschaft
- Sozialpädagogische Beratungsansätze
- Thesenpapier
- Thesen zur Entwicklung der Stieffamilie
- Thesen zu allgemeinen Problembereichen und Bewältigungsmuster von Stieffamilien
- Thesen zu Mütter in Stiefvaterfamilien
- Thesen zur Stiefmutter
- Thesen zu Väter in Stiefmutterfamilien
- Thesen zu Beratung/Therapie
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Stieffamilie und beleuchtet verschiedene Aspekte der Beziehungs- und Alltagsgestaltung in diesem Familiensystem. Sie will einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema geben und dabei insbesondere die Rolle der Kinder in Stieffamilien sowie deren Beziehungen zu den Geschwistern beleuchten.
- Entwicklungsstufen und Strukturen im Stieffamiliensystem
- Auswirkungen unterschiedlicher Familienformen auf Rollenmuster in Stieffamilien
- Die Rolle des Kindes in der neuen Familienkonstellation und dessen Bewältigungsmechanismen
- Beziehungen zwischen leiblichen und nicht-leiblichen Geschwistern in Stieffamilien
- Sozialpädagogische Beratungsansätze für Stieffamilien
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort skizziert die Relevanz des Themas und stellt die zentralen Fragestellungen der Hausarbeit vor.
- Die Kapitel 1 und 2 definieren die Begriffe Familie und Stieffamilie sowie die Rolle des Stiefkindes.
- Kapitel 3 analysiert die Rollenbildung innerhalb von Stieffamilien und zeigt die relevanten Kommunikations- und Interaktionsmuster auf.
- Kapitel 4 beleuchtet die Erfahrungen von Kindern mit dem Verlust eines Elternteils und die damit verbundenen Loyalitätskonflikte.
- Kapitel 5 untersucht die verschiedenen Formen von Geschwisterbeziehungen zwischen leiblichen und Stief- oder Halbgeschwistern.
- Kapitel 6 beschreibt die typischen Rollen von Kindern in Stieffamilien sowie ihren Umgang mit der Mehrelternschaft.
- Kapitel 7 präsentiert sozialpädagogische Beratungsansätze für Stieffamilien und zeigt Problemstellungen sowie Lösungsansätze auf.
- Das Kapitel „Thesenpapier“ präsentiert verschiedene Thesen zur Entwicklung von Stieffamilien und zu ihren spezifischen Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Forschungsfeld der Stieffamilie, untersucht deren Entwicklung und behandelt zentrale Themen wie Rollenbildung, Beziehungsdynamiken, Loyalitätskonflikte, Geschwisterbeziehungen und sozialpädagogische Beratungsansätze.
- Quote paper
- Diplom-Pädagoge Ralf-Peter Nungäßer (Author), 1995, Die Entwicklung der Stieffamilie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86674