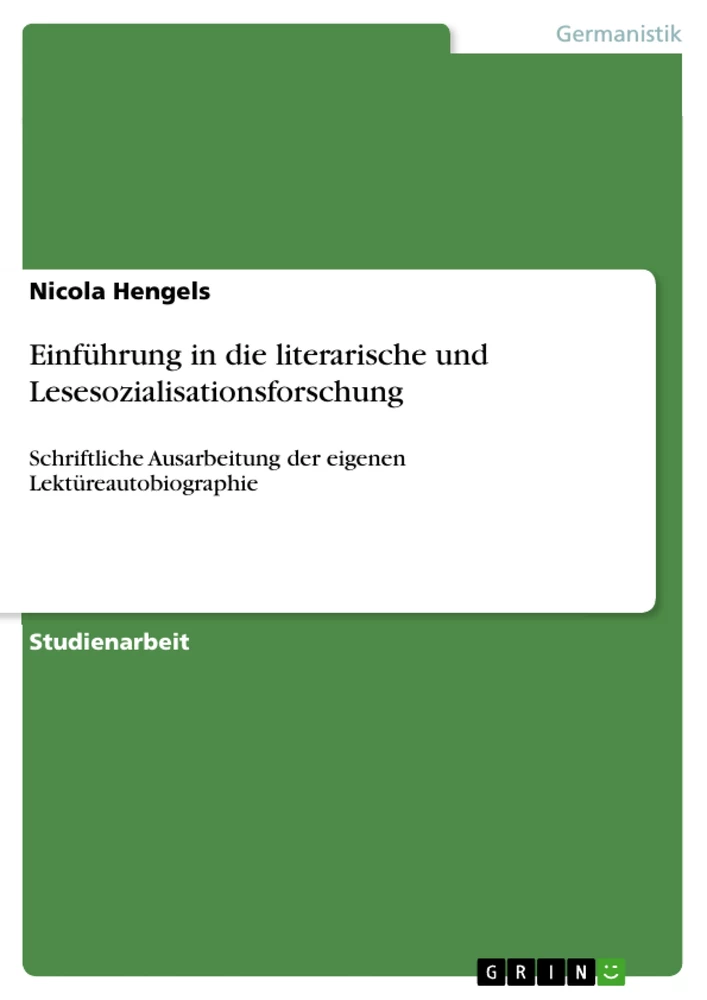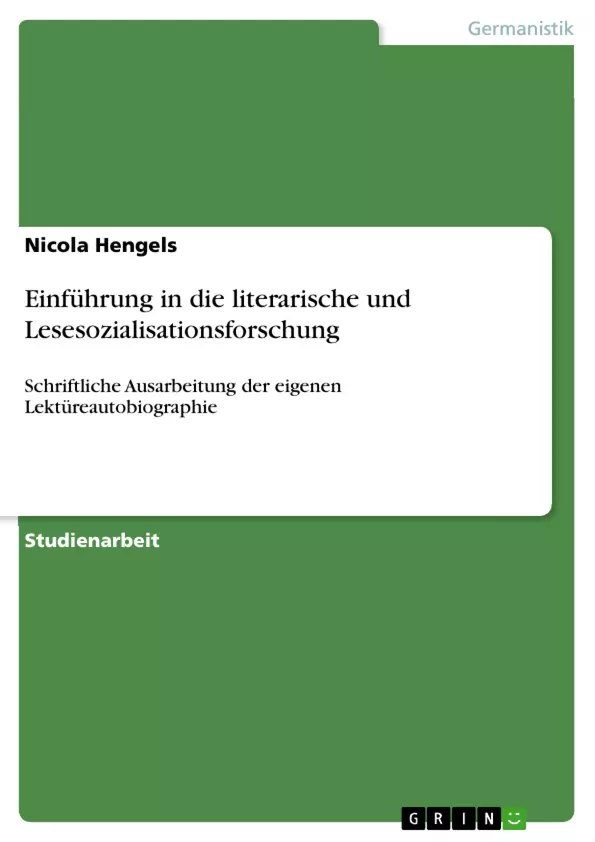Im Rahmen meines Studiums für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen B.A. habe ich das Modul „Orientierung auf Literatur“, bestehend aus der Vorlesung „Einführung in die literarische und Lesesozialisationsforschung“, sowie das zugehörige Tutorium besucht. Dieses Modul beschäftigt sich mit der Frage, wie Kinder und Jugendliche zu Lesern werden und stellt dabei eine Vielzahl an wissenschaftlichen Erkenntnissen vor, die aufzeigen, welche Fak-toren für junge Menschen zu einer gelingenden Lesesozialisation führen können und welche das Misslingen derselben zu verursachen scheinen. Für Deutschlehrkräfte, welche in der Re-gel der oberen Bildungsschicht entstammen, ist es von essentieller Bedeutung die Abläufe der Lesesozialisation zu kennen und zu wissen, wo und wie deren Weichen zu einem glückenden Verlauf gestellt werden können, um dieses Wissen im Berufsleben auch erfolgreich anwenden zu können.
In der folgenden Lektüreautobiographie beschäftige ich mich mit dem Verlauf meiner persönlichen Lesesozialisation. Ich fertige hierzu eine wissenschaftliche Ausarbeitung meiner eigenen Leseautobiographie an. Dabei werde ich induktiv vorgehen, indem ich meine Erinnerungen und Recherchen zum Verlauf meiner Lesesozialisation gegliedert in sinnvolle Zeitabschnitte darstelle, um sie anschließend, bezogen auf wissenschaftliche Theorien und For-schungsergebnisse der Autoren Graf, Hurrelmann, Schön und Wieler, in überindividuelle Zusammenhänge einordnen zu können. Der Hauptteil meiner Arbeit, meine literarische Sozialisation und deren Analyse, besteht somit aus 5 Phasen, beginnend mit der Vorschulzeit, zu welcher ich meine gesamten Lebensjahre vor der Einschulung rechne, und endend mit meinem heutigen Leseverhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familiärer Hintergrund und Leseklima innerhalb der Familie.
- Phasen meiner literarischen Sozialisation
- Vorschulalter und primäre literarische Initiation
- Einschulung und das Lesen in der Kindheit
- Das Lesen in der Pubertät
- Das Lesen in der Adoleszenz und die literarische Pubertät
- Das Lesen und Vorlesen als Erwachsene
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Lektüreautobiographie soll den Verlauf der persönlichen Lesesozialisation der Autorin untersuchen und in den Kontext wissenschaftlicher Theorien und Forschungsergebnisse einordnen. Die Arbeit basiert auf der Induktion, indem die persönlichen Erinnerungen der Autorin gegliedert und anschließend mit den Theorien von Graf, Hurrelmann, Schön und Wieler in einen überindividuellen Zusammenhang gestellt werden.
- Rekonstruktion der Lesesozialisation der Autorin in fünf Phasen
- Analyse der eigenen Lesesozialisation anhand wissenschaftlicher Theorien
- Zuordnung der Autorin zu den Lesertypen „ästhetischer Leser“ und „erwarteter Leser“
- Identifizierung von Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen persönlicher Entwicklung und wissenschaftlichen Theorien
- Bedeutung des familiären Leseklimas für die Lesesozialisation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Autorin beschreibt die Motivation für die Erstellung ihrer Lektüreautobiographie im Rahmen ihres Studiums für das Lehramt. Sie erläutert die Relevanz der Lesesozialisationsforschung für Deutschlehrkräfte und erklärt die induktive Vorgehensweise ihrer Arbeit.
- Familiärer Hintergrund und Leseklima innerhalb der Familie: Die Autorin stellt den familiären Hintergrund und das Leseklima in ihrer Kindheit vor. Sie hebt die Bedeutung des pädagogischen Umfelds und die starke Lesebegeisterung ihrer Eltern und Patin hervor. Sie verweist auf die Kongruenz zwischen den Einstellungen ihrer Eltern und ihrem eigenen Leseverhalten.
Schlüsselwörter
Lektüreautobiographie, Lesesozialisation, ästhetischer Leser, erwarteter Leser, Familienklima, Leseförderung, primäre literarische Initiation, Induktion, wissenschaftliche Theorien, Graf, Hurrelmann, Schön, Wieler.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Lektüreautobiographie?
Das Ziel ist die Rekonstruktion und wissenschaftliche Analyse der persönlichen Lesesozialisation, um individuelle Erfahrungen in überindividuelle, theoretische Zusammenhänge einzuordnen.
Welche wissenschaftlichen Theorien werden zur Analyse herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf Forschungsergebnisse und Theorien der Autoren Graf, Hurrelmann, Schön und Wieler.
Warum ist die Lesesozialisationsforschung für Lehrkräfte wichtig?
Lehrkräfte müssen verstehen, wie Kinder zu Lesern werden und welche Faktoren den Erfolg oder Misserfolg dieser Entwicklung beeinflussen, um die Leseförderung im Berufsalltag gezielt anwenden zu können.
In welche Phasen wird die literarische Sozialisation in dieser Arbeit unterteilt?
Die Sozialisation wird in fünf Phasen gegliedert: Vorschulzeit, Kindheit nach der Einschulung, Pubertät, Adoleszenz und das Leseverhalten als Erwachsene.
Was versteht man unter dem Begriff „primäre literarische Initiation“?
Dies beschreibt den ersten Kontakt mit Literatur und Geschichten, der meist im familiären Umfeld vor der Schulzeit stattfindet.
Welche Lesertypen werden in der Analyse unterschieden?
Die Arbeit ordnet die Entwicklung den Typen des „ästhetischen Lesers“ und des „erwarteten Lesers“ zu.
- Quote paper
- Nicola Hengels (Author), 2007, Einführung in die literarische und Lesesozialisationsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86591