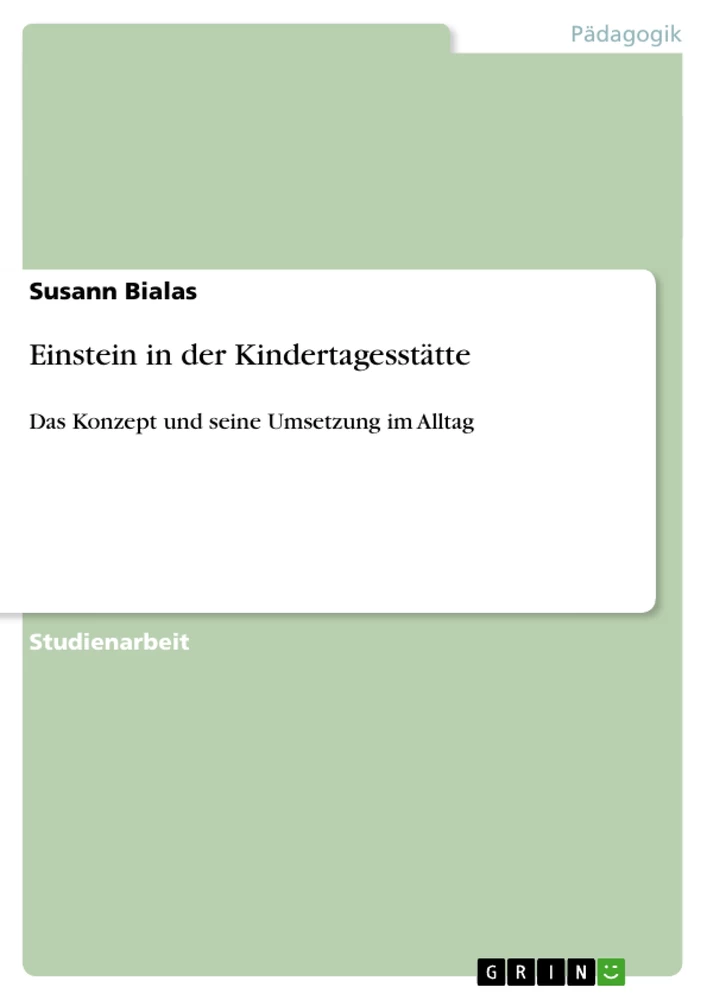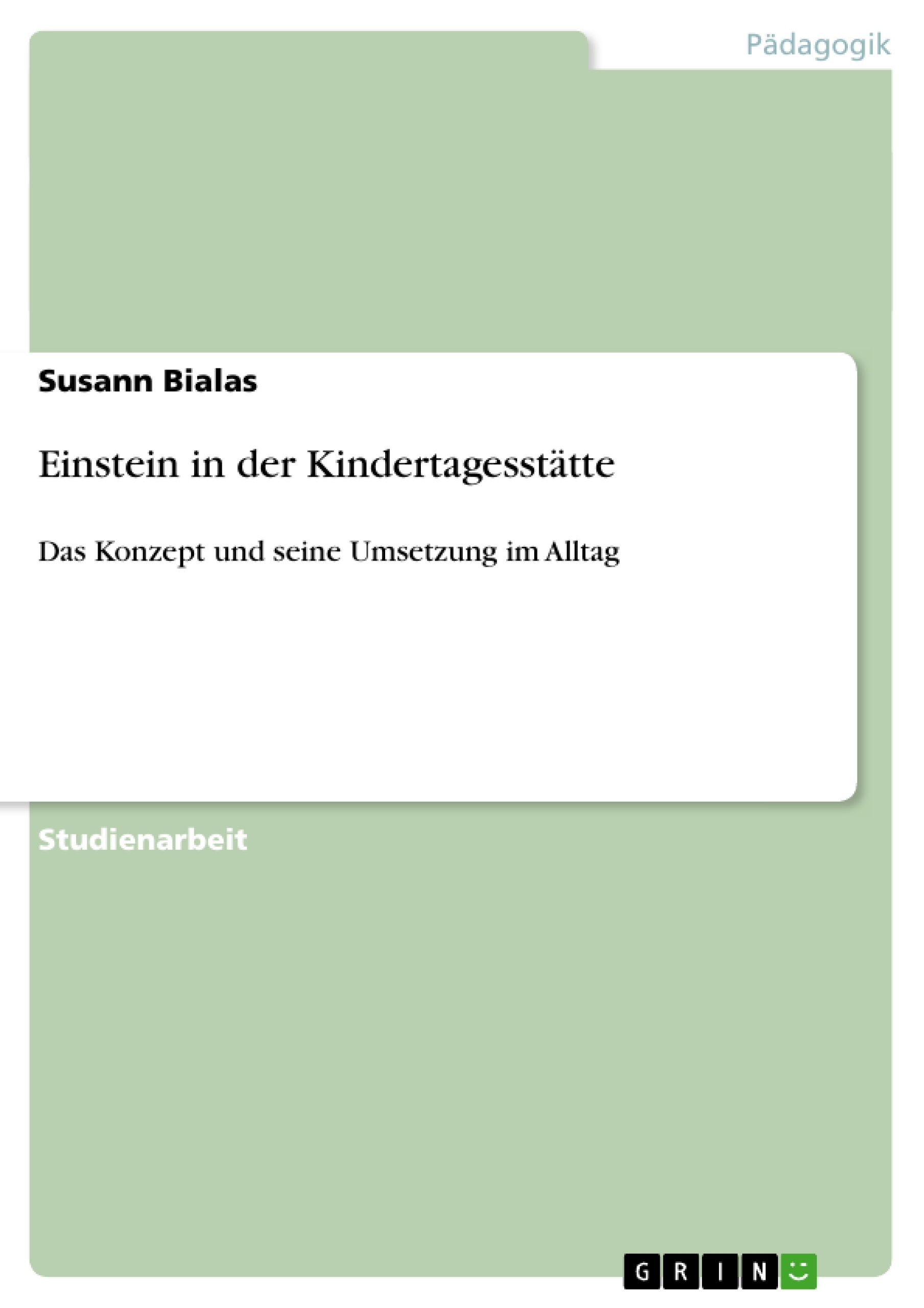Im Einstein-Jahr 2005, dem 50. Todestag von ALBERT EINSTEIN, wurde die Spezielle Relativitätstheorie 100 Jahre alt. Im selben Jahr endete in acht Kindertageseinrichtungen der Stadt Stuttgart eine dreijährige Projektphase zur Erprobung eines Konzepts mit dem Namen Einstein in der Kindertageseinrichtung.
Dabei handelt es sich um ein frühpädagogisches Konzept, dessen Entwicklung bereits 2001 durch das Jugendamt der Stadt Stuttgart begann. Ein Jahr später wurde das Institut für angewandte Sozialisationsforschung/Frühe Kindheit e.V. (infans) beauftragt, ihr neuartig entwickeltes Handlungskonzept, das 10-Stufen-Projekt-Bildung, welches auf den in den Jahren 1997-2000 unter anderem in Brandenburger Kindertageseinrichtungen gesammelten Ergebnissen des Modellprojekts Zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen basiert, unter Stuttgarter Bedingungen zu testen. Dabei wurden die ursprünglich zehn Arbeitsmodule für das Einstein-Konzept in fünf Module zusammengefasst, die im zweiten Kapitel näher erläutert werden.
Die Erprobung in den acht ausgewählten so genannten „Laborkitas“ mit rund 700 Kindern, ihren Eltern und über 100 Fachkräften des Jugendamt Stuttgart verlief so erfolgreich, dass die Kindertageseinrichtungen in einem bundesweitem Wettbewerb als die besten Deutschlands ausgezeichnet wurden.
Seit Beginn des Jahres 2006 arbeitet infans in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern in Baden-Württemberg daran, das Konzept über die „Laborkitas“ hinaus auf alle Einrichtungen der Träger zu übertragen. Ziel ist es, auf der Grundlage des infans-Konzepts die Vorgaben des Baden-Württembergischen Orientierungsplans für Kindertageseinrichtungen zu erreichen. Auch in Stuttgart sollen bis 2012 alle 170 städtischen Kindertageseinrichtungen auf dieser Basis arbeiten. Dabei ist die Entwicklung von Betreuungseinrichtungen mit Bildungsauftrag zu Bildungseinrichtungen mit Betreuungsauftrag als kontinuierlicher Transferprozess geplant, dessen letzte Stufe im Jahr 2010 beginnt. Die Orientierung aller Einrichtungen an dem im Projekt von 2003-2005 entwickelten Bildungskonzept und die entsprechende Umstellung der pädagogischen Arbeit ist eine tief greifende Veränderung, die nur stufenweise erreicht werden kann. Nach den acht „Laborkitas“ aus der Projektphase haben seit 2006 19 weitere Kindertageseinrichtungen mit der konsequenten Umsetzung des Bildungskonzepts Einstein in der Kindertageseinrichtung begonnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Die Notwendigkeit eines solchen frühpädagogischen Konzepts
- 1.3 Motivation und auftretende Fragestellungen
- 2. Das Konzept Einstein in der Kindertageseinrichtung
- 2.1 Die Grundlage und Ziel des Konzepts
- 2.2 Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen
- 2.2.1 Die Grundbegriffe der infans-Pädagogik: Betreuung, Bildung und Erziehung
- 2.2.2 Das konstruierende Kind und seine Bildungsbereiche
- 2.3 Die fünf Module des Konzepts
- 2.3.1 Modul 1 - 4: Das konkrete Vorgehen hinsichtlich der Inhalte und Methoden
- 2.3.2 Modul 5: Hinweise zu den organisatorischen Rahmenbedingungen
- 2.4 Das Portfolio: Die Zusammenfassung der Instrumente der Erzieherinnen
- 2.4.1 Die Instrumente für die Beobachtung
- 2.4.2 Das individuelle Curriculum
- 2.4.3 Grenzsteine der Entwicklung
- 3. Die Umsetzung im Alltag - von der Betreuungseinrichtung zur Bildungseinrichtung
- 3.1 Vor Arbeitsbeginn
- 3.2 Veränderungen im Alltag
- 3.2.1 Raumgestaltung und angebotene Materialien
- 3.2.2 Die neue Rolle der Erzieherin
- 3.2.3 Der fachliche Diskurs im Team und mit anderen Einrichtungen
- 3.2.4 Die Elternarbeit
- 3.3 Das sich bildende Kind braucht die sich bildende Erzieherin
- 4. Konsequenzen aus dem Konzept und aktuelle Probleme
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Stolpersteine bei der Umsetzung
- 4.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht das frühpädagogische Konzept „Einstein in der Kindertageseinrichtung“, das in Stuttgarter Kindertagesstätten erprobt wurde. Ziel ist es, die Umsetzung des Konzepts im Alltag zu beschreiben und die Herausforderungen sowie die daraus resultierenden Konsequenzen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit eines solchen Konzepts im Kontext aktueller Forschungsergebnisse und des gesetzlichen Bildungsauftrags für Kindertageseinrichtungen.
- Die Notwendigkeit und Entwicklung frühpädagogischer Konzepte im Kontext der Pisa-Studie und aktueller Hirnforschung.
- Die Definition und Abgrenzung der Begriffe Betreuung, Bildung und Erziehung im frühpädagogischen Kontext.
- Die Umsetzung des „Einstein“-Konzepts in der Praxis, inklusive der Veränderungen in Raumgestaltung, Rolle der Erzieherinnen und Elternarbeit.
- Die Herausforderungen und Stolpersteine bei der Implementierung des Konzepts.
- Die Bedeutung des Konzepts für die Entwicklung von Betreuungseinrichtungen zu Bildungseinrichtungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das frühpädagogische Konzept „Einstein in der Kindertageseinrichtung“ vor, das im Rahmen eines dreijährigen Projekts in Stuttgarter Kindertagesstätten erprobt wurde. Sie beschreibt die Entstehung des Konzepts, seine erfolgreiche Implementierung und die Auszeichnung der beteiligten Einrichtungen. Weiterhin wird die Notwendigkeit eines solchen Konzepts im Kontext des gesetzlichen Bildungsauftrags und aktueller Forschungsergebnisse zur frühkindlichen Entwicklung begründet. Die Einleitung führt die zentralen Fragestellungen der Arbeit ein, die sich aus den praktischen Erfahrungen der Autorin in einer „Laborkita“ ergeben.
2. Das Konzept Einstein in der Kindertageseinrichtung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Konzept „Einstein in der Kindertageseinrichtung“. Es erläutert die Grundlagen und Ziele des Konzepts, definiert die zentralen Begriffe Betreuung, Bildung und Erziehung im Kontext der infans-Pädagogik und beschreibt die fünf Module des Konzepts. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Portfolios als Instrument zur Dokumentation der Entwicklung der Kinder. Die Darstellung der einzelnen Module und des Portfolios soll ein umfassendes Verständnis des Konzepts vermitteln.
3. Die Umsetzung im Alltag - von der Betreuungseinrichtung zur Bildungseinrichtung: Dieses Kapitel beleuchtet die praktische Umsetzung des „Einstein“-Konzepts in den teilnehmenden Kindertagesstätten. Es beschreibt die Veränderungen im Alltag, die durch die Implementierung des Konzepts entstanden sind, insbesondere die veränderte Raumgestaltung, die neue Rolle der Erzieherin, den fachlichen Diskurs und die Elternarbeit. Der Fokus liegt auf dem Transformationsprozess von Betreuungseinrichtungen zu Bildungseinrichtungen und der Bedeutung der kontinuierlichen Weiterbildung der Erzieherinnen.
Schlüsselwörter
Frühpädagogik, Bildungskonzept, Einstein, Kindertageseinrichtung, Betreuung, Bildung, Erziehung, infans-Pädagogik, Forschung, Hirnforschung, Umsetzung, Herausforderungen, Elternarbeit, Bildungsauftrag.
Häufig gestellte Fragen zum frühpädagogischen Konzept „Einstein in der Kindertageseinrichtung“
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studienarbeit untersucht das frühpädagogische Konzept „Einstein in der Kindertageseinrichtung“, das in Stuttgarter Kindertagesstätten erprobt wurde. Die Arbeit beschreibt die Umsetzung des Konzepts im Alltag und analysiert die Herausforderungen und Konsequenzen.
Welche Ziele verfolgt die Studie?
Ziel der Studie ist es, die praktische Umsetzung des „Einstein“-Konzepts zu beschreiben und die Herausforderungen sowie die daraus resultierenden Konsequenzen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit eines solchen Konzepts im Kontext aktueller Forschungsergebnisse und des gesetzlichen Bildungsauftrags für Kindertageseinrichtungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Studie behandelt die Notwendigkeit und Entwicklung frühpädagogischer Konzepte im Kontext der Pisa-Studie und aktueller Hirnforschung, die Definition und Abgrenzung der Begriffe Betreuung, Bildung und Erziehung im frühpädagogischen Kontext, die praktische Umsetzung des „Einstein“-Konzepts (inkl. Veränderungen in Raumgestaltung, Rolle der Erzieherinnen und Elternarbeit), die Herausforderungen und Stolpersteine bei der Implementierung und die Bedeutung des Konzepts für die Entwicklung von Betreuungseinrichtungen zu Bildungseinrichtungen.
Wie ist das „Einstein“-Konzept aufgebaut?
Das „Einstein“-Konzept besteht aus fünf Modulen, die im Detail im zweiten Kapitel beschrieben werden. Ein zentrales Element ist das Portfolio als Instrument zur Dokumentation der kindlichen Entwicklung. Die Module befassen sich mit konkreten Vorgehensweisen hinsichtlich Inhalte und Methoden sowie mit den organisatorischen Rahmenbedingungen.
Welche Veränderungen im Alltag der Kindertagesstätte beschreibt die Studie?
Die Studie beschreibt Veränderungen in der Raumgestaltung und den angebotenen Materialien, die neue Rolle der Erzieherin, den fachlichen Diskurs im Team und mit anderen Einrichtungen sowie die veränderte Elternarbeit. Der Fokus liegt auf dem Transformationsprozess von Betreuungseinrichtungen zu Bildungseinrichtungen.
Welche Herausforderungen und Stolpersteine werden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Konzepts genannt?
Die Studie identifiziert und beschreibt im vierten Kapitel konkrete Herausforderungen und Stolpersteine, die bei der Implementierung des „Einstein“-Konzepts aufgetreten sind. Ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen wird ebenfalls gegeben.
Welche Begriffe werden in der Studie zentral verwendet?
Schlüsselwörter der Studie sind: Frühpädagogik, Bildungskonzept, Einstein, Kindertageseinrichtung, Betreuung, Bildung, Erziehung, infans-Pädagogik, Forschung, Hirnforschung, Umsetzung, Herausforderungen, Elternarbeit, Bildungsauftrag.
Wie ist die Studie strukturiert?
Die Studie gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Beschreibung des „Einstein“-Konzepts, Umsetzung im Alltag und Konsequenzen aus dem Konzept und aktuelle Probleme. Jedes Kapitel wird im HTML-Dokument mit einer Zusammenfassung versehen. Ein Inhaltsverzeichnis erleichtert die Navigation.
- Quote paper
- Susann Bialas (Author), 2007, Einstein in der Kindertagesstätte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86492