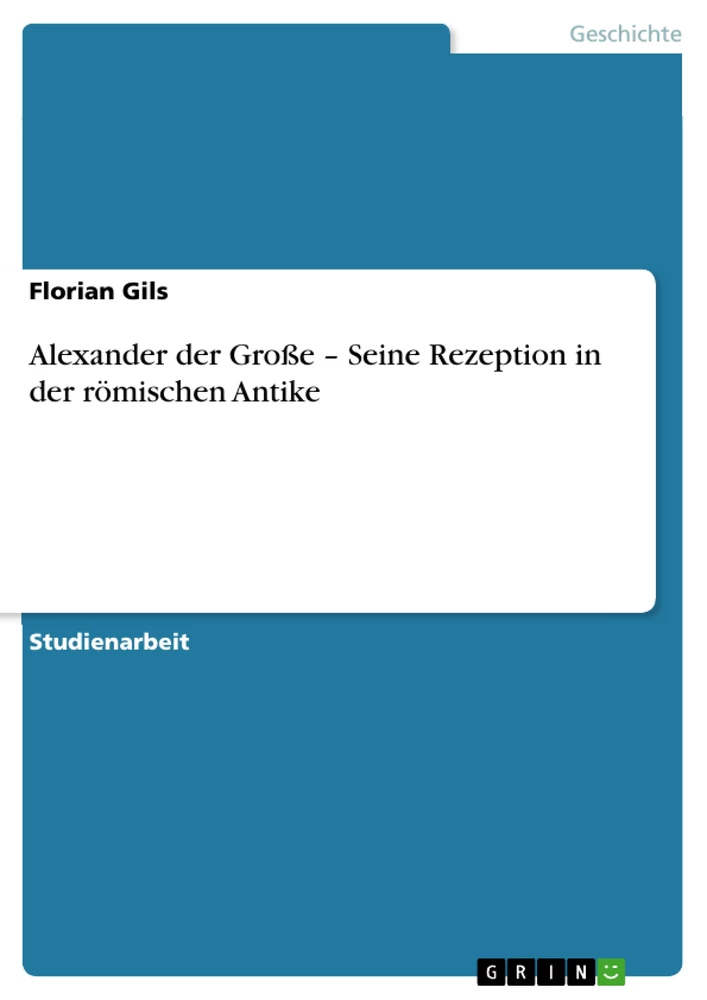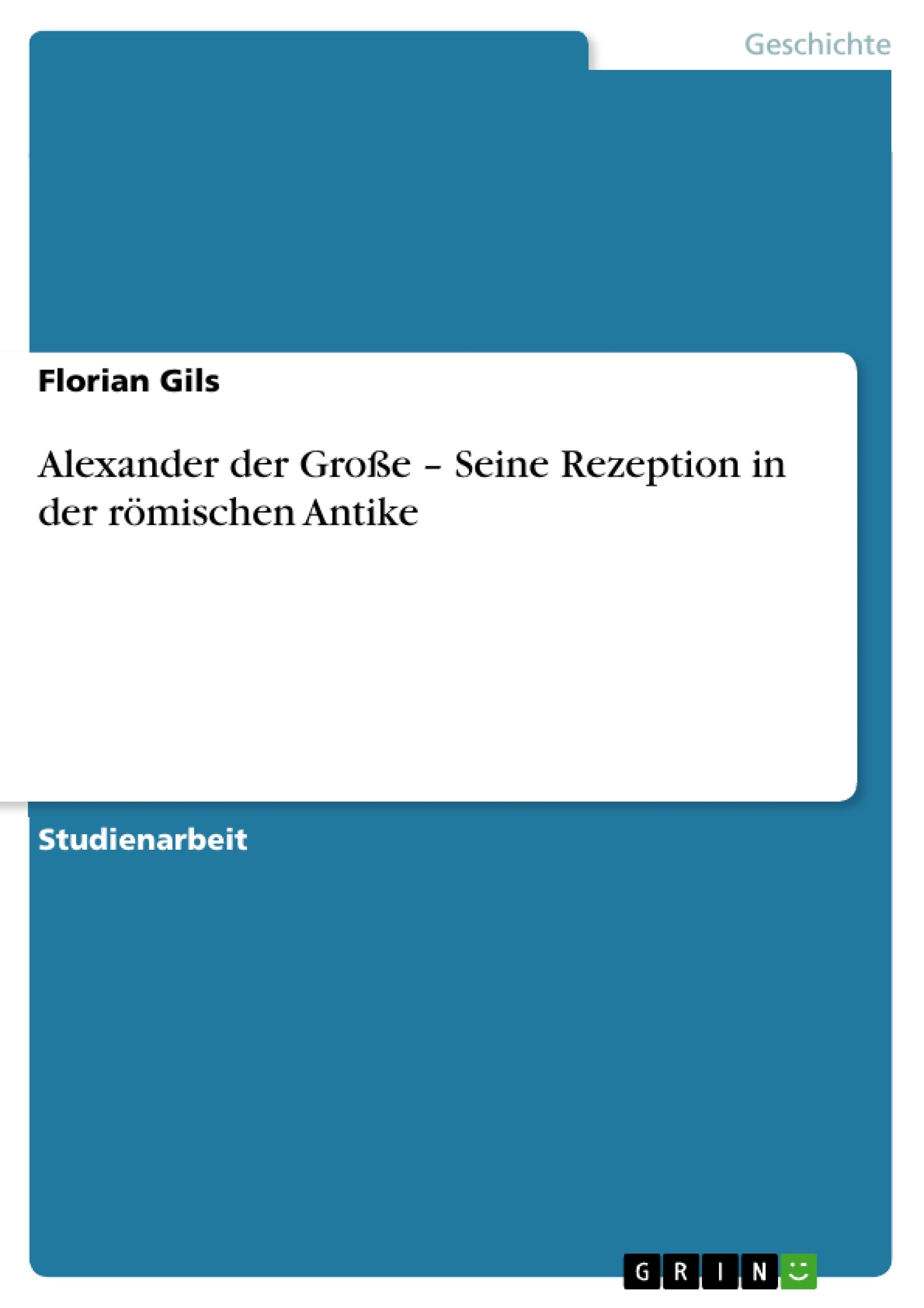Immer wieder tauchen in der Weltgeschichte Persönlichkeiten auf, deren Wesen und Wirken Zeitgenossen und Nachwelt gleichermaßen fasziniert und beeinflußt. Kaiser Augustus gehört dazu, Karl der Große, in jüngerer Zeit Friedrich II. der Große von Preußen. Doch wohl kaum einer kann auf eine so lange und ungebrochene Tradition zurückblicken wie der Makedonenkönig Alexander III. der Große.
Sein fantastischer -und wohl auch unerwarteter- Siegeszug durch das Reich der Achaemeniden bis nach Indien, sein schon den Zeitgenossen undurchschaubar und widersprüchlich erscheinender Charakter und die Unsicherheit über seine eigentlichen und abschließenden Pläne, riefen bereits zu seinen Lebzeiten und kurz nach seinem frühen Tode panegyrische Lobpreisungen ebenso wie bittere Verleumdungen hervor.
Den Nachfolgern in seinem rasch zerfallenden Reich diente er als Legitimation ihrer eigenen Herrschaft, als Objekt des Heroenkultes, als glorreiche Figur einer glorreichen Vergangenheit. Fast folgerichtig wurde dann auch von den Römern auf ihn zurückgegriffen, insbesondere nach der Unterwerfung der diadochischen Nachfolgereiche, deren letztes, das Ptolemaierreich 31. v.Chr mit dem Tode Kleopatras VII. in den Herrschaftsbereich des Römischen Imperiums eingegliedert wurden.
Wie aber sah nun diese Rezeption aus?
In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, der Wirkung Alexanders auf die römische Gesellschaft von der Republik bis zum Untergang des Imperium Romanum nachzugehen. Da dabei ein Zeitraum von ca. 600 Jahren abzudecken sein wird, kann im Rahmen dieser Arbeit freilich kein Anspruch auf flächendeckende Vollständigkeit erhoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Republik bis Augustus
- Erste Kontakte - Ein heißes Eisen!
- Römische Feldherren und Politiker
- Scipio Africanus – Vergöttlichung des Karthago-Zerstörers
- Pompejus erfolgreicher Feldherr im Osten, aber Staatsmann in alter Tradition
- Julius Caesar – „Verdammt, noch nichts geleistet!“
- Marc Anton – Potentat im Osten nach Alexanders Vorbild?
- Octavian „Ich will einen König sehen, keine Toten!“
- Zusammenfassung
- Das erste Jahrhundert n.Chr. bis zu den Adoptivkaisern
- Caligula - der Caesarenwahn und Alexander: kaiserlicher Karneval
- Nero-Der Künstler und sein Lehrer
- Zusammenfassung
- Das zweite Jahrhundert: Adoptivkaiser. Entspannung zwischen Kaiser und Senat – Entspannung zu Alexander?
- Trajan „Ach wär' ich doch so jung wie Alexander!“
- Marc Aurel - Übe Demut und bedenke, daß Du vergänglich bist!
- Zusammenfassung
- Von den Severern bis zum Untergang des Imperiums
- Septimius Severus – Alexander im Spannungsfeld der Thronkämpfe
- Caracalla -„Alexander“ als Realpolitik?
- Alexander Severus – Liebling der Historiker in der Nachfolge Caracallas
- Julian Apostata - „Ich fürchte die Größe Alexanders“
- Zusammenfassung
- Schlußbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption Alexanders des Großen in der römischen Gesellschaft vom Beginn der Republik bis zum Untergang des römischen Imperiums. Aufgrund des langen Zeitraums wird eine vollständige Abdeckung nicht angestrebt. Der Fokus liegt auf der Analyse der verschiedenen Perspektiven und Interpretationen Alexanders in unterschiedlichen Epochen und durch verschiedene Persönlichkeiten des römischen Reiches.
- Die frühe Rezeption Alexanders in Rom und die ersten Kontakte zwischen Rom und Alexander.
- Die Nutzung des Alexanderbildes durch römische Feldherren und Politiker zur Legitimation ihrer Herrschaft.
- Die Entwicklung der Alexander-Ikonographie in Rom und ihre Bedeutung.
- Der Einfluss Alexanders auf die politische Ideologie des römischen Reiches.
- Die unterschiedlichen Interpretationen Alexanders in verschiedenen Phasen der römischen Geschichte.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Rezeption Alexanders des Großen in der römischen Antike ein. Sie betont die lange und anhaltende Faszination, die Alexander auf Zeitgenossen und Nachwelt ausübte, und seine Bedeutung als Vorbild und Legitimationsfigur für spätere Herrscher. Die Arbeit selbst konzentriert sich auf die Analyse der römischen Rezeption Alexanders über einen Zeitraum von ca. 600 Jahren, wobei Vollständigkeit aufgrund des Umfangs nicht gewährleistet werden kann. Die Einleitung erwähnt die Problematik unterschiedlicher Interpretationen Alexanders und verweist auf die Herausforderungen einer umfassenden historischen Darstellung.
Von der Republik bis Augustus: Dieses Kapitel untersucht die ersten Kontakte zwischen Rom und Alexander, beginnend mit apulischen Vasen, die Alexander bereits zu seinen Lebzeiten darstellen. Es analysiert die kontroverse Debatte über eine römische Gesandtschaft nach Babylon im Jahr 323 v. Chr. und die Rolle Alexanders in der Rhetorik von Persönlichkeiten wie Pyrrhus. Die Erwähnung Alexanders bei Plautus um 200 v. Chr. wird als Indiz für seine zunehmende Popularität in Rom gewertet. Das Kapitel beleuchtet die frühen, oftmals indirekten, Begegnungen mit der Gestalt Alexanders und deren Wirkung auf die römische Wahrnehmung.
Das erste Jahrhundert n.Chr. bis zu den Adoptivkaisern: Dieses Kapitel analysiert die Rezeption Alexanders unter den Kaisern Caligula und Nero. Es beleuchtet, wie beide Herrscher das Alexanderbild instrumentalisierten, Caligula durch die Inszenierung von Macht und Größenwahn, Nero in Verbindung mit seinem künstlerischen Anspruch. Die jeweiligen Strategien und deren Bezug zum Alexandersbild werden im Detail untersucht. Der Abschnitt betont die unterschiedlichen Arten, wie die Kaiser das Erbe Alexanders nutzten, um ihre Herrschaft zu festigen und ihre Image zu gestalten.
Das zweite Jahrhundert: Adoptivkaiser. Entspannung zwischen Kaiser und Senat – Entspannung zu Alexander?: Hier wird die Rezeption Alexanders unter den Adoptivkaisern Trajan und Marc Aurel untersucht. Im Gegensatz zu den vorherigen Kapiteln steht hier die Frage im Vordergrund, wie die idealisierte Gestalt Alexanders in Zeiten relativer Stabilität und friedlicherer Beziehungen zwischen Kaiser und Senat interpretiert und genutzt wurde. Die unterschiedlichen Herangehensweisen Trajans und Marc Aurels an die Führungsrolle und ihre mögliche Verbindung zur Alexandersfigur werden analysiert.
Von den Severern bis zum Untergang des Imperiums: Dieses Kapitel behandelt die Rezeption Alexanders während der Herrschaft verschiedener Kaiser der Severer-Dynastie und Julian des Abtrünnigen. Es zeigt, wie Alexander in Zeiten politischer Instabilität und Machtkämpfe instrumentalisiert wurde. Es untersucht die unterschiedlichen Interpretationen Alexanders als militärisches Vorbild (Septimius Severus, Caracalla) oder als Herrscherideal (Alexander Severus), sowie die kritische Auseinandersetzung Julians mit dem Alexandersbild. Der Abschnitt betont die Adaption des Alexander-Mythos in unterschiedlichen politischen Kontexten und die vielfältigen strategischen Nutzungen.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, Römische Antike, Rezeption, Römische Feldherren, Kaiser, Politische Ideologie, Ikonographie, Legitimation, Herrschaft, Vergleich, Imitatio, Aemulatio, Comparatio.
Häufig gestellte Fragen zur Rezeption Alexanders des Großen im Römischen Reich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rezeption Alexanders des Großen in der römischen Gesellschaft vom Beginn der Republik bis zum Untergang des römischen Imperiums. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Perspektiven und Interpretationen Alexanders in unterschiedlichen Epochen und durch verschiedene Persönlichkeiten des römischen Reiches. Vollständigkeit wird aufgrund des langen Zeitraums nicht angestrebt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Von der Republik bis Augustus, Das erste Jahrhundert n. Chr. bis zu den Adoptivkaisern, Das zweite Jahrhundert: Adoptivkaiser, Von den Severern bis zum Untergang des Imperiums und Schlußbetrachtungen. Jedes Kapitel behandelt die Rezeption Alexanders in einer spezifischen Epoche der römischen Geschichte.
Wie werden die ersten Kontakte zwischen Rom und Alexander behandelt?
Das Kapitel "Von der Republik bis Augustus" untersucht die ersten Kontakte, beginnend mit apulischen Vasen, die Alexander bereits zu seinen Lebzeiten darstellen. Es analysiert die Debatte um eine römische Gesandtschaft nach Babylon und Alexanders Rolle in der Rhetorik von Persönlichkeiten wie Pyrrhus. Die Erwähnung Alexanders bei Plautus wird als Indiz für seine zunehmende Popularität in Rom gewertet.
Wie wird die Nutzung des Alexanderbildes durch römische Herrscher dargestellt?
Die Arbeit zeigt auf, wie verschiedene römische Feldherren und Kaiser das Alexanderbild zur Legitimation ihrer Herrschaft nutzten. Beispiele hierfür sind Caligula und Nero im ersten Jahrhundert, die das Bild Alexanders für ihre jeweiligen Machtinszenierungen instrumentalisierten. Auch Trajan und Marc Aurel im zweiten Jahrhundert werden in diesem Kontext untersucht, wobei hier der Fokus auf der Nutzung des Alexanderbildes in Zeiten relativer Stabilität liegt.
Welche Rolle spielt die Ikonographie Alexanders?
Die Entwicklung der Alexander-Ikonographie in Rom und ihre Bedeutung wird in der Arbeit untersucht. Die Analyse umfasst die unterschiedlichen Darstellungen Alexanders in verschiedenen Epochen und deren jeweilige Interpretationen. Diese ikonographischen Aspekte beleuchten die vielfältigen Strategien der politischen und kulturellen Aneignung Alexanders.
Wie werden die unterschiedlichen Interpretationen Alexanders in verschiedenen Phasen der römischen Geschichte dargestellt?
Die Arbeit betont die unterschiedlichen Interpretationen Alexanders in verschiedenen Phasen der römischen Geschichte. Alexander wird mal als militärisches Vorbild (Septimius Severus, Caracalla), mal als Herrscherideal (Alexander Severus) oder auch kritisch (Julian) dargestellt. Diese unterschiedlichen Perspektiven werden im Detail analysiert und in ihren jeweiligen historischen Kontexten eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alexander der Große, Römische Antike, Rezeption, Römische Feldherren, Kaiser, Politische Ideologie, Ikonographie, Legitimation, Herrschaft, Vergleich, Imitatio, Aemulatio, Comparatio.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rezeption Alexanders des Großen in der römischen Gesellschaft über einen Zeitraum von ca. 600 Jahren. Sie analysiert die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen Alexanders in unterschiedlichen Epochen und durch verschiedene Persönlichkeiten des römischen Reiches, um dessen anhaltende Faszination und Bedeutung als Vorbild und Legitimationsfigur zu beleuchten.
- Quote paper
- Florian Gils (Author), 2007, Alexander der Große – Seine Rezeption in der römischen Antike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86490