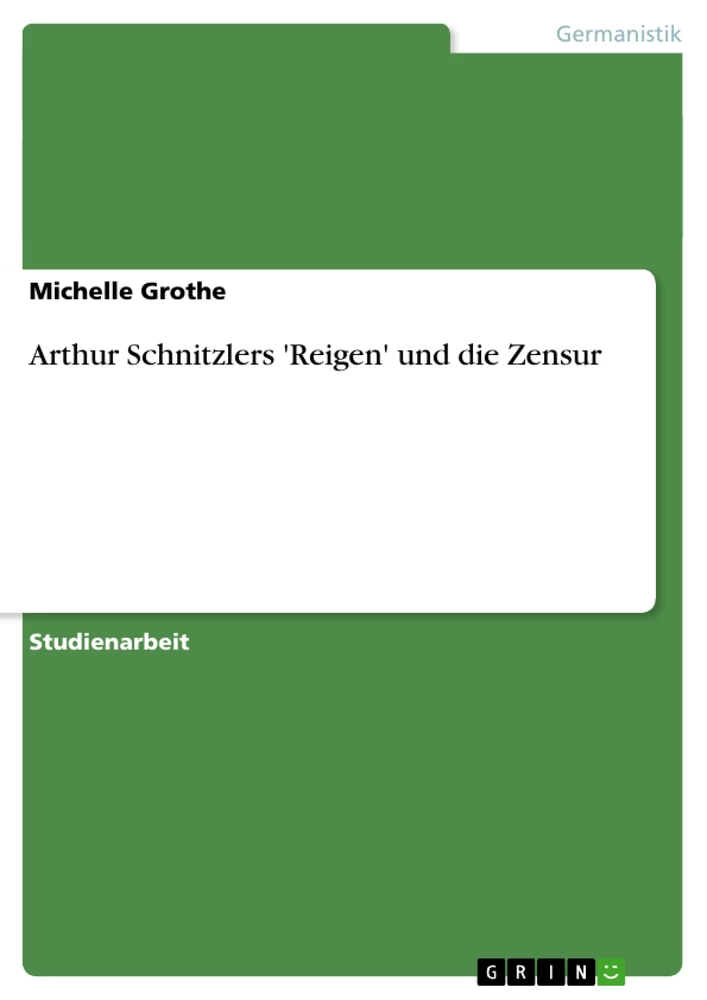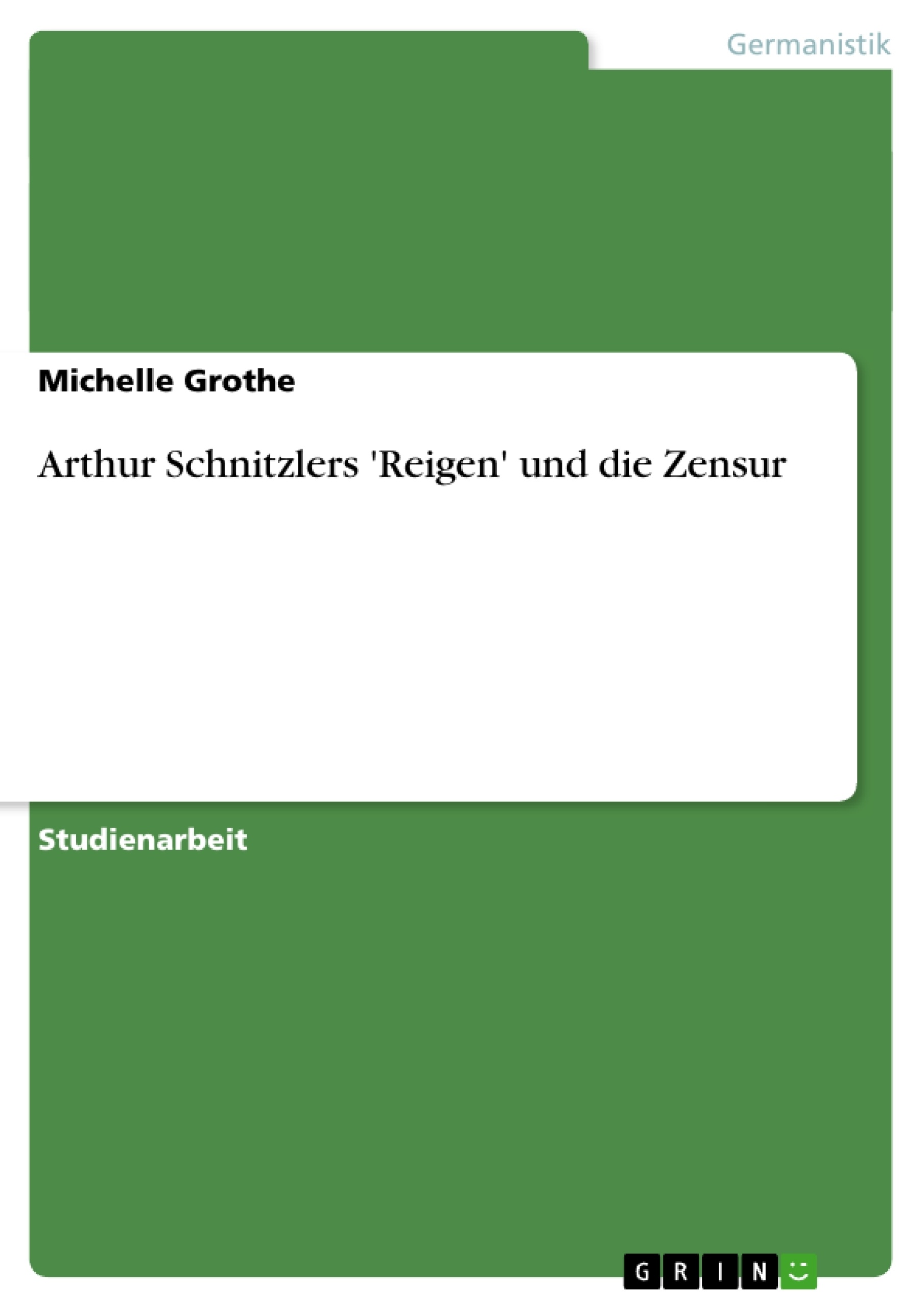Diese Arbeit will sich dem Reigen von Arthur Schnitzler von der literaturhistorischen Seite nähern. Nicht das Werk an sich steht im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die geschichtlichen Ereignisse um dieses, der große Skandal und die darauffolgenden Prozesse.
Auf der inhaltlichen Seite gilt es allerdings aufzuzeigen, woran sich die Gesellschaft der Zeit gestoßen hat, wo sie Schnitzler eventuell falsch verstanden hat oder vor allem: wo sie ihn falsch verstehen wollte. Denn wie so oft war die Frage, ob der Reigen Schmutz und Schund oder gar Pornographie sei, vorrangig der Aufhänger für politische Zwecke und wurde vor allem von Menschen bemüht, denen die Kunst kaum am Herzen lag und deren machtpolitischen Ziele all` zu leicht zu durchschauen gewesen sein dürften. In dieser Hinsicht können die Vorgänge um den Reigen als Vorboten des Dritten Reiches gedeutet werden. Die faschistischen Bewegungen und die konservativen Schichten arbeiteten sich hier in die Arme:
So erreichten die rechtsradikalen Horden das Bürgertum über die allgegenwärtigen Sexualängste und darin implizierte Angst vor Krankheit und Tod. Die Konservativen konnten sich froh wähnen, in den Schlägertruppen die vermeintlichen Beschützer der alten Weltordnung mit ihren vermeintlich gesunden und richtigen Werten gefunden zu haben.
Die Vorgänge um den Reigen können also nicht nur von literaturwissenschaftlicher Warte aus als ein eindrucksvolles und wichtiges Zeitdokument für die schlimme politische Entwicklung im 20. Jahrhundert angesehen werden
So möchte ich mich zunächst mit Schnitzler und seiner Zeit befassen, dem literarischen Wien und dem Phänomen des Kaffeehauses auf der einen Seite und der staatlichen Zensur andererseits. Die geschichtlich-politischen Umstände möchte ich an dieser Stelle noch nicht vertiefen, sie werden in den Kapiteln um Skandal und Prozesse ausführlich als Bedingung dieser behandelt und diskutiert werden.
Die eigentliche Skandalgeschichte möchte ich in zwei Kapitel aufteilen. Zum einen die langwierigen und zermürbenden Vorgänge um das Erscheinen des Buches und das Spielen auf dem Theater, denen ich die sehr unterschiedlichen Vorwürfe, die man dem Stück seitens der verschiedenen politischen Lager gemacht hat, voranstellen möchte.
Anschließend werde ich auf die beiden Prozesse aus dem Jahre 1921 eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Arthur Schnitzler und seine Zeit
- Der Autor
- Die Zensur
- Der Skandal um den Reigen
- Vorwürfe an den Reigen
- Der Reigen verlegt
- Der Reigen gespielt
- Die Reigen-Prozesse
- Der erste Prozess (3.-6. Januar 1921)
- Der zweite Prozess (5.-18. November 1921)
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem literarischen Skandal um Arthur Schnitzlers „Reigen“ und den darauf folgenden Prozessen. Im Zentrum steht nicht das Werk selbst, sondern die historischen Ereignisse und die gesellschaftlichen Reaktionen auf das Stück. Die Arbeit möchte aufzeigen, warum die Gesellschaft der Zeit so stark auf „Reigen“ reagierte, welche Vorwürfe erhoben wurden und ob diese gerechtfertigt waren.
- Die Zensur in Österreich um 1900
- Die gesellschaftlichen Reaktionen auf Schnitzlers „Reigen“
- Die politischen Hintergründe der Prozesse
- Die literarische Bedeutung von „Reigen“
- Zensur und Kunst in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Fokus der Arbeit. Kapitel 1 beleuchtet Arthur Schnitzler und seine Zeit, insbesondere die Wiener Gesellschaft und die Zensur. Kapitel 2 thematisiert den Skandal um „Reigen“, die erhobenen Vorwürfe und die Verlegung des Stückes. Kapitel 3 beschreibt die beiden Prozesse gegen Schnitzler im Jahr 1921. Die Zusammenfassung und der Ausblick fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und beleuchten den Umgang mit Zensur in der heutigen Zeit.
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Reigen, Zensur, Skandal, Prozesse, Wiener Gesellschaft, Literatur, Kunst, Politik, Geschichte, 20. Jahrhundert, Deutschland, Nachkriegszeit.
- Quote paper
- Michelle Grothe (Author), 2002, Arthur Schnitzlers 'Reigen' und die Zensur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8648