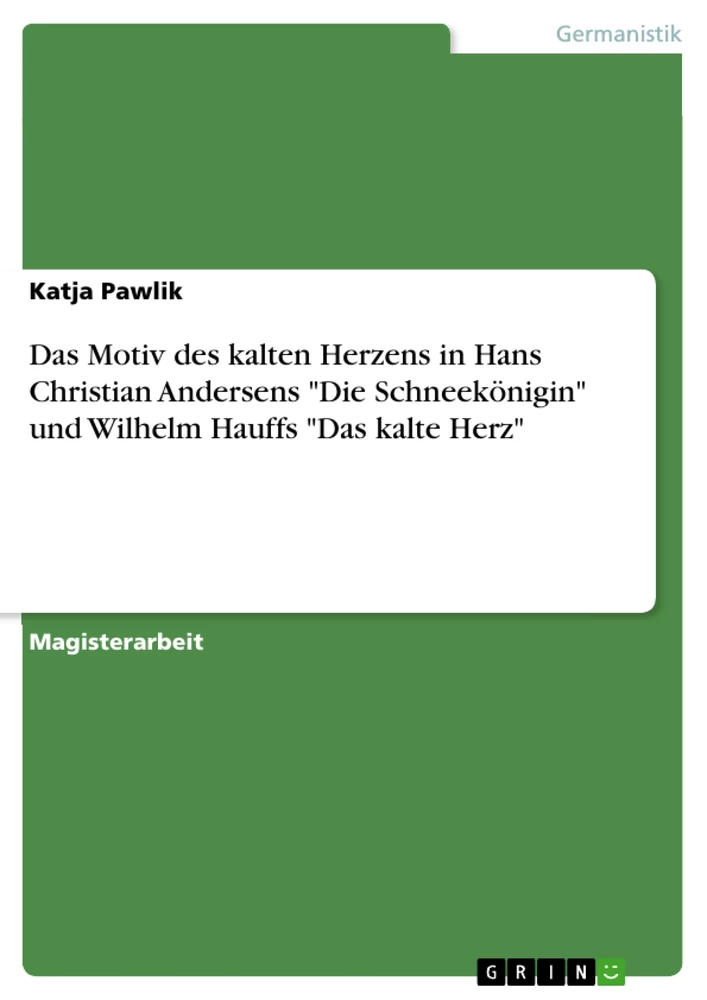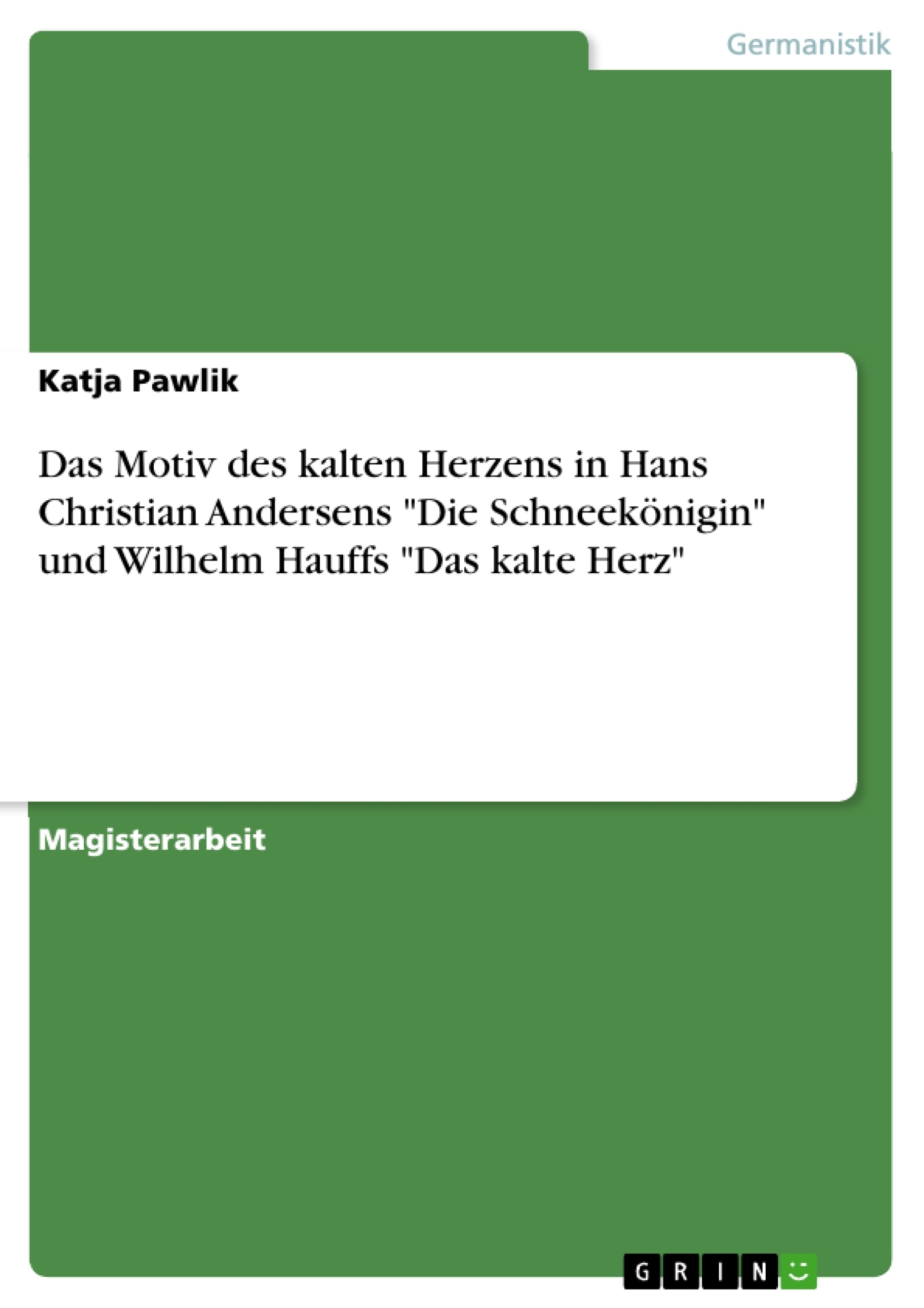In dieser Studie werden Hans Christian Andersens "Die Schneekönigin" und Wilhelm Hauffs "Das kalte Herz" anhand der Verwendung des Herzmotivs analysiert. Dabei geht die Autorin insbesondere der Frage nach, welche gesellschaftliche Wirklichkeit sich hinter der wunderbaren Welt der zwei Märchen verbirgt.
Mit Rekurs auf Jacques Lacan, Karl Marx, Max Weber und Werner Sombart weist sie dabei nach, wie im neunzehnten Jahrhundert angesichts massiver sozialer und wirtschaftlicher Umbrüche wenig märchenhafte Entwicklungen Einzug in die Erzählungen hielten. Der Verlust des warmen Herzens versinnbildlicht in den beiden Märchen ganz konkret die beginnende Modernisierung, Industrialisierung und Kapitalisierung der Lebensverhältnisse ebenso wie die eher diffuse Angst vor Identitätsverlust, der Zerstörung der Gemeinschaft und dem Fremden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegungen zu den Schnittstellen zwischen Wilhelm Hauff und Hans Christian Andersen
- Kunstmärchen
- Andersens Kunstmärchen
- Das Kunstmärchen als Gattung
- Exkurs: Andersens Erzählstil
- Hauffs Kunstmärchen
- Das Motiv des kalten Herzens
- Zum Motivverständnis
- Das Motiv des kalten Herzens in Andersens Die Schneekönigin
- Das (weibliche) Prinzip der Kälte
- Herz und Kopf - Die Verkehrung
- Zersplitterte Wahrnehmung – Der Spiegel
- Der Weg in die kalte Fremde
- Das Motiv des kalten Herzens in Hauffs Das kalte Herz
- Der kalte Kapitalismus
- Herz und Stein - Der Tausch
- Blendung und Verblendung - Der Geldfetisch
- Der Einbruch des Fremden - Der Einbruch der Fremdheit
- Schlussbetrachtung: Moderne Kälte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Analyse des Motivs des kalten Herzens in Hans Christian Andersens Die Schneekönigin (1844) und Wilhelm Hauffs Das kalte Herz (1828). Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Erzählungen aufzuzeigen, die trotz unterschiedlicher Ausgestaltung des Motivs einen gemeinsamen Kontext bilden. Der Verlust des warmen Herzens wird als ein Wandel des Subjekts, der Gesellschaft und der Ansichtsweisen interpretiert, der einen paradigmatischen Wandel widerspiegelt.
- Das Motiv des kalten Herzens als Metapher für einen inneren Wandel
- Die Rolle des Herzens in Andersens und Hauffs Erzählungen
- Die Auswirkungen des kalten Herzens auf die Figuren und ihre Wahrnehmung
- Der Bezug des Motivs zu gesellschaftlichen Veränderungen
- Die Bedeutung des Motivs im Kontext der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Im Anschluss folgt ein Abschnitt mit Vorüberlegungen zu den Schnittstellen zwischen Wilhelm Hauff und Hans Christian Andersen. Hier wird das Kunstmärchen als Gattung definiert und auf die spezifischen Merkmale der beiden Autoren eingegangen. Der Hauptteil beschäftigt sich mit dem Motiv des kalten Herzens. Hierbei werden die beiden Märchen unter verschiedenen Schwerpunkten untersucht, wie z.B. der Polarstruktur des Motivs, der negativen Entwicklung der männlichen Hauptfiguren, der veränderten Wahrnehmung der Helden und dem Komplex des Fremden. Die Schlussbetrachtung stellt die Ergebnisse der Analyse gegenüber und versucht, die Märchen in den Kontext der Modernekritik zu stellen.
Schlüsselwörter
Das kalte Herz, Kunstmärchen, Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff, Die Schneekönigin, Das kalte Herz, Motiv, Wandel, Moderne, Kritik, Herz, Kälte, Wahrnehmung, Gesellschaft, Fremde, Spiegel, Fetisch.
- Quote paper
- Katja Pawlik (Author), 2006, Das Motiv des kalten Herzens in Hans Christian Andersens "Die Schneekönigin" und Wilhelm Hauffs "Das kalte Herz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86475