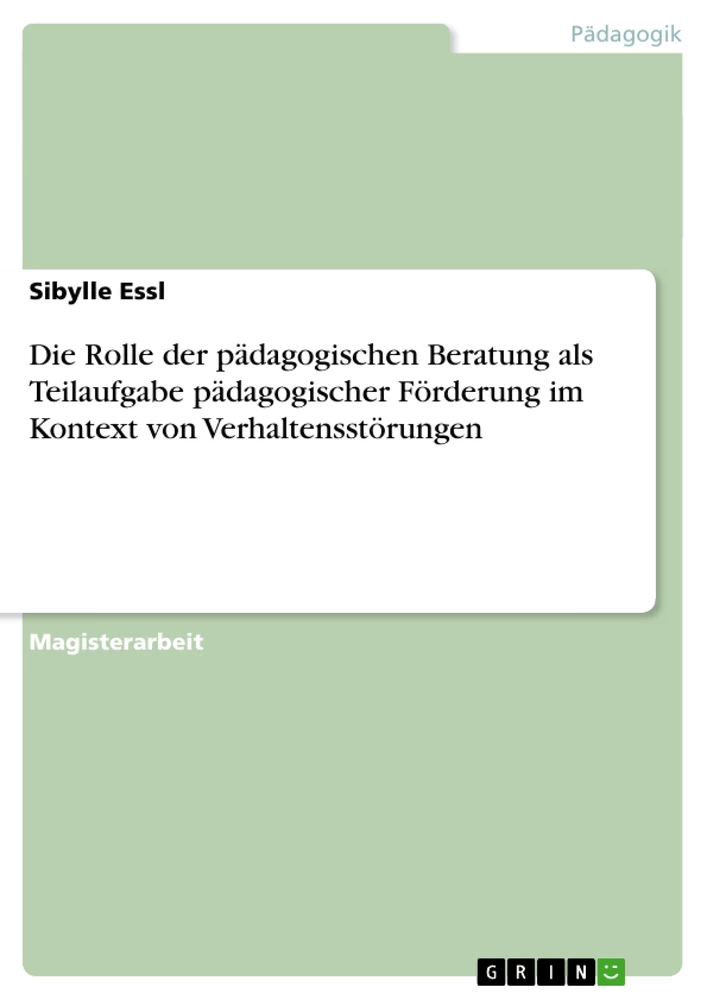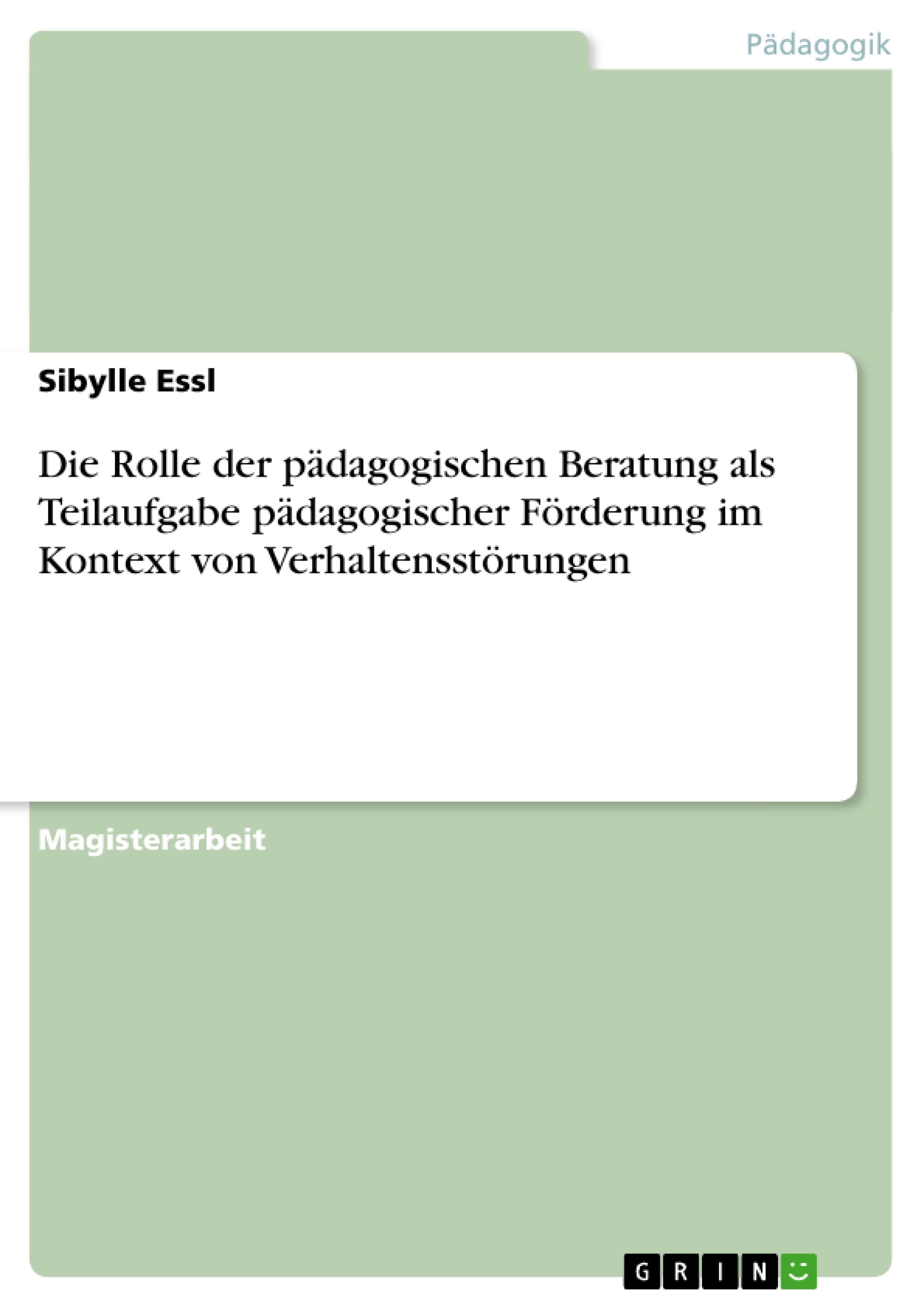Die Schule als Ort des Lernens und der Vorbereitung auf die Anforderungen des Lebens in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft mit sich ständig wandelnden Anforderungen nimmt im Leben von Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Platz ein. Sie verbringen einen Teil ihres Lebens an einem Ort, wo sie neben grundlegenden Kulturtechniken und Wissensinhalten auch Kompetenzen erlernen sollen, die eine befriedigende Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
Auf Grund eigener Berufserfahrungen als Hauptschullehrerin sowie der Aussagen von Berufskollegen kann festgestellt werden, dass die Vermittlung von Wissen und sozialen Kompetenzen unter immer schwierigeren Bedingungen stattfindet. Viele Lehrer haben den subjektiven Eindruck, dass Verhaltens- und Lernstörungen zunehmen und dadurch die Unterrichtstätigkeit erschwert wird.
Parallel dazu ist in meinem beruflichen Umfeld die Tendenz zu spüren, dass Pädagogen zunehmend aufgeschlossener werden, wenn es um das Annehmen von Unterstützung beim Umgang mit problematischen Kindern geht. Zum einen wächst die Bereitschaft zur Weiterbildung, zum anderen wird die Zusammenarbeit mit Sonder- bzw. Betreuungspädagogen als Chance und Hilfe für die integrative Betreuung von Kindern mit Verhaltens- und Lernstörungen geschätzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verhaltensstörungen: Begrifflichkeit - Definitionen - Abgrenzungen
- 2.1 Verhaltensstörung als Abweichung von pädagogisch definierten Regeln
- 2.2 Verhaltensstörung als „relativ überdauernde Disposition“
- 2.3,,Besondere erzieherische Hilfe“ als pädagogisch konstruktives Kriterium
- 3. Die Rolle der Heil- und Sonderpädagogik in der pädagogischen Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen
- 3.1 Der ökosystemische Ansatz in der Heil- und Sonderpädagogik
- 3.1.1 Paradigmenwechsel
- 3.1.2 Theoretische Grundlagen – ein Überblick
- 3.1.2.1 Ökologisch und systemisch – Anmerkungen zur Begrifflichkeit
- 3.1.2.2 Ökologische und systemische Theorieansätze in der Heil- und Sonderpädagogik - ausgewählte Aspekte
- 3.1.2.2.1 Der Mensch als autonomes System
- 3.1.2.2.2 Der Lebenswelt - Aspekt
- 3.1.3 Chancen und Grenzen des Ansatzes
- 3.2 Die Einflussnahme ökosystemischer Theorieansätze auf die Entwicklungsförderung von Kindern mit Verhaltensstörungen
- 3.2.1 „Spezielle Erziehungserfordernisse“ als heilpädagogischer Legitimationsbegriff
- 3.2.2 Heilpädagogische Konsequenzen für die Entwicklungsförderung
- 3.2.3 Sonderpädagogische Handlungsebenen
- 3.3 Die Rolle des Sonderpädagogen in der Entwicklungsförderung von Kindern mit Verhaltensstörungen - Verortung der Beratung
- 3.3.1 Veränderungen in Tätigkeitsbereichen und Berufsrolle
- 3.3.2 Neue Orientierungen in der Arbeit des Sonderpädagogen
- 3.3.2.1 Von Instruktionen zu Interventionen
- 3.3.2.2 Die Bedeutung der Kooperation
- 3.3.2.3 Vom Konzept der Nähe zum Konzept der Intensität
- 3.3.2.4 Mehrparteilichkeit als wichtige Orientierung
- 3.3.3 Beratung als neue Aufgabe
- 3.4 Organisationsformen schulischer Förderung bei Verhaltensstörungen – ein Überblick
- 4. Pädagogische Beratung als Teilaufgabe pädagogischer Förderung bei Verhaltensstörungen
- 4.1 Teilaufgaben pädagogischer Förderung – ein Überblick
- 4.2 Pädagogische Beratung bei Verhaltensstörungen – ausgewählte Aspekte
- 4.2.1 Zur Begründung der Beratung in der Pädagogik
- 4.2.1.1 Beratungsbedarf in der Schule
- 4.2.1.2 Verortung pädagogischer Beratung
- 4.2.2 Grundlagen pädagogischer Beratung
- 4.2.2.1 Pädagogische Beratung – Charakteristika und Abgrenzungsmerkmale
- 4.2.2.1.1 Beratung, Erziehung und Therapie
- 4.2.2.1.2 Was ist pädagogische Beratung?
- 4.2.2.2 Aufgabenfelder und Ziele pädagogischer Beratung
- 4.2.2.2.1 Aufgabenfelder
- 4.2.2.2.2 Ziele
- 4.2.2.3 Das Verhältnis von Beratung und Förderung
- 4.2.2.4 Gestaltungsformen der Beratung in der schulischen Erziehungshilfe
- 4.3 Kooperation und Kommunikation - Möglichkeiten der Realisierung im Rahmen pädagogischer Beratung
- 4.3.1 Pädagogische Beratung als horizontale Beratung
- 4.3.2 Beziehungsgestaltung
- 4.3.2.1 Allgemeine Anmerkungen zur Beratungsbeziehung
- 4.3.2.2 Verhältnisformen der Beratungsbeziehung im Kontext von Förderung
- 4.3.3 Kooperierende Interaktion am Beispiel des Modells der Kooperativen Beratung
- 4.3.3.1 Konzeptionen des Beratungsansatzes
- 4.3.3.1.1 Bezugsrahmen der Kooperativen Beratung
- 4.3.3.1.2 Determinanten der Interaktion im Beratungsprozess
- 4.3.3.2 Elemente der Kooperativen Beratung
- 4.3.3.3 Schritte des methodischen Vorgehens
- 4.4 Grenzen und Probleme pädagogischer Beratung
- 4.4.1 Kooperations- und Kommunikationsprobleme zwischen Schule und Eltern
- 4.4.2 Kommunikationsprobleme
- 4.4.3 Statusprobleme
- 4.4.4 Weitere Schwierigkeiten
- 5. Pädagogische Beratung im Praxisfeld Schule
- 5.1 Das Betreuungslehrermodell in der Regelschule
- 5.2 Pädagogische Beratung im Rahmen des Betreuungslehrermodells – Erfahrungen aus der Praxis
- 5.2.1 Kooperation und Beziehungsgestaltung
- 5.2.2 Persönliche Reflexion
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit setzt sich zum Ziel, die Rolle der pädagogischen Beratung als Teilaufgabe pädagogischer Förderung im Kontext von Verhaltensstörungen zu beleuchten. Dabei liegt der Fokus auf der Verortung und Bedeutung der Beratung im Rahmen der Heil- und Sonderpädagogik.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Verhaltensstörungen“
- Der ökosystemische Ansatz in der Heil- und Sonderpädagogik und seine Auswirkungen auf die Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen
- Die Rolle des Sonderpädagogen in der Entwicklungsförderung von Kindern mit Verhaltensstörungen, insbesondere im Hinblick auf Beratung
- Pädagogische Beratung als Teilaufgabe pädagogischer Förderung bei Verhaltensstörungen: Grundlagen, Aufgabenfelder, Ziele und Gestaltungsformen
- Kooperation und Kommunikation in der pädagogischen Beratung, insbesondere im Kontext des Modells der Kooperativen Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage präsentiert. Kapitel 2 widmet sich der Begrifflichkeit, Definition und Abgrenzung des Begriffs „Verhaltensstörungen“. Kapitel 3 beleuchtet die Rolle der Heil- und Sonderpädagogik in der Förderung von Kindern mit Verhaltensstörungen, wobei der ökosystemische Ansatz und die Rolle des Sonderpädagogen im Fokus stehen. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der pädagogischen Beratung als Teilaufgabe pädagogischer Förderung bei Verhaltensstörungen. Hier werden Grundlagen, Aufgabenfelder, Ziele und Gestaltungsformen der Beratung erörtert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Kooperation und Kommunikation gelegt wird. Kapitel 5 beleuchtet die praktische Umsetzung der pädagogischen Beratung im Schulkontext, insbesondere im Rahmen des Betreuungslehrermodells.
Schlüsselwörter
Pädagogische Beratung, Verhaltensstörungen, Heil- und Sonderpädagogik, ökosystemischer Ansatz, Entwicklungsförderung, Kooperation, Kommunikation, Betreuungslehrermodell.
- Quote paper
- Mag.art. Sibylle Essl (Author), 2006, Die Rolle der pädagogischen Beratung als Teilaufgabe pädagogischer Förderung im Kontext von Verhaltensstörungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86421