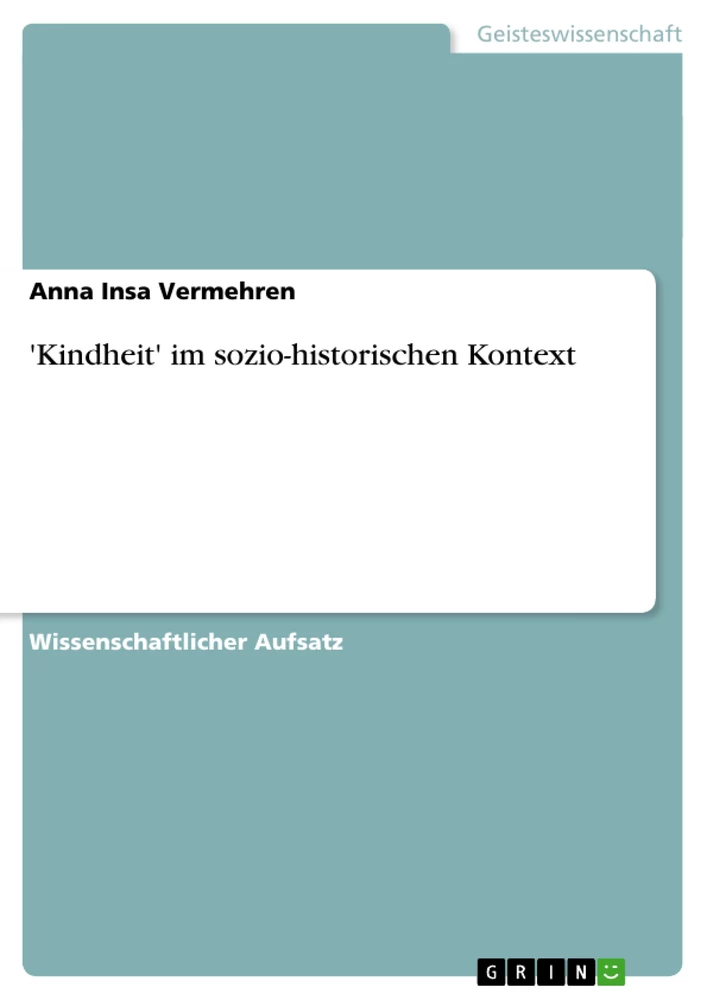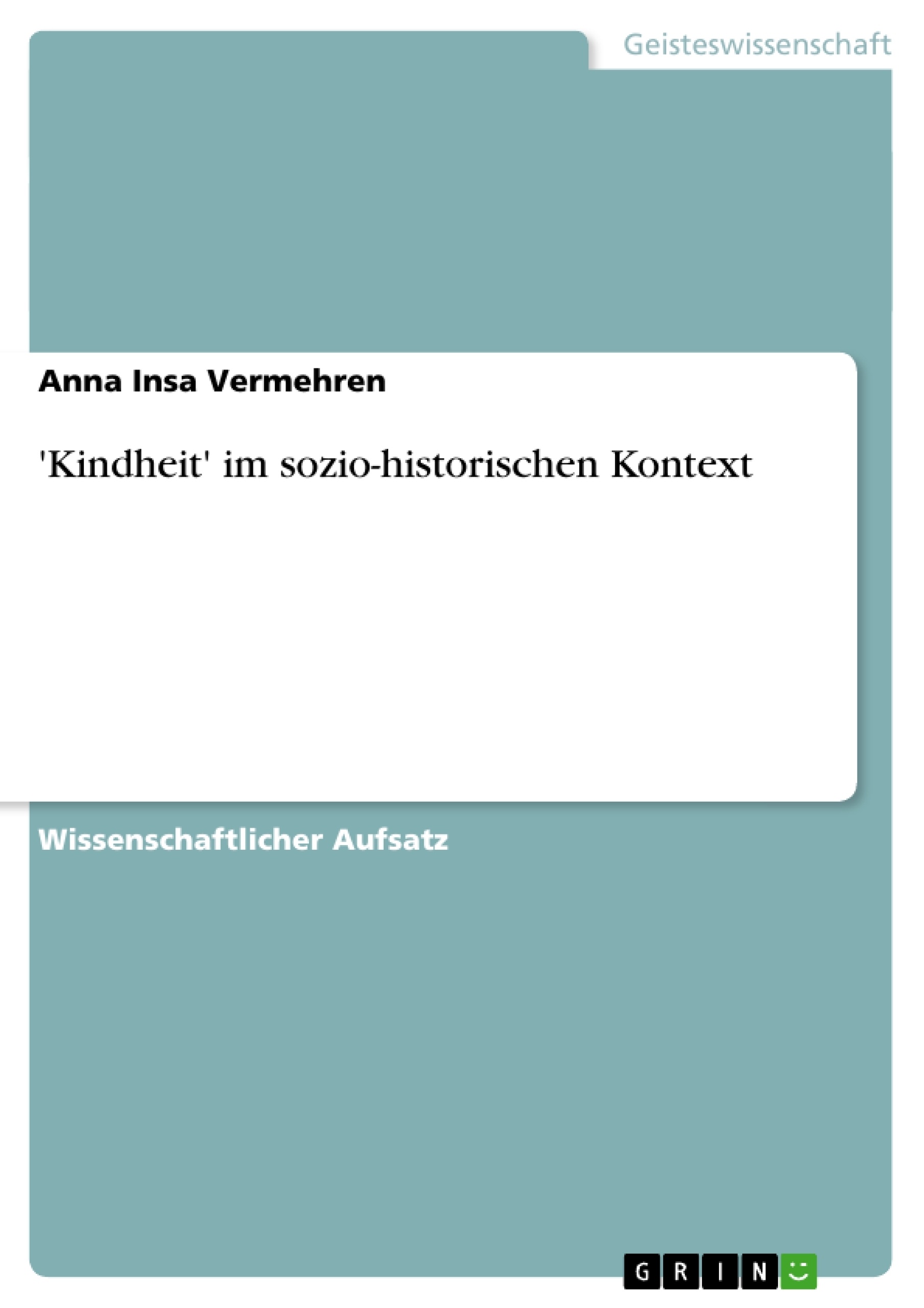Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema 'Kindheit' als ein Konstrukt. Vorerst wird die Geschichte der Kindheit vom Mittelalter bis in die Postmoderne verfolgt um im Weiteren Schlussfolgerungen über die Auswirkungen der Kindheitskonzeptionen für die heutige Gesellschaft zu ziehen. Prognostische Überlegungen runden die Überlegungen über Kindheit ab.
‚Kindheit’ verstanden als soziales Konstrukt und kulturelles Gesellschaftsideal – vielleicht auch als Gesellschaftsillusion – das im systemischen Zusammenhang mit unserer Gesellschaft steht, stellt schon an sich eine Kategorisierung dar. Kindheit ist somit ein Abstraktum, das komplexe Strukturen und Zusammenhänge umfasst, die auf gesellschaftlicher, wie auch individueller Ebene konstruiert sind. Das Problem dieses Ansatzes ist, dass sich durch den Konstruktcharakter unendliche Betrachtungsweisen eröffnen, die weder in ihrer Komplexität noch in ihrer Reichweite erfassbar sind. Grundlegend wird angenommen, dass Menschen sich ihr Verständnis von Innen- und Außenwelt subjektiv „in einem aktiven Konstruktionsprozess“ (Grundmann 1999: 54) aufbauen. „Dabei besteht ein interaktives Wechselverhältnis zwischen den handelnden Subjekten und der gegebenen Außenwelt.“ (ebd.) Das heißt, Individuen kreieren sich ihre eigenen, möglichst schlüssigen Wirklichkeiten durch vergleichende Interaktion und Erfahrung. Diese Wirklichkeiten stellen Teile einer gesellschaftlich angenommenen Realität dar, die die Grundlage von Kommunikation sind. Interaktion ist als komplexe Struktur aus wechselseitigen Kommunikationen und Handlungen zu begreifen, die nicht nur inter-individuell sondern auch zwischen den Individuen und gesellschaftlichen Institutionen stattfindet.
Während lange Zeit angenommen wurde, dass dem menschlichen Wesen die ‚Natur’ zugrunde liegt (Naturalismus), die nur durch Sozialisation und Erziehung sowie durch Umweltbedingungen verdeckt wird, nimmt man heute in den Sozialwissenschaften vermehrt an, dass das Ideal der Natürlichkeit eine Konstruktion ist, um eine Legitimation bereitzustellen, der man die Verantwortung für das menschliche Handeln übertragen kann. „Je mehr wir Gesetze von der Natur ablauschen wollten, um so mehr mussten wir erkennen, dass wir bloß eigene Gesetze erfinden.“ (Reich 2003: 3) Kersten Reich nimmt an, dass der Mensch allein schon wegen seiner Sprache von konstruierender ‚Natur’ ist (ebd: 4). Diese Annahme beruht auf Ferdinand de Saussures Definition von Sprache als geschlossenes, abstraktes System von Zeichen, das Vorstellungen und Lautbilder miteinander verbindet. Es wird erst durch den interaktiven Austausch gefestigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kindheit vom Mittelalter zur Postmoderne
- 2.1 Kindheit im Mittelalter
- 2.2 Kindheit im Licht der Aufklärung
- 2.3 Das 19. Jahrhundert: Das Ideal der bürgerlichen Familie
- 2.4 Die Zeit der Weltkriege und Nachkriegszeit
- 2.5 Postmoderne: Kindheit heute
- 3. Konzeptionen von Kindheit: Reichweite und Wirksamkeit heute
- 3.1 Kind und Gesellschaft
- 3.1.1 Sozialisation: Persönlichkeitsbildung und Identität
- 3.1.2 Familienstrukturen
- 3.2 Institutionalisierung von Kindheit
- 3.2.1 Pädagogisierung und Expertisierung
- 3.2.2 Kritische Erwägungen
- 3.3 Gesellschaft und Kind
- 3.3.1 Gesellschaftlicher Wandel
- 3.3.2 Die Rolle der Medien
- 3.3.3 Konsum und Massenkultur
- 4. Entwicklungen von Kindheitskonzeptionen
- 4.1 Wissenschaftliche Kontroversen
- 4.2 Prognose
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel des Verständnisses von Kindheit im Laufe der Geschichte, von Mittelalter bis zur Postmoderne. Sie analysiert die verschiedenen Konzeptionen von Kindheit in ihren jeweiligen sozio-historischen Kontexten und beleuchtet die Einflüsse von Gesellschaft, Familie und Institutionen auf die Entwicklung des Kindes. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der komplexen und vielschichtigen Bedeutung von „Kindheit“ zu zeichnen.
- Der historische Wandel des Kindheitsverständnisses
- Der Einfluss gesellschaftlicher Strukturen auf die Kindheit
- Die Rolle von Familie und Institutionen in der Sozialisation
- Konzeptionen von Kindheit als soziale Konstrukte
- Wissenschaftliche Debatten um das Verständnis von Kindheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und verdeutlicht die Komplexität des Begriffs „Kindheit“ anhand persönlicher Erfahrungen und der unterschiedlichen Wahrnehmung von Kindheit in verschiedenen historischen Epochen und kulturellen Kontexten. Sie betont den konstruktivistischen Ansatz der Arbeit und die Bedeutung der historischen Betrachtungsweise für das Verständnis gegenwärtiger Sichtweisen auf Kindheit.
2. Kindheit vom Mittelalter zur Postmoderne: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Kindheitsverständnisses von Mittelalter bis zur Postmoderne. Es setzt sich kritisch mit den Thesen von Philippe Ariès auseinander und diskutiert die methodischen Herausforderungen der sozial-historischen Kindheitsforschung, insbesondere die Problematik von Quellenlage und der Mehrdimensionalität der Kindheitsgeschichte. Es wird der Vorschlag unterbreitet, die Wechselbeziehungen zwischen Kindheit, Familie, Markt und Staat zu berücksichtigen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wandel des Kindheitsverständnisses
Was ist der Inhalt des Buches "Wandel des Kindheitsverständnisses"?
Das Buch untersucht den Wandel des Verständnisses von Kindheit von Mittelalter bis zur Postmoderne. Es analysiert verschiedene Konzeptionen von Kindheit in ihren sozio-historischen Kontexten und beleuchtet Einflüsse von Gesellschaft, Familie und Institutionen auf die Kindesentwicklung. Der Fokus liegt auf einem umfassenden Bild der Bedeutung von „Kindheit“.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt den historischen Wandel des Kindheitsverständnisses, den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen, die Rolle von Familie und Institutionen in der Sozialisation, Konzeptionen von Kindheit als soziale Konstrukte und wissenschaftliche Debatten um das Verständnis von Kindheit.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Kindheit vom Mittelalter zur Postmoderne (inkl. Unterkapitel zu Kindheit im Mittelalter, Aufklärung, 19. Jahrhundert, Weltkriegen/Nachkriegszeit und Postmoderne), 3. Konzeptionen von Kindheit: Reichweite und Wirksamkeit heute (inkl. Unterkapiteln zu Kind und Gesellschaft, Institutionalisierung von Kindheit und Gesellschaft und Kind), 4. Entwicklungen von Kindheitskonzeptionen (inkl. wissenschaftlichen Kontroversen und Prognose) und 5. Schlussbemerkung.
Wie wird der historische Wandel des Kindheitsverständnisses dargestellt?
Kapitel 2 beleuchtet den Wandel des Kindheitsverständnisses von Mittelalter bis zur Postmoderne. Es setzt sich kritisch mit den Thesen von Philippe Ariès auseinander und diskutiert methodische Herausforderungen der sozial-historischen Kindheitsforschung (Quellenlage, Mehrdimensionalität). Es wird vorgeschlagen, die Wechselbeziehungen zwischen Kindheit, Familie, Markt und Staat zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielen Gesellschaft, Familie und Institutionen?
Das Buch analysiert den Einfluss gesellschaftlicher Strukturen, Familienstrukturen und Institutionen (z.B. Pädagogisierung) auf die Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Es untersucht, wie diese Faktoren das Verständnis und die Erfahrung von Kindheit prägen.
Welche wissenschaftlichen Kontroversen werden angesprochen?
Kapitel 4 widmet sich wissenschaftlichen Kontroversen rund um das Verständnis von Kindheit und bietet eine Prognose zukünftiger Entwicklungen.
Welche Zielsetzung verfolgt das Buch?
Ziel des Buches ist es, ein umfassendes Bild der komplexen und vielschichtigen Bedeutung von „Kindheit“ zu zeichnen und den Wandel des Verständnisses von Kindheit im Laufe der Geschichte zu analysieren.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Das Buch verwendet einen konstruktivistischen Ansatz und betont die Bedeutung der historischen Betrachtungsweise für das Verständnis gegenwärtiger Sichtweisen auf Kindheit. Es thematisiert die Herausforderungen der sozial-historischen Kindheitsforschung, insbesondere die Problematik der Quellenlage und der Mehrdimensionalität der Kindheitsgeschichte.
- Citar trabajo
- Anna Insa Vermehren (Autor), 2006, 'Kindheit' im sozio-historischen Kontext, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86377