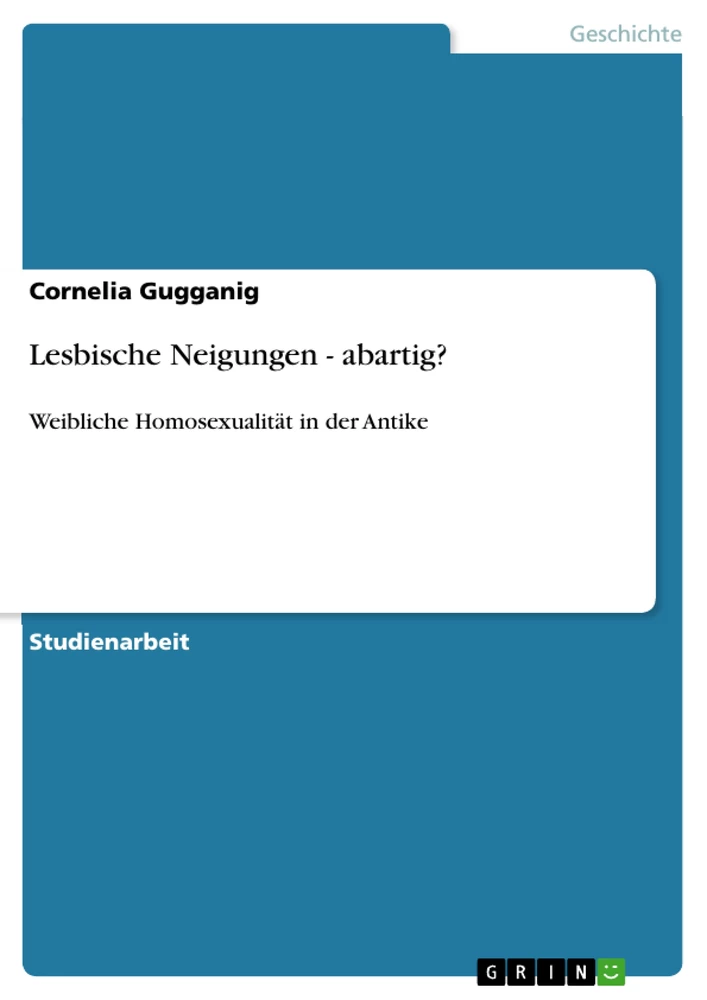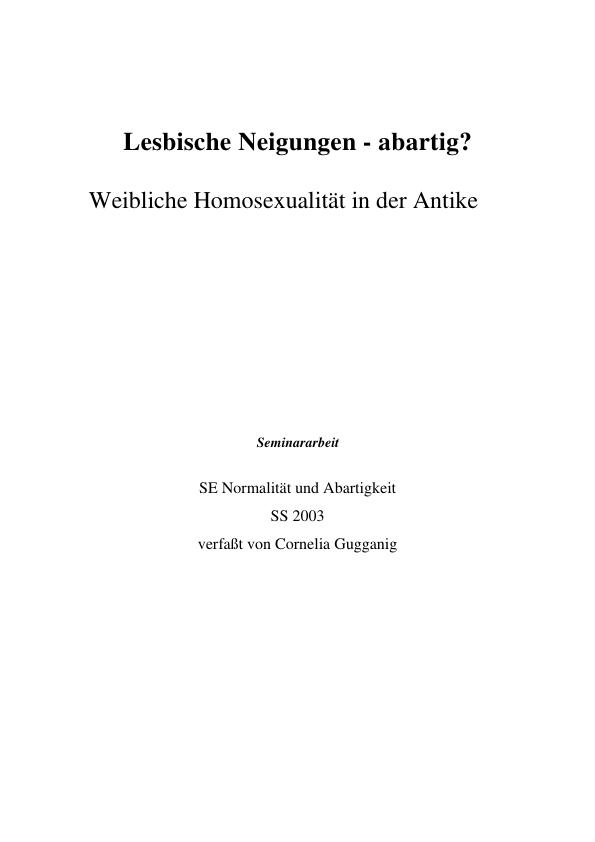In dieser Arbeit werde ich der Frage nachgehen, ob und in welchen Formen die Existenz weiblicher Homosexualität für die Antike überliefert ist. Dem Titel entsprechend möchte ich auch den Umgang der Gesellschaft mit diesem Phänomen beleuchten. Ich werde dabei – nach einer ersten Annäherung an das Thema - chronologisch vorgehen, da nicht anzunehmen ist, daß ein so komplexes Thema für die ganze Antike gleich zu behandeln ist.
Das erste Kapitel ist der Versuch einer Begriffsbestimmung. Was ist weibliche Homosexualität/ lesbische Liebe, woher stammen diese Termini, gab es sie in der Antike und - wenn ja - in welcher Form?
Im zweiten Kapitel wende ich mich der griechischen Archaik zu. Hier sind es zwei Themen, die uns – möglicherweise – einen Blick auf Homosexualität unter Frauen erlauben: Zum einen natürlich Sappho, eine der wenigen weiblichen Stimmen zum Thema, zum zweiten die Chorlyrik mit Alkman als interessantestem Vertreter.
Die Klassik und den Hellenismus werde ich nicht gesondert behandeln, genausowenig wie die griechischsprachige Welt in römischer Zeit, da mir scheint, daß sich hier die Ansichten der männlichen Autoren zum Thema nicht sehr voneinander unterscheiden und für mein Gebiet eine scharfe Trennung nicht zwingend notwendig ist.
Anders verhält es sich mit Rom, um das es im vierten Abschnitt geht. Auch hier haben wir keine Quelle aus der Feder einer Betroffenen, wieder nur viele Meinungen und auch Schmähungen von Männern. Interessant ist es hier vielleicht, nach dem Grund für solche Schmähungen zu fragen, und auch das möchte ich in diesem Kapitel tun.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Terminologie und Begriffseingrenzungen
- Homosexualität? Lesbische Liebe?
- Liebe zwischen Frauen aus der Sicht der Männer
- Was machen zwei Frauen eigentlich miteinander?
- Weibliche Homosexualität im 19./20. Jahrhundert
- „Moderne“ Ansichten
- Archaik
- Sappho
- Die Zeugnisse
- Die Rezeption in Antike und Neuzeit
- Chorlyrik
- Alkmans Partheneia
- Weiblicher Chor – männlicher Dichter
- Homosexualität als Erziehungsform in der Archaik?
- Sappho
- Griechische Klassik, Hellenismus und die griechischsprachige Welt bis in römische Zeit
- Zwischen Desinteresse und offener Feindseligkeit
- Die Klassik - Platon
- Hellenismus und Folgezeit
- Zauberei
- Rom
- Weibliche Homosexualität im Spiegel der römischen Literatur
- Religiöse Feste als Teil einer weiblichen „Gegenkultur“?
- Julia Balbilla – Eine weibliche Stimme zum Thema?
- „Mannweiber“ als Bedrohung – Die römische Sicht der Dinge
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Darstellung weiblicher Homosexualität in der Antike. Ziel ist es, die vorhandenen Quellen auszuwerten und den gesellschaftlichen Umgang mit diesem Phänomen zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt die unterschiedlichen Epochen und kulturellen Kontexte, um ein differenziertes Bild zu zeichnen.
- Begriffsbestimmung von weiblicher Homosexualität in der Antike und die Problematik der modernen Terminologie.
- Darstellung weiblicher Homosexualität in der griechischen Archaik (Sappho, Chorlyrik).
- Analyse der Perspektiven männlicher Autoren in der griechischen Klassik, im Hellenismus und der römischen Zeit.
- Untersuchung der römischen Sicht auf weibliche Homosexualität und mögliche Gründe für negative Darstellungen.
- Die Frage nach der Existenz einer weiblichen „Gegenkultur“ im Kontext religiöser Feste.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungsfrage nach der Existenz und Darstellung weiblicher Homosexualität in der Antike und kündigt den chronologischen Aufbau der Arbeit an, der von einer begrifflichen Klärung ausgeht.
Terminologie und Begriffseingrenzungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Problematik der Anwendung moderner Begriffe wie „Homosexualität“ und „lesbische Liebe“ auf die Antike. Es untersucht die historischen Entwicklungen dieser Begriffe und stellt alternative antike Bezeichnungen vor, wie z.B. τp₁ßαç (frictrix). Die Schwierigkeiten, das antike Verständnis von Sexualität mit dem modernen zu vergleichen, werden hervorgehoben, ebenso wie die limitierte Perspektive männlicher Autoren.
Archaik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse von Sapphos Werk und der Chorlyrik, insbesondere Alkmans Partheneia, als mögliche Quellen für Einblicke in die weibliche Homosexualität der griechischen Archaik. Es wird die Frage gestellt, ob weibliche Homosexualität als Erziehungsform interpretiert werden kann. Die eingeschränkten Quellen und deren Interpretationen werden kritisch reflektiert.
Griechische Klassik, Hellenismus und die griechischsprachige Welt bis in römische Zeit: Dieses Kapitel analysiert die Sichtweise männlicher Autoren auf weibliche Homosexualität in der griechischen Klassik und im Hellenismus. Es wird gezeigt, dass sich die Ansichten der männlichen Autoren in dieser Epoche nicht stark voneinander unterscheiden und ein differenziertes Bild schwer zu zeichnen ist. Die Rolle der Zauberei im Kontext weiblicher Sexualität wird kurz gestreift.
Rom: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung weiblicher Homosexualität in der römischen Literatur. Es untersucht die kritischen und negativ konnotierten Beschreibungen durch männliche Autoren und sucht nach den Ursachen dieser negativen Darstellung. Die Bedeutung religiöser Feste und die Frage einer möglichen weiblichen „Gegenkultur“ werden erörtert, ebenso wie das Beispiel von Julia Balbilla. Das Konzept der „Mannweiber“ als Bedrohung wird im Kontext der römischen Sichtweise beleuchtet.
Schlüsselwörter
Weibliche Homosexualität, Antike, Sappho, Chorlyrik, Alkmans Partheneia, Griechische Klassik, Hellenismus, Rom, τp₁ßαç (frictrix), Lesbische Liebe, Homosexualität, Männliche Perspektive, Quellenkritik, „Gegenkultur“, Julia Balbilla.
Häufig gestellte Fragen zu: Weibliche Homosexualität in der Antike
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Darstellung weiblicher Homosexualität in der Antike. Sie analysiert vorhandene Quellen und beleuchtet den gesellschaftlichen Umgang mit diesem Phänomen in verschiedenen Epochen und kulturellen Kontexten.
Welche Epochen und Kulturen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die griechische Archaik, die griechische Klassik, den Hellenismus, sowie die römische Zeit. Der Fokus liegt auf den jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Perspektiven auf weibliche Homosexualität.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Auswertung antiker Quellen, darunter die Werke Sapphos, die Chorlyrik (z.B. Alkmans Partheneia) und Texte männlicher Autoren aus den verschiedenen Epochen. Die Limitationen und Interpretationsmöglichkeiten dieser Quellen werden kritisch reflektiert.
Welche Problematik wird in Bezug auf die Terminologie angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeit, moderne Begriffe wie „Homosexualität“ und „lesbische Liebe“ auf die Antike anzuwenden. Sie untersucht die historische Entwicklung dieser Begriffe und präsentiert alternative antike Bezeichnungen, um ein differenziertes Bild zu zeichnen und die Grenzen des Vergleichs zwischen antikem und modernem Verständnis von Sexualität aufzuzeigen.
Wie wird die Perspektive männlicher Autoren berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die Perspektiven männlicher Autoren in den verschiedenen Epochen und zeigt, wie deren Sichtweisen das Bild weiblicher Homosexualität prägen. Der limitierte Zugang zu weiblichen Stimmen wird thematisiert.
Welche Rolle spielt die griechische Archaik (Sappho, Chorlyrik)?
Die Archaik wird untersucht anhand von Sapphos Werk und der Chorlyrik, insbesondere Alkmans Partheneia. Es wird die Frage nach möglichen Einblicken in die weibliche Homosexualität dieser Zeit gestellt und die Interpretation dieser Quellen kritisch diskutiert, inklusive der Hypothese einer weiblichen Homosexualität als Erziehungsform.
Wie wird die griechische Klassik, der Hellenismus und die römische Zeit behandelt?
Diese Epochen werden hinsichtlich der Darstellung weiblicher Homosexualität durch männliche Autoren analysiert. Die Arbeit zeigt auf, dass sich die Ansichten der männlichen Autoren in diesen Epochen oft ähneln, ein differenziertes Bild aber schwer zu zeichnen ist. Die Rolle von Zauberei im Kontext weiblicher Sexualität wird ebenfalls kurz betrachtet.
Welche Rolle spielt Rom in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Darstellung weiblicher Homosexualität in der römischen Literatur, insbesondere die kritischen und negativ konnotierten Beschreibungen durch männliche Autoren. Sie sucht nach den Ursachen für diese negativen Darstellungen, erörtert die Bedeutung religiöser Feste und die Frage einer möglichen weiblichen „Gegenkultur“, sowie das Beispiel von Julia Balbilla. Das Konzept der „Mannweiber“ als Bedrohung im römischen Kontext wird beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weibliche Homosexualität, Antike, Sappho, Chorlyrik, Alkmans Partheneia, Griechische Klassik, Hellenismus, Rom, τp₁ßαç (frictrix), Lesbische Liebe, Homosexualität, Männliche Perspektive, Quellenkritik, „Gegenkultur“, Julia Balbilla.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut und beginnt mit einer begrifflichen Klärung. Sie umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den verschiedenen Epochen, eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis ist ebenfalls enthalten.
- Quote paper
- mag.a Cornelia Gugganig (Author), 2003, Lesbische Neigungen - abartig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86332