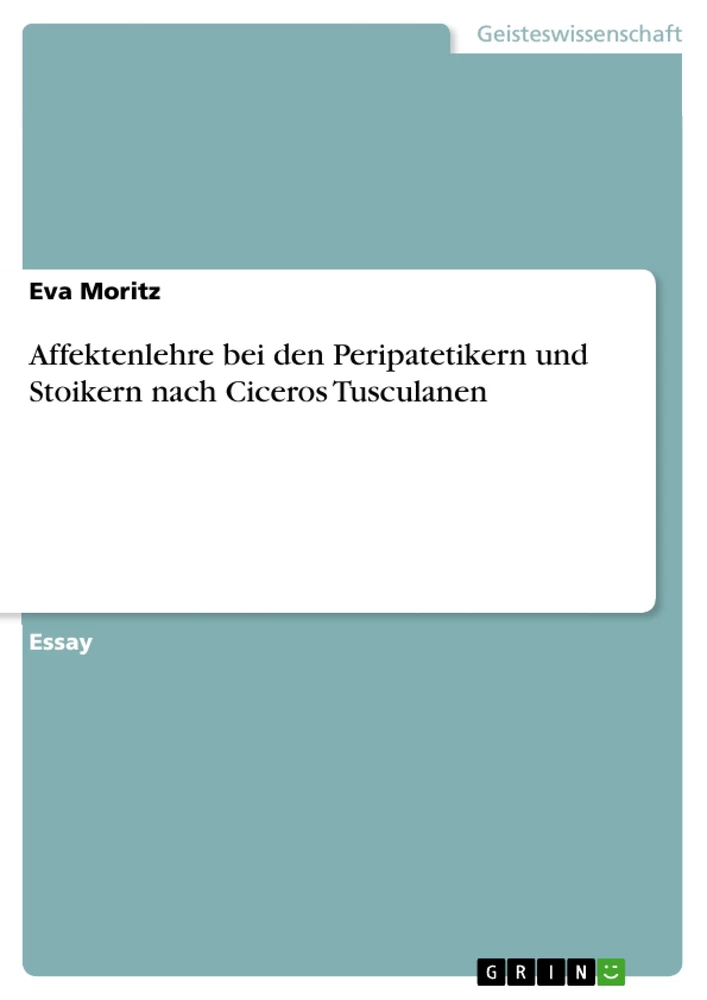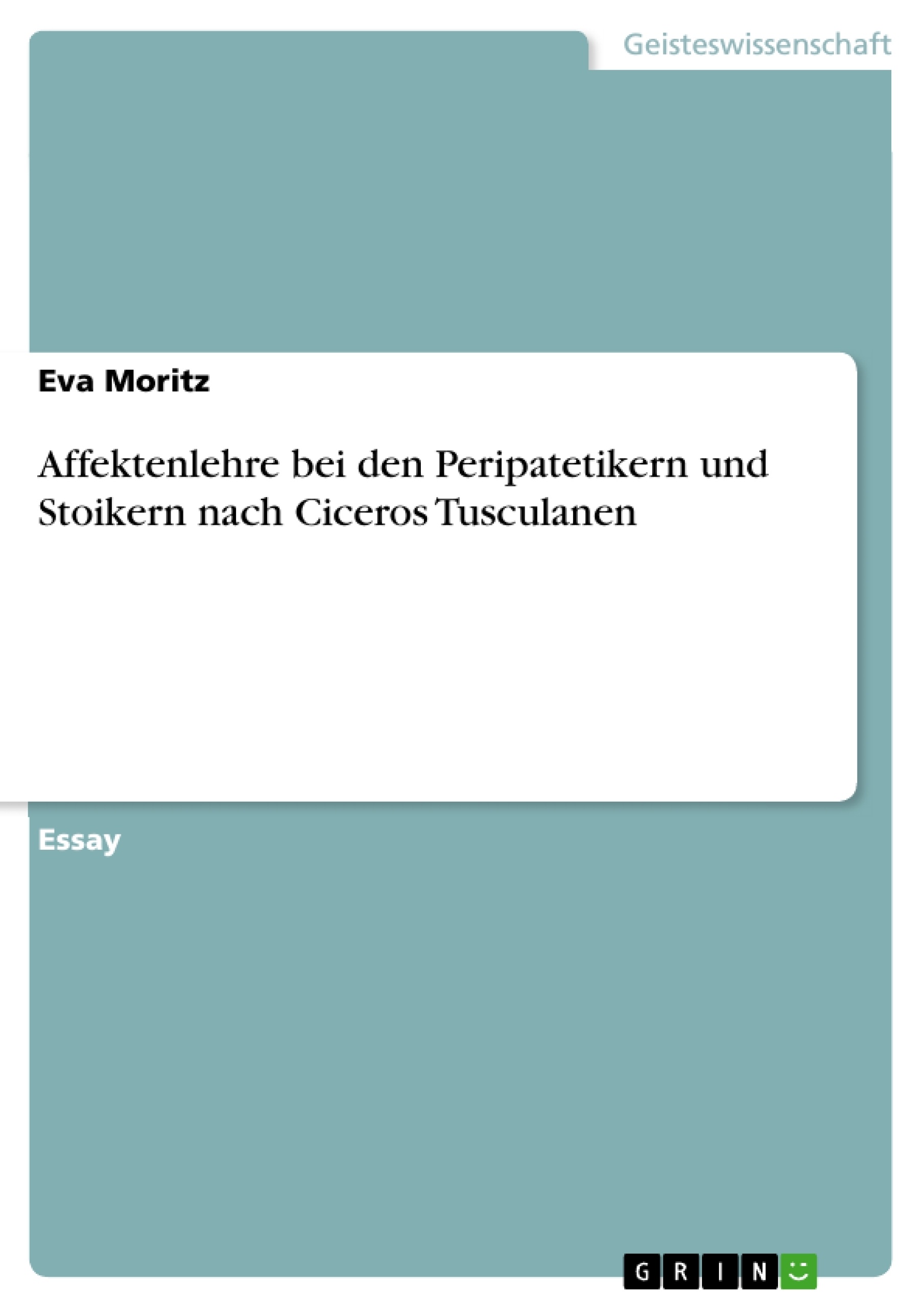In der Antike bestimmten vier Schulen die Philosophie: Die stoische, epikureische, platonische und peripatetische Lehre. Etwa 300 Jahre später spiegelt Cicero in seinem Werk … die Auseinandersetzungen dieser Anschauungen wieder. So erkennt man in den „Tusculanae Disputationes“ die Differenzen zwischen Peripatetikern und Stoikern . Als Eklektiker wählt Cicero allerdings aus mehreren philosophischen Systemen das für ihn Stimmigste aus und setzt diese Selektion zu einem neuen Lehrgebäude zusammen. Aus diesem Grund muss man vorsichtig mit den Thesen umgehen, die er den einzelnen Schulen in den Mund legt .
In diesem Essay soll auf Grundlage der Tusculanen der peripatetische Umgang mit den Affekten und als Gegenstück dessen die Sichtweise der Stoiker, denen sich Cicero hier anschließt, dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Affektenlehre bei den Peripatetikern und Stoikern nach Ciceros Tusculanen
- Die Peripatetiker behaupten, dass die Leidenschaften natürlich sind und angenommen werden sollen, jedoch muss ein gewisses Maß eingehalten werden.
- Cicero setzt der Ansicht der Peripatetiker entgegen, dass man im Fehler kein Maß suchen kann.
- Die Weisheit, so argumentiert Cicero, ist folgendermaßen zu definieren.
- Die Peripatetiker halten die Affekte jedoch nicht nur für natürlich, sondern sogar für nützlich.
- Zuerst wendet er sich dem Zorn zu.
- Als nächstes erwähnt Cicero das Begehren und Verlangen aus Sicht der Peripatetiker.
- Der Kummer dient als Erziehungsmittel.
- Das Mitleid, als ein weiterer Aspekt des Kummers, dient der gegenseitigen Hilfe und der Unterstützung der Armen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die peripatetische und stoische Affektenlehre anhand von Ciceros „Tusculanae Disputationes“. Ziel ist es, die unterschiedlichen Ansichten beider Schulen zu den Emotionen darzustellen und die Argumentationslinie Ciceros, der sich hier der stoischen Position anschließt, zu beleuchten.
- Der natürliche Charakter der Leidenschaften und die Notwendigkeit von Mäßigung (Peripatetiker)
- Die Kritik Ciceros an der Idee eines „Maßes“ in Bezug auf Affekte
- Die stoische Definition von Weisheit und die Erreichung von Seelenruhe durch Leidenschaftslosigkeit (apatheia)
- Die Rolle von Emotionen wie Zorn, Begehren und Kummer in der peripatetischen Ethik
- Ciceros Kritik an der peripatetischen Sichtweise auf die Nutzbarkeit von Affekten
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit der Vorstellung der peripatetischen Sichtweise auf Affekte, die diese als natürlich, jedoch in einem angemessenen Maß zu bewältigen, betrachtet. Cicero argumentiert dagegen, dass es im Fehler kein Maß gibt und Affekte, die über ein gewisses Limit hinauswachsen, unweigerlich schädlich werden.
Im weiteren Verlauf des Essays stellt Cicero die stoische Definition von Weisheit dar, die auf der Erkennung der göttlichen und menschlichen Dinge basiert und die Leidenschaftslosigkeit (apatheia) als Voraussetzung für Seelenruhe und Glückseligkeit sieht.
Der Essay widmet sich dann der peripatetischen Sicht auf den Nutzen von Affekten wie Zorn, Begehren und Kummer. Cicero kritisiert diese Position mit Beispielen und Argumenten und verteidigt die stoische Vorstellung, dass Leidenschaften der Vernunft untergeordnet werden sollten.
Schlüsselwörter
Affektenlehre, Peripatetiker, Stoiker, Cicero, Tusculanae Disputationes, Leidenschaften, Mäßigung, Weisheit, Seelenruhe, apatheia, Zorn, Begehren, Kummer, Mitleid.
- Quote paper
- Eva Moritz (Author), 2007, Affektenlehre bei den Peripatetikern und Stoikern nach Ciceros Tusculanen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86232