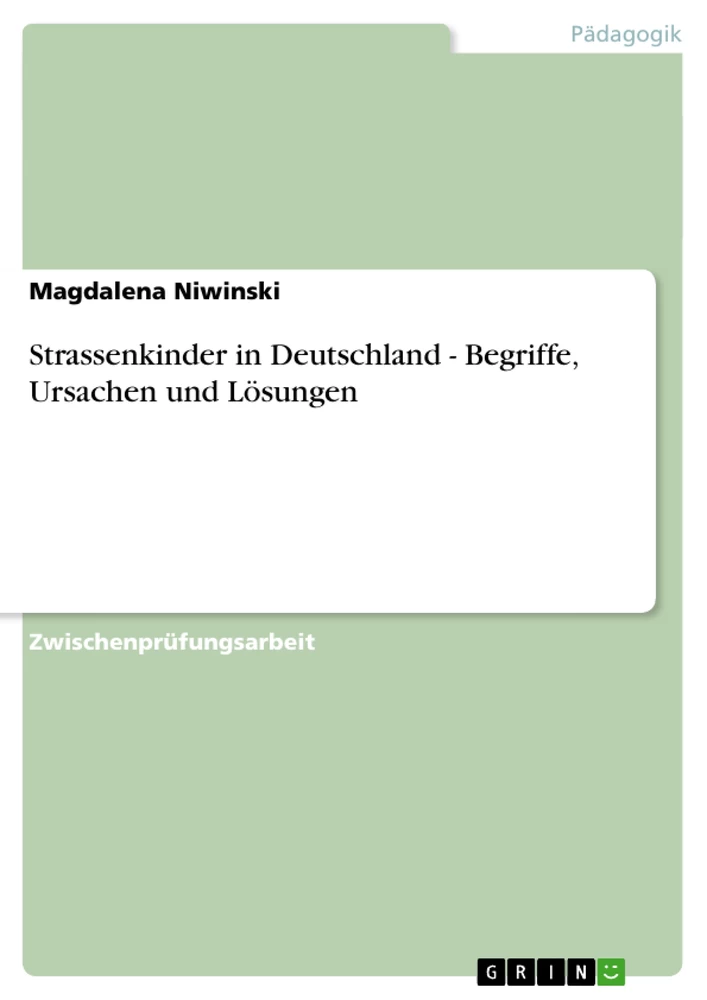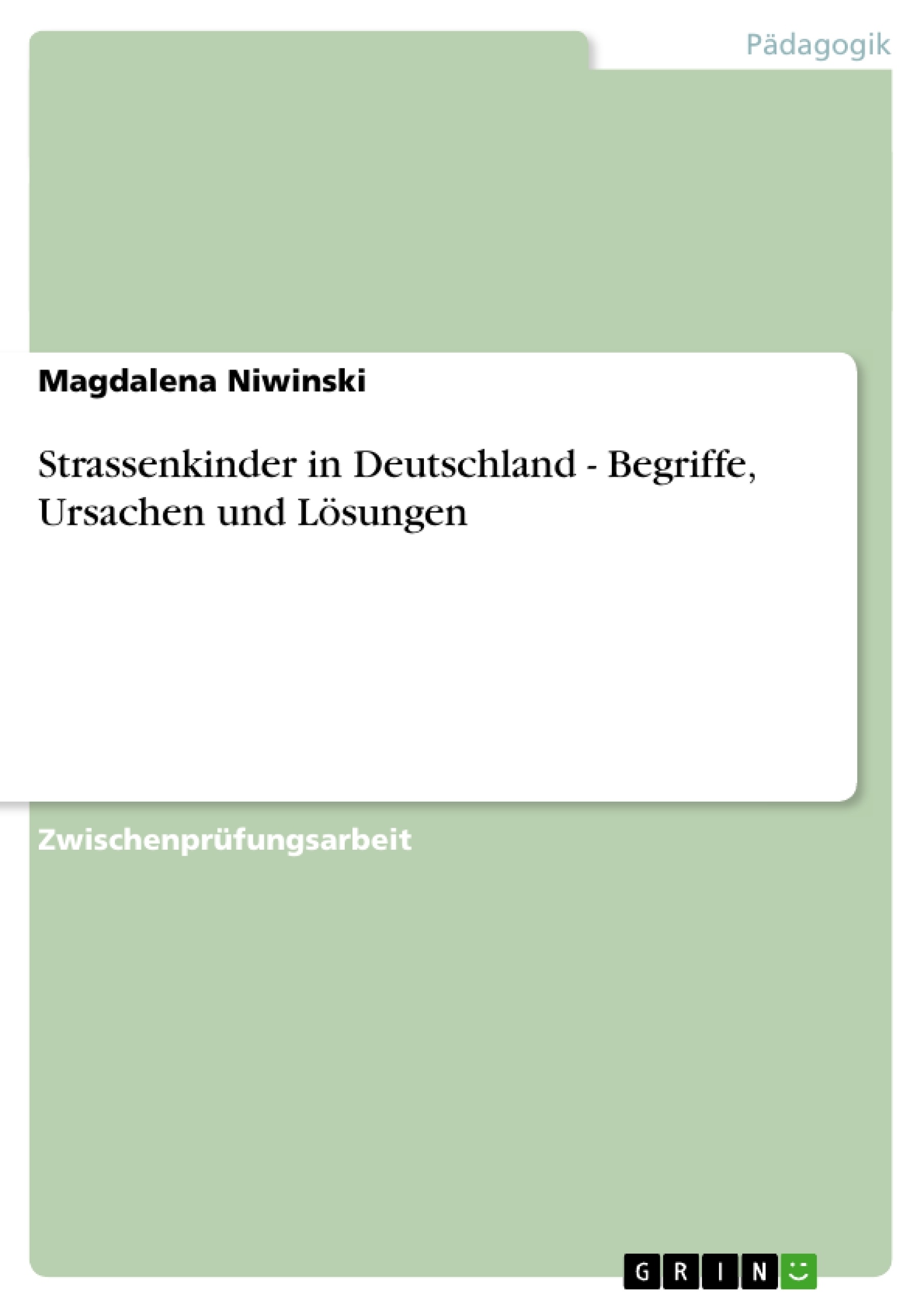„Straßenkinder“ galten lange Zeit als ein Problem, das „lediglich“ Länder der Dritten Welt betraf. Dank umfangreicher und bisweilen sensationsheischender Berichterstattung der Medien, ist es jedoch mittlerweile kein Geheimnis mehr, daß es auch in der reichen Industrienation Deutschland Kinder und Jugendliche gibt, die nicht mehr im vermeintlich wohlbehüteten Schoß der Familie, sondern am Rand der Gesellschaft „auf der Straße“ aufwachsen. Im Gegensatz zu beispielsweise lateinamerikanischen Ländern sind die Ursachen in der Bundesrepublik jedoch nicht in materieller Armut begründet, sondern es handelt sich eher um emotionale Notlagen, die Kinder und Jugendliche aus ihrem Zuhause vertreiben, sei es gewollt oder ungewollt. Vielfach ist zumindest zu vermuten, „daß Jugendliche sich oft längst vor ihrer ersten Flucht in ihrem Zuhause nicht (mehr) zu Hause fühlen und wenig Zugehörigkeit zu ihrer Familie und zu Familientraditionen entwickeln können, so daß die faktische Obdachlosigkeit schließlich nur ein äußerer Spiegel der inneren Heimatlosigkeit dieser Jugendlichen ist.“
Insgesamt handelt es sich um eine sehr vielschichtige Problematik, der mit monokausalen Erklärungsansätzen nicht beizukommen ist. Diese Arbeit soll daher die Kinder- und Jugendlichen auf ihren Wegen in die „Straßenexistenz“ begleiten, um die Ursachen für ihre besonderen individuellen Problemlagen zu verdeutlichen und weiterführend Lösungsansätze aufzuzeigen, mit deren Hilfe dem Entstehen bzw. der Verfestigung von Straßenkarrieren entgegengewirkt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Begriffsbestimmung „Straßenkinder“
- 2.1. Kurzer historischer Abriß
- 2.2. „Klassische“ Kategorien (nach Jordan / Trauernicht)
- 2.3. Zum heutigen Begriff „Straßenkind“
- 2.4. Ausmaß
- 3. Beweggründe und Ursachen von Straßenkarrieren
- 3.1. Problematische Lebensphasen
- 3.2. Familienbedingte Faktoren
- 3.2.1. schwere Belastungen
- 3.2.2. leichtere Belastungen
- 3.3. Attraktivität der Szene
- 3.4. Faktoren im sozialen Umfeld
- 4. Lebenswelten
- 4.1. Lebensorte
- 4.2. Lebensbedingungen
- 5. Lösungsansätze
- 5.1. Anforderung an Jugendhilfe und mobile Sozialarbeit
- 5.2. Die Alternative zum Kinderheim: Das „SULZ“ in Göttingen
- 6. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen von Straßenkindern in Deutschland. Sie geht über die bloße Beschreibung hinaus und analysiert die komplexen Ursachen und Beweggründe, die Kinder und Jugendliche auf die Straße führen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Problematik zu entwickeln und Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Begriffsbestimmung von „Straßenkindern“ im historischen und aktuellen Kontext
- Analyse der Ursachen von Straßenkarrieren, einschließlich familiärer und sozialer Faktoren
- Beschreibung der Lebenswelten von Straßenkindern
- Evaluierung von Lösungsansätzen und Interventionsprogrammen
- Untersuchung der Rolle von Jugendhilfe und mobiler Sozialarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Straßenkindern in Deutschland vor und betont, dass im Gegensatz zu Ländern der Dritten Welt, die Ursachen hier nicht in materieller Armut, sondern in emotionalen Notlagen liegen. Es wird auf den vielschichtigen Charakter des Problems hingewiesen und die Absicht der Arbeit, Ursachen zu verdeutlichen und Lösungsansätze aufzuzeigen, dargelegt.
2. Zur Begriffsbestimmung „Straßenkinder“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Straßenkinder“. Es beginnt mit einem historischen Abriss, der die Entwicklung des Phänomens von vorindustriellen Zeiten bis in die Gegenwart beleuchtet und unterschiedliche Ursachen im Laufe der Zeit aufzeigt, von Kriegen über Industrialisierung und Verarmung bis hin zu psychopathologischen Erklärungen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses von Straßenkindern und der Veränderung der Ursachen im Zeitverlauf. Das Kapitel differenziert zwischen materieller und emotionaler Notlage als Auslöser.
3. Beweggründe und Ursachen von Straßenkarrieren: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Ursachen, die Kinder und Jugendliche dazu bewegen, ein Leben auf der Straße zu führen. Es werden verschiedene Faktoren untersucht, darunter problematische Lebensphasen, familiäre Belastungen (einschließlich schwerer und leichter Belastungen), die Attraktivität der Straßenszene selbst und Einflüsse aus dem sozialen Umfeld. Die verschiedenen Aspekte werden eingehend betrachtet und in ihrer komplexen Vernetzung dargestellt.
4. Lebenswelten: Kapitel 4 beschreibt die Lebensrealität von Straßenkindern. Es beleuchtet die Orte, an denen sie leben (Lebensorte), und die Bedingungen, unter denen sie existieren (Lebensbedingungen). Es liefert einen Einblick in den Alltag und die Herausforderungen, denen sie täglich begegnen. Es wird ein Bild der Lebensumstände gezeichnet, das die Schwierigkeiten und Gefahren verdeutlicht.
5. Lösungsansätze: Dieses Kapitel konzentriert sich auf mögliche Lösungsansätze und Interventionen zur Unterstützung von Straßenkindern. Es untersucht die Anforderungen an Jugendhilfe und mobile Sozialarbeit und präsentiert ein Beispiel, wie z.B. das „SULZ“ in Göttingen, als Alternative zu traditionellen Kinderheimen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Implementierung von effektiven Strategien zur Prävention und Intervention.
Schlüsselwörter
Straßenkinder, Deutschland, Ursachen, Beweggründe, Familienstrukturen, soziale Faktoren, Jugendhilfe, mobile Sozialarbeit, Lösungsansätze, emotionale Notlagen, Lebenswelten, historischer Kontext, Begriffsbestimmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Straßenkinder in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über das Thema "Straßenkinder in Deutschland". Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Text analysiert die Ursachen und Hintergründe, warum Kinder und Jugendliche auf der Straße leben, beschreibt ihre Lebenswelten und evaluiert mögliche Lösungsansätze.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist strukturiert in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung "Straßenkinder", Beweggründe und Ursachen von Straßenkarrieren, Lebenswelten, Lösungsansätze und abschließende Bemerkungen. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst. Zusätzlich enthält der Text ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit den Themenschwerpunkten und ein Verzeichnis der Schlüsselwörter.
Was wird unter dem Begriff "Straßenkinder" verstanden?
Der Text widmet sich ausführlich der Begriffsbestimmung. Er betrachtet den Begriff historisch, von vorindustriellen Zeiten bis zur Gegenwart, und unterscheidet zwischen verschiedenen Kategorien und Definitionen. Dabei wird deutlich gemacht, dass die Ursachen für Straßenkinder im deutschen Kontext anders gelagert sind als in Ländern der Dritten Welt, wo materielle Armut eine größere Rolle spielt. In Deutschland stehen eher emotionale Notlagen im Vordergrund.
Welche Ursachen führen dazu, dass Kinder auf der Straße leben?
Der Text analysiert verschiedene Faktoren, die Kinder und Jugendliche auf die Straße führen. Dazu gehören problematische Lebensphasen, familiäre Belastungen (schwere und leichtere Belastungen), die Attraktivität der Straßenszene selbst und Einflüsse aus dem sozialen Umfeld. Die komplexen Zusammenhänge dieser Faktoren werden eingehend beleuchtet.
Wie ist das Leben von Straßenkindern in Deutschland?
Kapitel 4 beschreibt die Lebensrealität von Straßenkindern, inklusive ihrer Wohnorte und Lebensbedingungen. Es vermittelt ein Bild des Alltags und der Herausforderungen, mit denen diese Kinder konfrontiert sind, und verdeutlicht die Schwierigkeiten und Gefahren ihres Lebens.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Der Text untersucht mögliche Lösungsansätze und Interventionsprogramme zur Unterstützung von Straßenkindern. Er beleuchtet die Anforderungen an Jugendhilfe und mobile Sozialarbeit und nennt Beispiele für alternative Hilfestellungen, wie z.B. das "SULZ" in Göttingen als Alternative zu traditionellen Kinderheimen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Implementierung effektiver Präventions- und Interventionsstrategien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Textes prägnant beschreiben, sind: Straßenkinder, Deutschland, Ursachen, Beweggründe, Familienstrukturen, soziale Faktoren, Jugendhilfe, mobile Sozialarbeit, Lösungsansätze, emotionale Notlagen, Lebenswelten, historischer Kontext, Begriffsbestimmung.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für alle, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Straßenkinder in Deutschland auseinandersetzen, z.B. Studenten, Wissenschaftler, Sozialarbeiter und Mitarbeiter von Jugendhilfeeinrichtungen. Er bietet eine fundierte und strukturierte Analyse der Problematik und kann als Grundlage für weiterführende Recherchen und Interventionen dienen.
- Quote paper
- Magdalena Niwinski (Author), 2002, Strassenkinder in Deutschland - Begriffe, Ursachen und Lösungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8608