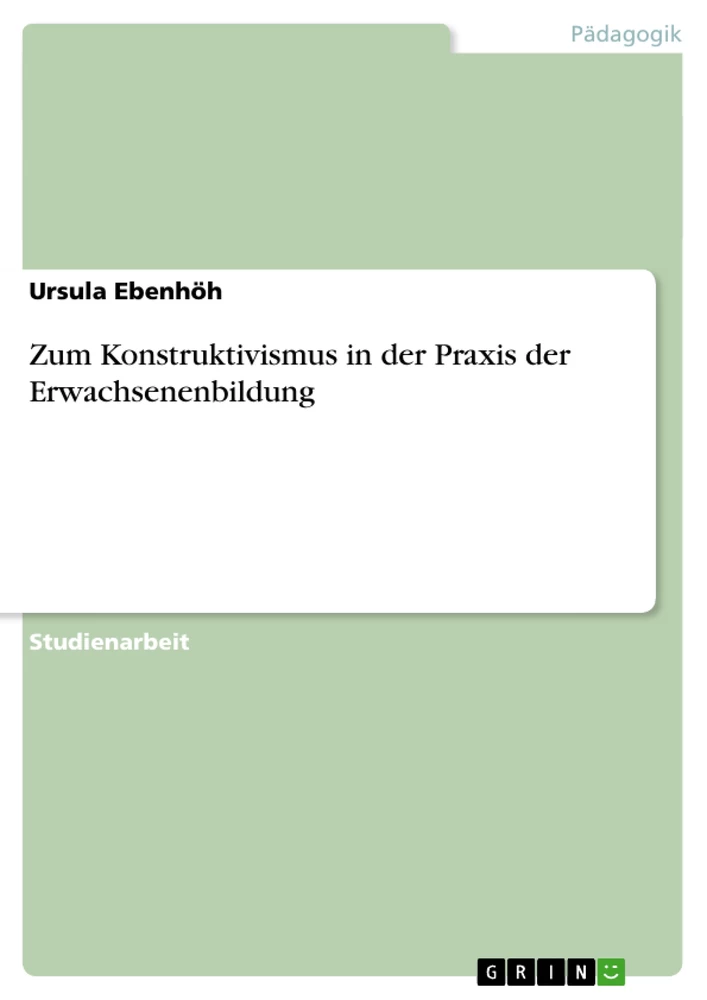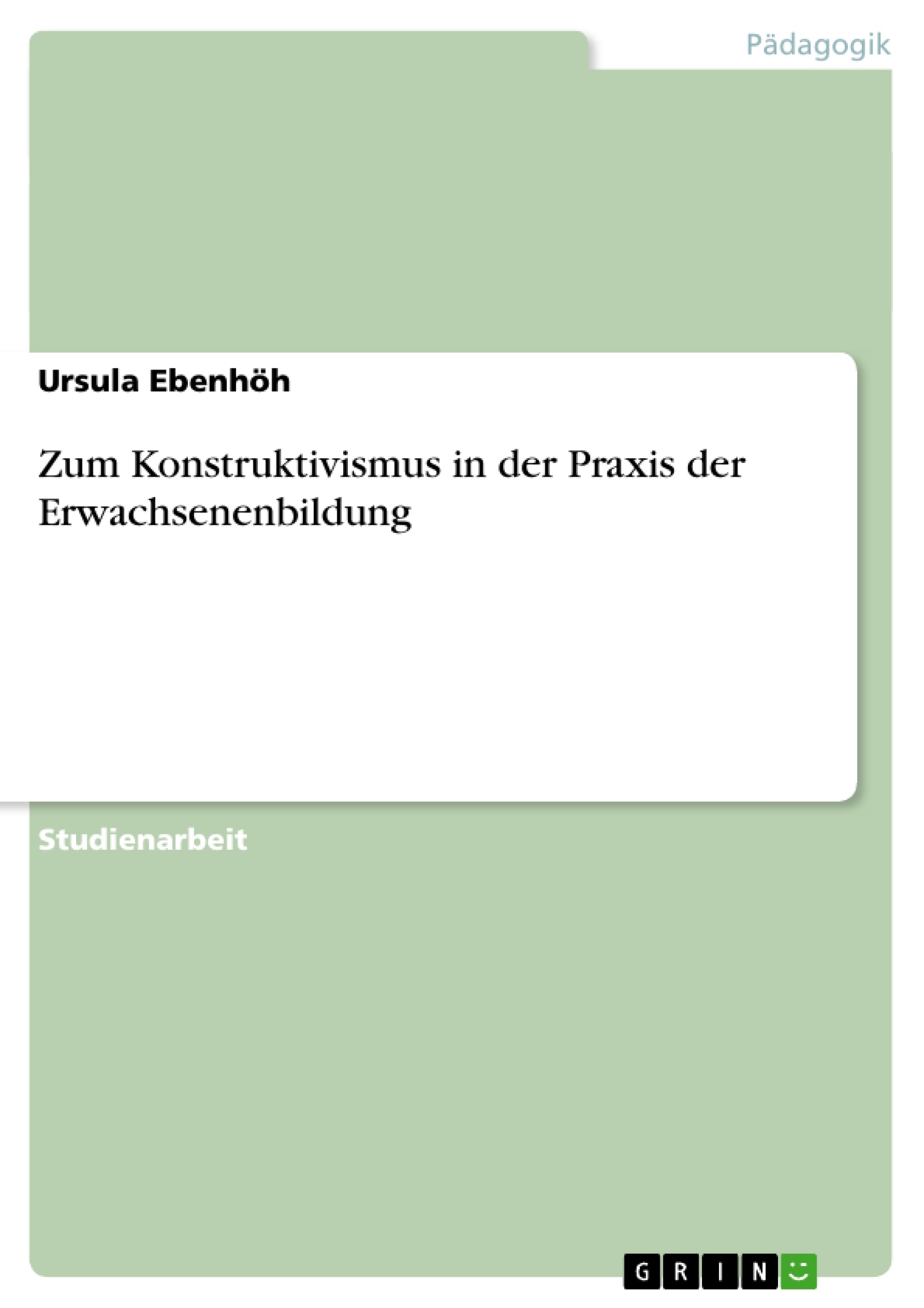Anhand der geläufigsten Thesen und Begriffe des Konstruktivismus, möchte ich zunächst dieses breite Thema, das nicht nur für die Pädagogik und Andragogik relevant ist, sondern dessen Wurzeln, die sowohl in den Natur-, als auch in den Sozialwissenschaften und der Philosophie zu finden sind, so darlegen, dass die Interdisziplinarität erhalten bleibt.
Anschließend möchte ich die wichtigsten Begriffe ansprechen, die den Konstruktivismus als Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie ausmachen.
Danach werde ich Didaktikentwürfe und Ergebnisse aus der Lehr- und Lernforschung unterschiedlicher Bereiche heranziehen, um praxisnahen Konstruktivismus vorzustellen.
Im Rahmen dieser Arbeit beabsichtige ich, die Unterschiede zwischen traditionellen und konstruktivistischen Lernzielen herauszuarbeiten. Denn die Bedeutung von Wirklichkeit hat sich durch den Konstruktivismus und seine Vertreter gewandelt, und der Begriff der Objektivität ist für einen Konstruktivisten eine schlichte Illusion. Aber lässt sich denn immer an der Realität deuteln? Gibt es keine Tatsachen, die offenbaren was nicht abzustreiten ist? Warum gibt es dann keinen Wahrheitsanspruch mehr? Was ist neu oder anders an diesem Denken? Denn bereits der Vorsokratiker Xenophanes stellte fest:
„Und das Genaue freilich erblickt kein Mensch und es wird auch nie jemand sein, der es weiß (erblickt hat)… denn selbst wenn es einem im höchsten Maß gelänge, ein Vollendetes auszusprechen, so hat er selbst trotzdem kein Wissen davon: Schein (meinen) haftet an allem.“ (zit. n. von Glasersfeld 1994, 24)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Konstruktivismus?
- Die Entstehung des Konstruktivismus
- Konstruktivistische Positionen und Strömungen
- Schlüsselbegriffe des Konstruktivismus
- Autopoiesis
- Viabilität
- Wissen
- Perturbation
- Konstruktivistische Lehr- und Lernformen
- Das Verhältnis des Lehrenden zum Lernenden
- Die konstruktivistische Lernumgebung
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Konstruktivismus im Kontext der Theorien der Erwachsenenbildung. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Konstruktivismus als eine wichtige Theorie für die erwachsenbildnerische Praxis zu beleuchten. Dabei werden zentrale Thesen und Begriffe des Konstruktivismus dargestellt, und es wird auf seine Interdisziplinarität eingegangen.
- Der Konstruktivismus als Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie
- Schlüsselbegriffe des Konstruktivismus wie Autopoiesis, Viabilität und Perturbation
- Die Anwendung konstruktivistischer Prinzipien in Lehr- und Lernformen
- Die Unterscheidung zwischen traditionellen und konstruktivistischen Lernzielen
- Die Bedeutung von Wirklichkeit und Objektivität im konstruktivistischen Denken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema „Konstruktivismus“ im Kontext der Erwachsenenbildung ein und beschreibt die Zielsetzung der Hausarbeit. Sie hebt die Interdisziplinarität des Konstruktivismus hervor und skizziert die wichtigsten Themen, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
Was ist Konstruktivismus?
Dieses Kapitel definiert den Konstruktivismus als einen erkenntnis-, systemtheoretischen, kognitionspsychologischen und wissenssoziologischen Begriff. Es erklärt, dass der Mensch keinen unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit hat und dass nur das erkannt wird, was in seine individuelle Konstruktion der Wirklichkeit passt. Der Konstruktivismus sieht den Menschen als ein geschlossenes, autopoietisches System, das durch Perturbation verändert werden kann. Neues Wissen muss in das bereits vorhandene integriert und viabel gemacht werden, um in das System zu passen.
Die Entstehung des Konstruktivismus
Dieses Kapitel beleuchtet die Ursprünge des Konstruktivismus und stellt wichtige Vertreter vor, darunter Giambattista Vico, Silvio Ceccato und Jean Piaget. Es erläutert Vicos „Verum ipsum factum“ und die Bedeutung der eigenen Geschichte des Konstruierenden. Weiterhin wird Piagets Theorie der Äquilibration und die Rolle der Autopoiesis in Niklas Luhmanns Systemtheorie behandelt.
Konstruktivistische Positionen und Strömungen
Dieses Kapitel stellt die drei Hauptströmungen des Konstruktivismus vor: den radikalen Konstruktivismus, den „neuen“ Konstruktivismus in der Soziologie, Kognitionswissenschaft und Psychologie sowie konstruktivistische Ansätze in der Instruktionspsychologie und Empirischen Pädagogik.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Autopoiesis, Viabilität, Perturbation, Wissen, Lehr- und Lernformen, Erwachsenenbildung, traditionelle Lernziele, konstruktivistische Lernziele, Wirklichkeit, Objektivität, Geschichte des Konstruierenden, Äquilibration, Systemtheorie, Deutungsmusteransatz.
- Quote paper
- Ursula Ebenhöh (Author), 2004, Zum Konstruktivismus in der Praxis der Erwachsenenbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/86007