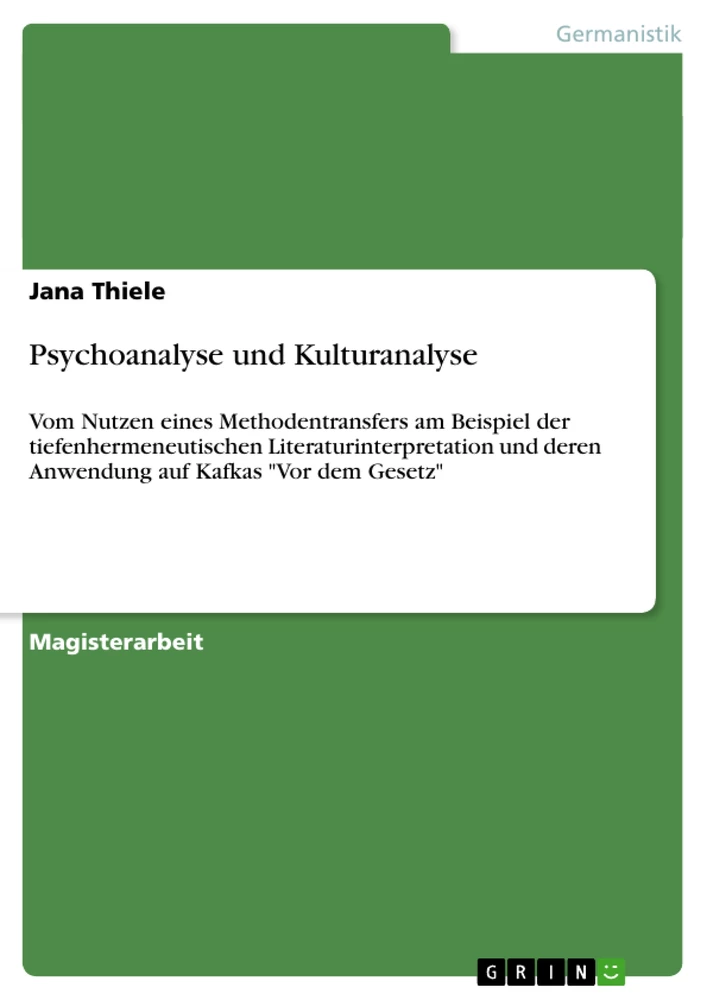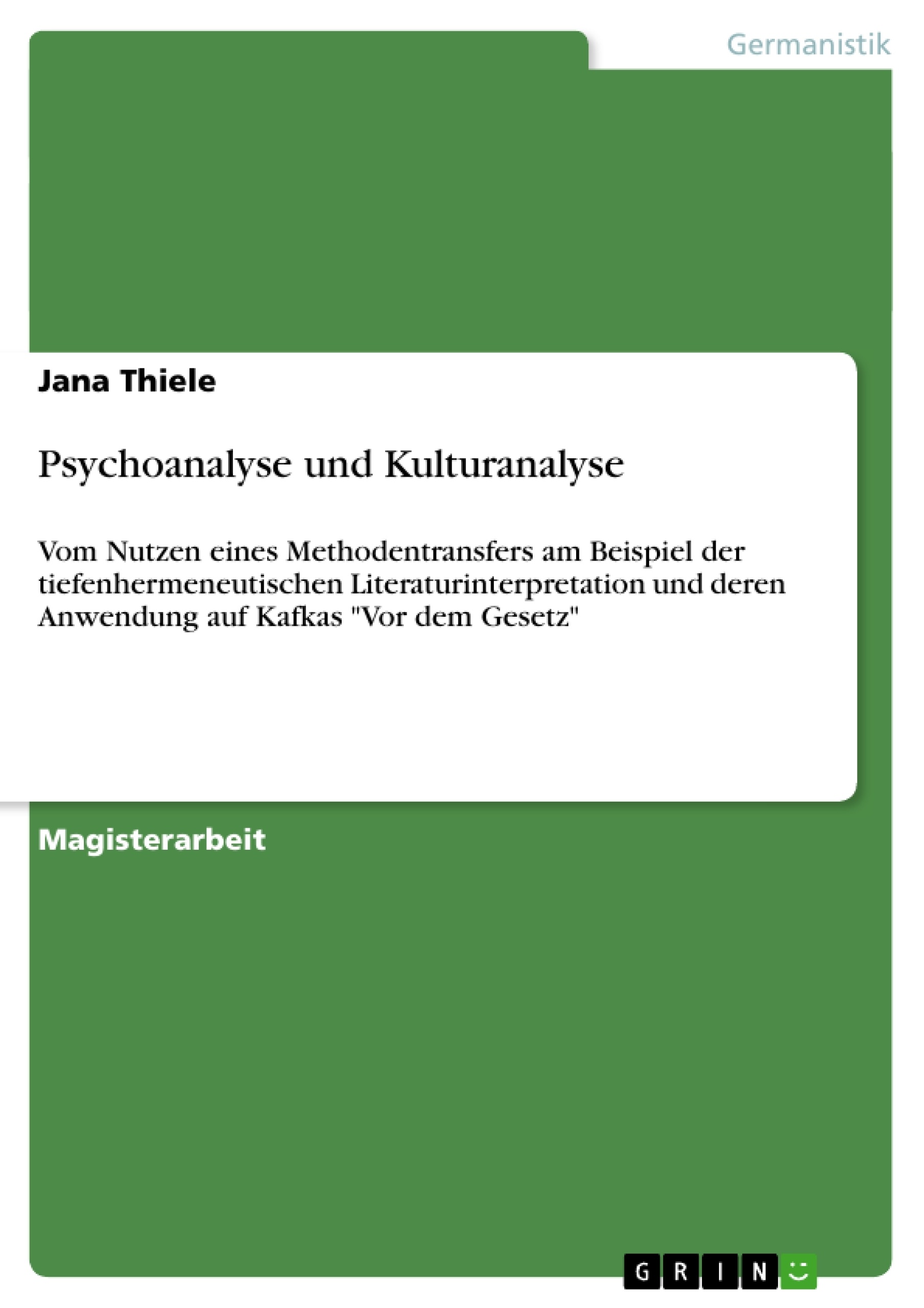Erkenntnisgegenstand der Psychoanalyse ist das Unbewußte des Analysanden, der einer tiefenhermeneutischen Literaturinterpretation die latente Sinnstruktur des Textes. Allein die Sprache scheint auf den ersten Blick Untersuchungsgegenstand dieser beiden Disziplinen. Nun machen aber gerade, ausgewiesen in Freuds technischen Schriften, die Hinweise auf die Art und Weise der Durchführung der Psychoanalyse deutlich, daß sowohl die Äußerungen des Analysanden wie die Deutung des Analytikers sich nicht auf das Gesagte beschränken lassen. Die Notwendigkeit der Deutung des Analytikers ergibt sich aus der Annahme der Psychoanalyse, daß der Analysand das Gesagte nicht meint. In diese Lücke springt der Analytiker. Seine Aufgabe besteht darin, dem Analysanden die Bedeutung des Gesagten zu erschließen. Das Unbewußte kann nicht ,gesagt’ werden, vielmehr kann die Semantik des Wunsches nur durch die Pragmatik der Analysesituation erschlossen werden. Denn in ihr laufen, nonverbal, Übertragungs- und Gegenübertragungsvorgänge ab. Gerade Freuds technische Schriften machen deutlich, daß die Technik nicht von inhaltlichen Aspekten getrennt werden kann.
Einem ähnlichen Paradox sieht sich der Leser und Interpret gegenüber: Literatur handelt immer auch vom Unsagbaren. Nicht anders als in der Analyse ist es die spezielle Beziehung zwischen Interpret und Interpretandum, die diese Spanne überbrücken muß. Der Text variiert nicht, bietet keine Assoziationen, dies hat der lesende Interpret zu leisten. Wenn aber der Literaturwissenschaftler der Interpret des Textes ist, also die Rolle des Analytikers einnimmt, ist er angewiesen auf seine eigenen Assoziationen. Ungeklärt bei alledem erscheint bei einem ersten Blick also schon die Rollenverteilung. Wenn man von der Technik der klassischen Psychoanalyse ausgeht, müßte man wohl eher vermuten, daß der Text die Rolle des Analytikers übernimmt. Liest also der Interpret nicht viel eher sein Unbewußtes als das des Textes? Nicht unberechtigt demnach auch die Frage: Wer liest wen?
Daher ist zunächst die Offenlegung der eigenen Voraussetzungen und des methodischen Vorgehens des Interpreten bei einer psychoanalytisch operierenden Literaturwissenschaft unabdingbar, genauso wie es die Lehranalyse ist, um den Analytiker der Arbeit mit dem Analysanden zu befähigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kooperation Literatur - Psychoanalyse
- Von der Anwendung zum Transfer
- Gegenstand und Probleme
- Die Theorie der Psychoanalyse
- Der Traum: Transport, Transformation, Translation
- Missing link: die sozialisierte Phantasie
- Die Phantasie: Spiel, Form, Reservat
- Traumdeutung oder Therapie als Paradigma der Textdeutung?
- Die Praxis der Psychoanalyse
- Orientierung am psychoanalytischen setting
- Die Grundregel und ihr Gegenstück
- Übertragung und Gegenübertragung
- Gelingen und Aporie der Selbstanalyse
- Orientierung am psychoanalytischen setting
- Die Theorie der Kulturanalyse
- Tiefenhermeneutische Kulturanalyse/Lorenzer
- Symbolisierung und Desymbolisierung
- Symbole als kulturelle Leistung
- Klischees
- Szenisches Verstehen
- Der Text als Träger der Szene
- Rollenverteilung, Modifikationen
- Symbolisierung und Desymbolisierung
- Tiefenhermeneutische Methode/Würker
- Tiefenhermeneutische Kulturanalyse/Lorenzer
- Die Praxis der Kulturanalyse
- Franz Kafka: Vor dem Gesetz
- Tiefenhermeneutische Interpretation
- Inversion der Szene
- Schwellenangst: Freuds Zimmer
- Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Übertragung psychoanalytischer Methoden auf die Literaturinterpretation. Sie untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen eines solchen Methodentransfers am Beispiel von Kafkas „Vor dem Gesetz“ und analysiert die Relevanz der tiefenhermeneutischen Methode für das Verständnis dieses Textes.
- Die wechselseitige Beziehung zwischen Literatur und Psychoanalyse
- Die Anwendung psychoanalytischer Konzepte auf literarische Texte
- Die Entwicklung der tiefenhermeneutischen Methode in der Kulturanalyse
- Die Anwendung der tiefenhermeneutischen Methode auf Kafkas „Vor dem Gesetz“
- Die Bedeutung der Phantasie und des Unbewußten für das Verständnis von Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zusammenarbeit von Literatur und Psychoanalyse dar und beleuchtet den historischen Kontext des Methodentransfers. Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen der Psychoanalyse, insbesondere mit der Bedeutung des Traums, der Phantasie und der Traumdeutung. Kapitel 3 erörtert die Praxis der Psychoanalyse, insbesondere die Grundregel und die Übertragungsprozesse. Kapitel 4 erläutert die Theorie der tiefenhermeneutischen Kulturanalyse nach Lorenzer und Würker, während Kapitel 5 die Anwendung dieser Methode auf Kafkas „Vor dem Gesetz“ zeigt. Kapitel 5.1 analysiert die Inversion der Szene im Text und die Bedeutung von Freuds Zimmer als Symbol für die Schwellenangst. Die Ergebnisse der Interpretation werden in Kapitel 5.2 zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Tiefenhermeneutische Literaturinterpretation, Psychoanalyse, Kulturanalyse, Franz Kafka, Vor dem Gesetz, Traum, Phantasie, Unbewußtes, Übertragung, Symbolisierung, Desymbolisierung, Szenisches Verstehen.
- Quote paper
- Jana Thiele (Author), 2002, Psychoanalyse und Kulturanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85618