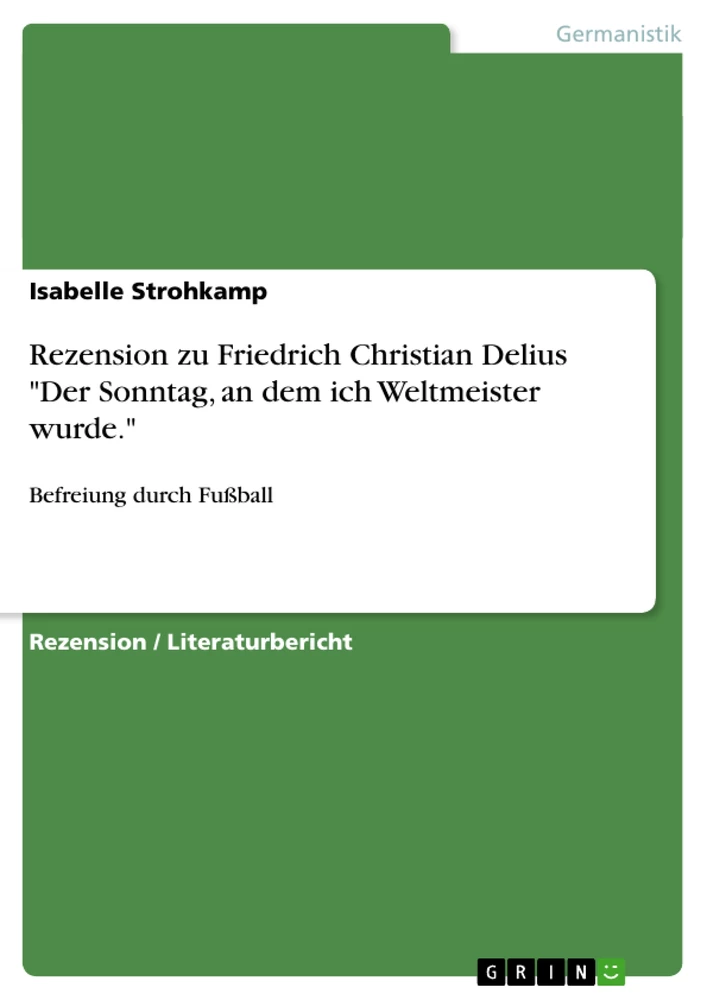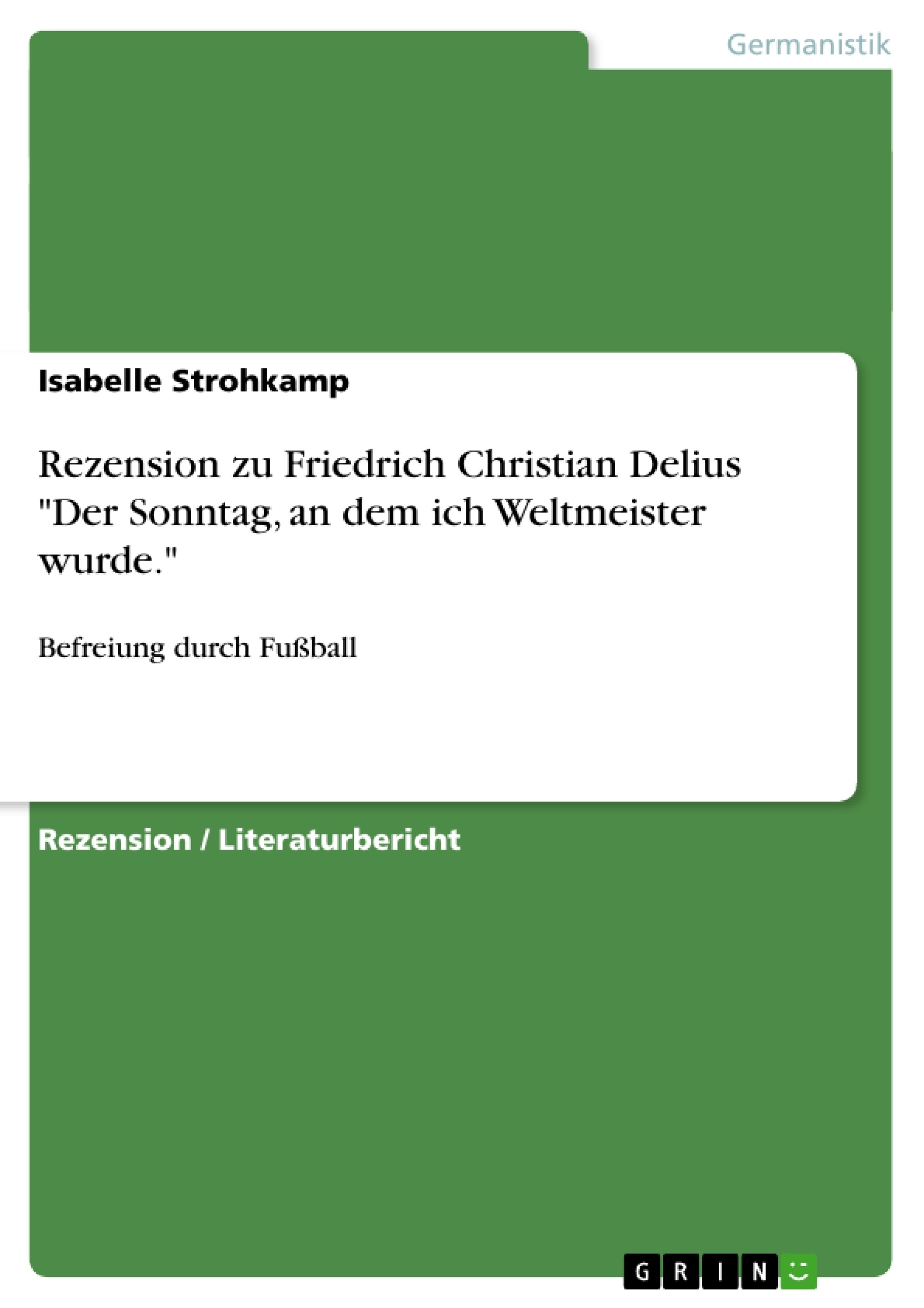Der herausragendste Tag im Leben des elfjährigen Pastorensohns, der in dem kleinen hessischen Dörfchen Wehrda aufwächst, beginnt wie jeder andere Sonntag: Scheinbar ewig andauernde fünfzehn Minuten läuten die Glocken der Kirche, die direkt neben dem Pfarrhaus steht, prügeln den Jungen an dem freien Tag unsanft aus dem Bett, dringen gleichzeitig massiv in seine Privatsphäre ein. Er versucht noch vergeblich, die schönen Träume aus der vergangenen Nacht festzuhalten und fort zu spinnen, doch musste sich letztendlich der forcierten Eindringlichkeit der akustischen Prügel geschlagen geben.
Der Rezipient bemitleidet den Protagonisten aus Friedrich Christian Delius’ Erzählung „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde“, das 1996 erstmalig erschienen ist. Sie handelt von dem Sonntag, an dem die besiegte Nation Deutschland zum ersten Mal nach dem Krieg neues Selbstbewusstsein erlangt: dem 4. Juli 1954, an dem das Finale der Weltmeisterschaft stattfindet. Erst bei genauerer Untersuchung fällt auf, dass das Werk autobiografisch ist und somit das autoritäre Klima Delius’ Kindheit in der rationalen, regelstrotzenden Zeit der Fünfziger beschreibt.
Inhaltsverzeichnis
- Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde
- Der Tag des Pfarrersohnes
- Die Macht der Religion
- Die Befreiung durch die Sprache
- Der Fußball und die Weltmeisterschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Erzählung „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde“ von Friedrich Christian Delius erzählt von einem jungen Pastorensohn, der im Jahr 1954, während der Weltmeisterschaft, eine emotionale und intellektuelle Befreiung erlebt. Delius zeichnet ein tiefgründiges Bild seiner Kindheit, geprägt von religiöser Erziehung und den Zwängen der Zeit.
- Die Macht der Religion und ihre Auswirkungen auf das Individuum
- Der Konflikt zwischen Tradition und Moderne
- Die befreiende Kraft der Sprache und Kommunikation
- Das Fußballspiel als Katalysator für emotionale Befreiung
- Die Suche nach Identität in einer autoritären Umgebung
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Teil der Erzählung beschreibt die prägende Umgebung des Protagonisten, einen jungen Pastorensohn in einem hessischen Dorf. Delius schildert seine Kindheit, geprägt von religiösen Dogmen und einer strengen Erziehung. Die allgegenwärtige Macht der Religion und die damit verbundenen Zwänge prägen die Gedanken und Gefühle des Jungen.
- Der zweite Teil fokussiert sich auf den Sonntag des Weltmeisterschaftsfinales. Die Predigt des Vaters im Gottesdienst wird dem Jungen zum Beweis für die Macht der Sprache als Mittel der Kontrolle. Delius thematisiert die Spannung zwischen der autoritären Ausdrucksweise des Vaters und der Freiheit der Gedanken.
- Der dritte Teil der Erzählung erzählt vom Fußballspiel im Radio. Herbert Zimmermanns begeisternder Kommentar überträgt die Begeisterung für das Spiel auf den Jungen und ermöglicht ihm eine emotionale Befreiung von den Fesseln seiner religiösen Erziehung. Die Sprache des Kommentators wirkt befreiend und lässt den Jungen eine neue Welt entdecken.
Schlüsselwörter
Die Erzählung „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde“ widmet sich den Themen der Religion, der Sprache, der Autorität, der Befreiung, der Kindheit und der Zeitgeschichte. Delius beschreibt die komplexen Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft und zeigt die Macht der Sprache, sowohl als Mittel der Kontrolle als auch der Befreiung.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Isabelle Strohkamp (Auteur), 2006, Rezension zu Friedrich Christian Delius "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde.", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85488