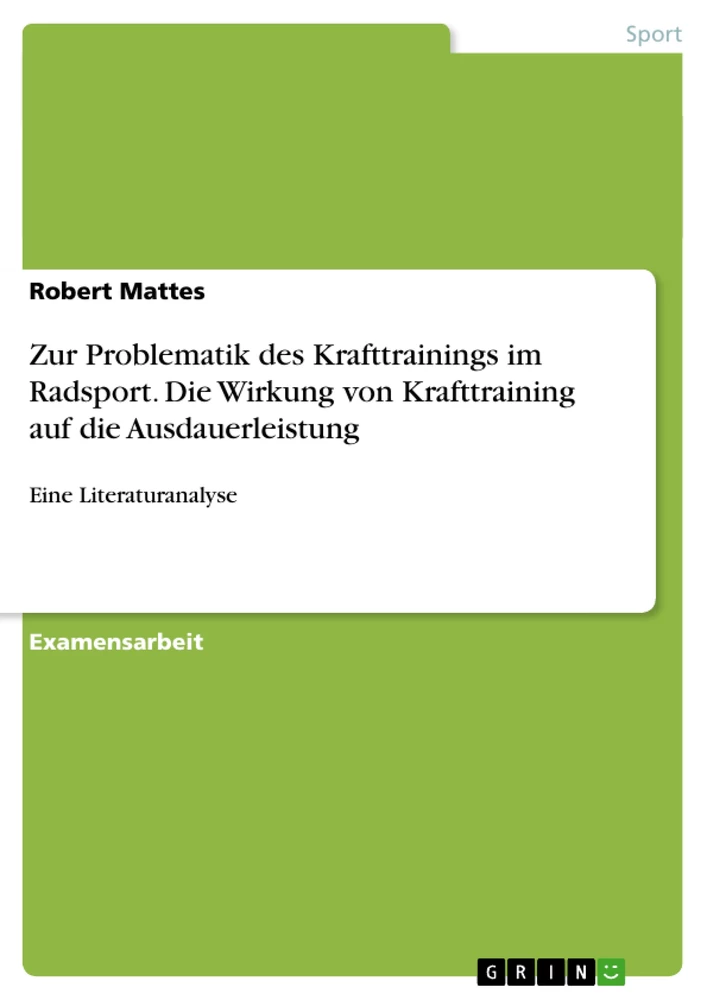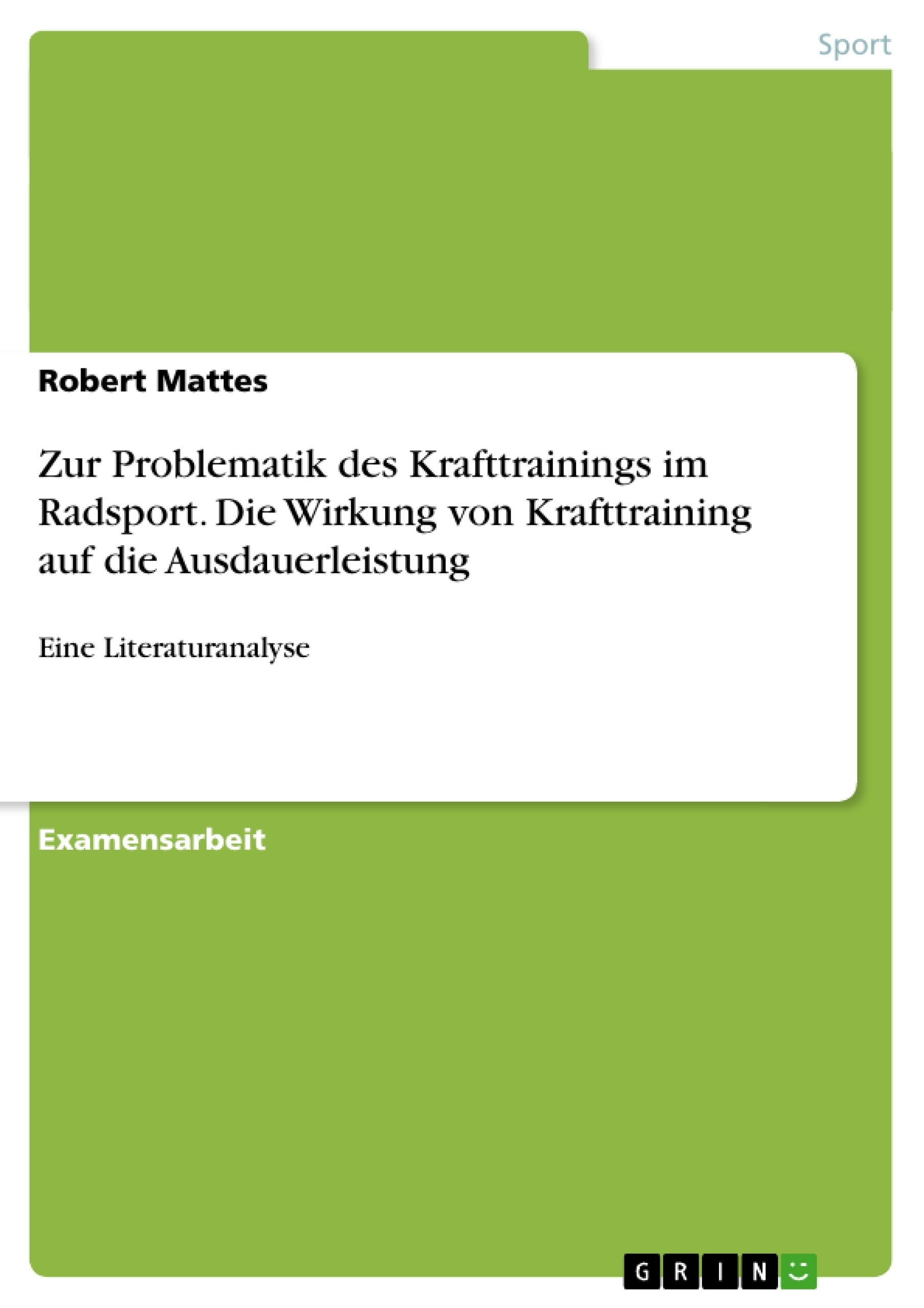Der jährliche Trainingsumfang in der "typischen" Ausdauerdisziplin Profiradsport beträgt mittlerweile zwischen 27000 und 39000 km (JEUKENDRUP et al. 2001). Es ist nicht verwunderlich, dass bei solch großen Umfängen die Trainingsplanung an zeitliche Grenzen stößt und dass bei Athleten und Trainern das Interesse an neuen Trainingsinhalten und -formen zur weiteren Steigerung der Leistung im Wettkampf steigt. Eine mögliche Option ist die Aufnahme eines separaten, mit Geräten durchgeführten Krafttrainings in den Trainingsplan, während gleichzeitig das Ausdauertraining unverändert oder leicht reduziert fortgeführt wird. Dabei ist es in der Forschung jedoch umstritten, ob sich ein solches Krafttraining überhaupt positiv auf die Ausdauerleistung auswirken kann, u.a. deshalb, weil Krafttraining und Ausdauertraining zum Teil unterschiedliche und sich möglicherweise gegenseitig ausschließende physiologische Anpassungserscheinungen hervorrufen, insbesondere auf einem hohen Leistungsniveau (GROSSER et al. 2001, 128), oder ob es im Gegenteil nicht sogar zu einer Beeinträchtigung der Leistungsentwicklung der Ausdauerfähigkeiten kommt.
Mehrere Untersuchungen haben sich mit der Problematik befasst und Studien mit verschiedenen Arten von Krafttraining durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien scheinen sich dabei jedoch zu widersprechen: HICKSON et al. (1988) und BASTIAANS et al. (2001) beispielsweise, konnten von einer signifikanten Verbesserung der Ausdauerleistung durch ein zusätzliches Krafttraining berichten. DUDLEY/DJAMIL (1985) und BISHOP et al. (1999) hingegen konnten keine Verbesserung der Ausdauerleistung beobachten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die Studien oft hinsichtlich zahlreicher Variablen wie Trainingsalter der Probandengruppe, Art und Durchführung des Krafttrainings (Maximalkrafttraining, Explosivkrafttraining, langsame vs. schnelle Bewegungsausführung, geringe und hohe Wiederholungszahlen etc.) sowie Trainingsdauer und Trainingshäufigkeit unterscheiden. Die Studien miteinander zu vergleichen wird dadurch deutlich erschwert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Die konditionelle Grundeigenschaft Kraft
- 2.1. Physikalische und biologische Definition
- 2.2. Physiologische Grundlagen: Bau und Funktionsweise des Skelettmuskels
- 2.2.1. Der Bau des Skelettmuskels
- 2.2.2. Der Ablauf einer Muskelkontraktion
- 2.2.2.1. Elektromechanische Kopplung und Gleitfilamenttheorie
- 2.2.2.2. Arbeitsweisen und Kontraktionsformen der Muskulatur
- 2.3. Die Strukturierung der konditionellen Grundeigenschaft Kraft
- 2.3.1. Strukturierungsansätze
- 2.3.2. Strukturierung und Definition der Kraftfähigkeiten
- 2.3.2.1. Die besondere Bedeutung der Maximalkraft
- 2.3.2.2. Maximalkraft
- 2.3.2.3. Schnellkraft
- 2.3.2.4. Reaktivkraft
- 2.3.2.5. Kraftausdauer
- 2.4. Die Einflussfaktoren der Kraftfähigkeiten
- 2.4.1. Übersicht: Die Kraftfähigkeiten und ihre Einflussfaktoren
- 2.4.2. Morphologische Faktoren
- 2.4.2.1. Muskelquantität
- 2.4.2.2. Muskelqualität
- 2.4.3. Nervale Faktoren
- 2.4.3.1. Neuronale Aktivierung
- 2.4.3.2. Rekrutierung
- 2.4.3.3. Frequenzierung
- 2.4.3.4. Synchronisierung
- 2.4.4. Energetische Faktoren
- 2.5. Krafttrainingsmethoden und ihre Anpassungserscheinungen
- 3. Die konditionelle Grundeigenschaft Ausdauer
- 3.1. Definition und Strukturierung
- 3.2. Physiologische Grundlagen: die Stoffwechselsysteme
- 3.2.1. Der Muskelstoffwechsel
- 3.2.2. Der Phosphatstoffwechsel
- 3.2.3. Energienachlieferung durch biologische Oxidation der Nährstoffe
- 3.2.3.1. Die anaerobe Oxidation von Glykogen unter Laktatanfall / die Glykolyse
- 3.2.3.2. Der aerobe Oxidation von Glykogen
- 3.2.3.3. Die aerobe Oxidation von Fetten
- 3.2.4. Die Stoffwechselsysteme im Vergleich
- 3.3. Weitere Einflussgrößen der Ausdauerleistungsfähigkeit
- 3.3.1. Die Bedeutung der Muskelfasertypen
- 3.3.2. Respiratorische Einflussgrößen: die maximale Sauerstoffaufnahme
- 3.3.3. Die Laktatschwelle
- 3.4. Die Anpassungserscheinungen des Maximalkrafttrainings und des Ausdauertrainings in der Gegenüberstellung
- 4. Die konditionellen Einflussgrößen im Radsport
- 5. Zur Problematik des Krafttrainings im Radsport: eine Literaturanalyse
- 5.1. Kategorisierung und Gegenüberstellung von Studien und deren Ergebnisse zur Problematik "Einfluss von Krafttraining auf die Ausdauerleistung"
- 5.1.1. Studien, die einen positiven Einfluss auf die Ausdauerleistung zeigen
- 5.1.2. Studien, die keinen Einfluss auf die Ausdauerleistung zeigen
- 5.1.3. Studien, die einen negativen Einfluss auf die Ausdauerleistung zeigen
- 5.1.4. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5.1.4.1. Vorbemerkungen und Übersicht
- 5.1.4.2. Überprüfung der Hypothesen und Kommentar zur Auswahl der Messgrößen und Messmethoden zur Beurteilung der Ausdauerleistungsfähigkeit
- 5.2. Diskussion
- 5.2.1. Die Wirkung von Krafttraining auf die Einflussfaktoren der Ausdauerleistung
- 5.2.1.1. Der Einfluss von Krafttraining auf die maximale Sauerstoffaufnahme
- 5.2.1.2. Der Einfluss von Krafttraining auf die Laktatanhäufung
- 5.2.2. Weitere Erklärungen für die positive Wirkung von Krafttraining auf die Ausdauerleistung
- 5.2.3. Die Problematik der unterschiedlichen Anpassungserscheinungen
- 5.2.3.1. Zur Reduktion der Mitochondrienanzahl durch Maximalkrafttraining
- 5.2.3.2. Zu den unterschiedlichen Muskelfaseranpassungen
- 5.2.3.3. Zur Vergrößerung des Muskelquerschnitts durch Maximalkrafttraining
- 5.2.4. Weitere Problemfelder und Trainingsvariablen
- 5.2.4.1. Die Bedeutung des Trainingsstatus der Probanden
- 5.2.4.2. Zur Koordinierung von Krafttraining und Ausdauertraining
- 5.2.4.3. Trainingsmethoden, Übungsauswahl und —durchführung
- 5.2.4.4. Die Bedeutung des Geschlechts für die Wirksamkeit des Krafttrainings
- 5.2.4.5. Zur Bedeutung des "Störeffekts" des Ausdauertrainings auf die Entwicklung der Kraftfähigkeiten für den Radsport
- 5.3. Zukünftige Forschungen
- 6. Trainingspraktische Konsequenzen
- 6.1. Vorbemerkungen
- 6.2. Krafttraining für Radsportler- Vorschläge zur Trainingsgestaltung
- 6.2.1. Zur Übungsauswahl, Übungsdurchführung und Trainingskoordinierung
- 6.2.2. Zum Einbau des Krafttrainings in den Jahrestrainingsplan
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Krafttraining auf die Ausdauerleistung im Radsport. Ziel ist es, die kontroversen Forschungsergebnisse zu diesem Thema zu analysieren und den Einfluss verschiedener Krafttrainingsmethoden auf die Ausdauerleistungsfähigkeit zu bewerten.
- Wirkung von Krafttraining auf die Ausdauerleistung im Radsport
- Analyse widersprüchlicher Forschungsergebnisse
- Einfluss verschiedener Krafttrainingsmethoden
- Physiologische Anpassungserscheinungen von Kraft- und Ausdauertraining
- Trainingsempfehlungen für Radsportler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung dar: Im Radsport, mit seinem hohen Trainingsumfang, wird nach neuen Methoden zur Leistungssteigerung gesucht. Die Aufnahme von Krafttraining ist eine Option, deren Wirksamkeit jedoch umstritten ist, da Kraft- und Ausdauertraining gegensätzliche physiologische Anpassungen hervorrufen können. Die Arbeit analysiert widersprüchliche Studienergebnisse und untersucht die Einflussfaktoren.
2. Die konditionelle Grundeigenschaft Kraft: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung der konditionellen Grundeigenschaft Kraft. Es definiert Kraft physikalisch und biologisch, beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise des Skelettmuskels (inkl. Muskelkontraktion, Gleitfilamenttheorie), strukturiert die Kraftfähigkeiten (Maximalkraft, Schnellkraft, Reaktivkraft, Kraftausdauer) und untersucht deren Einflussfaktoren (morphologische, nervale und energetische Faktoren).
3. Die konditionelle Grundeigenschaft Ausdauer: Dieses Kapitel beschreibt die konditionelle Grundeigenschaft Ausdauer, definiert sie, und strukturiert sie. Es erläutert die physiologischen Grundlagen, insbesondere die verschiedenen Stoffwechselsysteme (Phosphatstoffwechsel, Glykolyse, aerobe Oxidation von Glykogen und Fetten), und analysiert weitere Einflussfaktoren wie Muskelfasertypen, maximale Sauerstoffaufnahme und Laktatschwelle. Es vergleicht die Anpassungserscheinungen von Kraft- und Ausdauertraining.
4. Die konditionellen Einflussgrößen im Radsport: Dieses Kapitel befasst sich mit den spezifischen konditionellen Anforderungen im Radsport und bildet die Brücke zur Analyse der Krafttrainingseffekte im Kontext dieser Sportart. Es verknüpft die im vorherigen Kapitel erworbenen Erkenntnisse über die Ausdauerleistungsfähigkeit mit den praktischen Anforderungen des Radsports.
5. Zur Problematik des Krafttrainings im Radsport: eine Literaturanalyse: Dieses Kapitel analysiert wissenschaftliche Studien zum Thema des Einflusses von Krafttraining auf die Ausdauerleistung im Radsport. Es kategorisiert Studien mit positiven, neutralen und negativen Ergebnissen und diskutiert die unterschiedlichen Trainingsmethoden, Probandengruppen und Messmethoden. Es analysiert die Wirkung von Krafttraining auf Einflussfaktoren der Ausdauerleistung, wie maximale Sauerstoffaufnahme und Laktatanhäufung. Schließlich werden weitere Problemfelder und Variablen, wie Trainingsstatus, Koordinierung von Kraft- und Ausdauertraining, und Geschlechtsunterschiede, beleuchtet.
6. Trainingspraktische Konsequenzen: Dieses Kapitel zieht aus der Literaturanalyse trainingspraktische Konsequenzen für Radsportler. Es gibt Vorschläge zur Trainingsgestaltung, Übungsauswahl, Übungsdurchführung und Koordinierung von Kraft- und Ausdauertraining sowie zum Einbau des Krafttrainings in den Jahresplan.
Schlüsselwörter
Krafttraining, Ausdauerleistung, Radsport, Maximalkraft, Schnellkraft, Kraftausdauer, Stoffwechselsysteme, maximale Sauerstoffaufnahme, Laktatschwelle, Muskelfasertypen, Trainingsmethoden, Literaturanalyse, Anpassungserscheinungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen von Krafttraining auf die Ausdauerleistung im Radsport
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Auswirkungen von Krafttraining auf die Ausdauerleistung im Radsport. Sie analysiert widersprüchliche Forschungsergebnisse und bewertet den Einfluss verschiedener Krafttrainingsmethoden auf die Ausdauerleistungsfähigkeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die konditionellen Grundeigenschaften Kraft und Ausdauer, ihre physiologischen Grundlagen, die Einflussfaktoren der Kraft- und Ausdauerleistungsfähigkeit, die spezifischen Anforderungen im Radsport und eine umfassende Literaturanalyse zu den Auswirkungen von Krafttraining auf die Ausdauerleistung im Radsport. Zusätzlich werden trainingspraktische Konsequenzen und Empfehlungen für Radsportler formuliert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Kraft als konditionelle Grundeigenschaft (inkl. Definition, Physiologie, Strukturierung und Einflussfaktoren), Ausdauer als konditionelle Grundeigenschaft (inkl. Definition, Physiologie und Einflussfaktoren), die konditionellen Einflussgrößen im Radsport, eine Literaturanalyse zum Einfluss von Krafttraining auf die Ausdauerleistung im Radsport und schließlich trainingspraktische Konsequenzen mit Empfehlungen zur Trainingsgestaltung.
Welche Kraftfähigkeiten werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert zwischen Maximalkraft, Schnellkraft, Reaktivkraft und Kraftausdauer.
Welche physiologischen Grundlagen werden erläutert?
Die Arbeit beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise des Skelettmuskels, die Muskelkontraktion (inkl. Gleitfilamenttheorie), die verschiedenen Stoffwechselsysteme (Phosphatstoffwechsel, Glykolyse, aerobe Oxidation von Glykogen und Fetten), die Bedeutung der Muskelfasertypen, die maximale Sauerstoffaufnahme und die Laktatschwelle.
Wie werden die Ergebnisse der Literaturanalyse kategorisiert?
Die Literaturanalyse kategorisiert Studien nach ihrem Ergebnis: Studien, die einen positiven, neutralen oder negativen Einfluss von Krafttraining auf die Ausdauerleistung zeigen. Diese Kategorisierung wird ausführlich diskutiert, inklusive der Berücksichtigung von methodischen Unterschieden.
Welche Einflussfaktoren auf die Kraft- und Ausdauerleistung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet morphologische (Muskelquantität und -qualität), nervale (neuronale Aktivierung, Rekrutierung, Frequenzierung, Synchronisierung) und energetische Faktoren für die Kraftleistung und die Muskelfasertypen, die maximale Sauerstoffaufnahme und die Laktatschwelle für die Ausdauerleistung.
Welche trainingspraktischen Konsequenzen werden gezogen?
Die Arbeit gibt Empfehlungen zur Übungsauswahl, Übungsdurchführung und Koordinierung von Kraft- und Ausdauertraining im Radsport, sowie zum Einbau des Krafttrainings in den Jahresplan.
Welche Widersprüche werden in der Literaturanalyse aufgezeigt?
Die Literaturanalyse zeigt Widersprüche in den Forschungsergebnissen zum Einfluss von Krafttraining auf die Ausdauerleistung auf. Diese Widersprüche werden im Hinblick auf verschiedene Trainingsmethoden, Probandengruppen, Messgrößen und Messmethoden diskutiert. Insbesondere die unterschiedlichen Anpassungserscheinungen von Kraft- und Ausdauertraining werden thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Krafttraining, Ausdauerleistung, Radsport, Maximalkraft, Schnellkraft, Kraftausdauer, Stoffwechselsysteme, maximale Sauerstoffaufnahme, Laktatschwelle, Muskelfasertypen, Trainingsmethoden, Literaturanalyse, Anpassungserscheinungen.
- Quote paper
- Robert Mattes (Author), 2006, Zur Problematik des Krafttrainings im Radsport. Die Wirkung von Krafttraining auf die Ausdauerleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85133